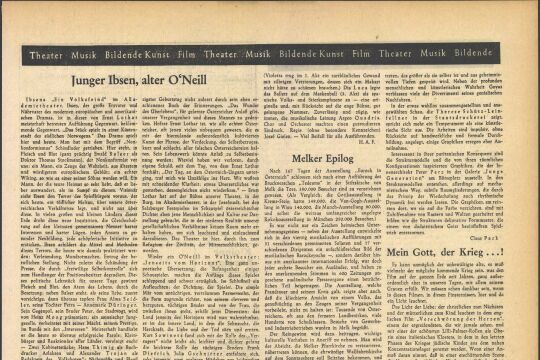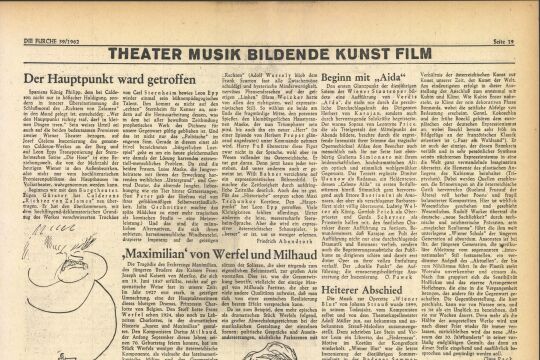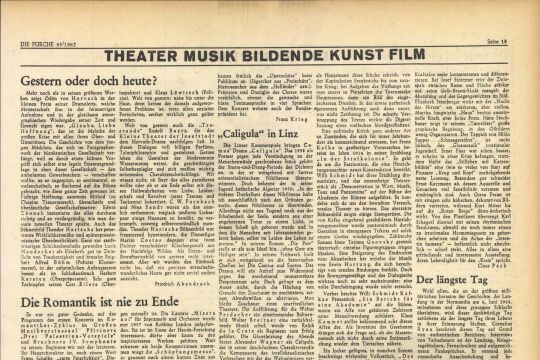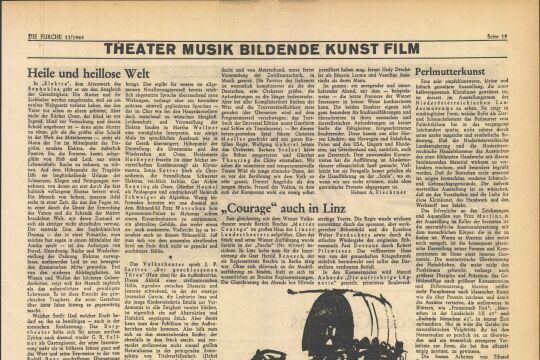Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Gespenster und Gespenstiges
Das Volkstheater wartet kurz hintereinander bereits mit dem zweiten Ibsen-Stück (diesmal für die Außenbezirke) auf. Warum spielt man Ibsens „Gespenster"? Diesen klinischen Fall vom Fluch der Vererbung („denn die Sünden der Väter werden heimgesucht an den Kindern") und wieder einmal Entlarvung der Lebenslüge, jener Lügen, mit denen es sich nicht und ohne die es sich auch nicht leben läßt? Die „Gespenster“ waren einst das anstößigste, kühnste Stück Ibsens. „Ich hielt die Zeit für gekommen, da man etliche Grenzpfähle umstecken müsse“, schrieb er im Jänner 1882, einen Monat nach Erscheinen seines Schauspiels. Aber Ibsens Kampf in seinem düsteren Familiendrama gegen Verlogenheit, Scheinheiligkeit und Muffigkeit stammt aus einer Welt von gestern, ja von vorgestern. Diese Welt ist selbst schon gespenster- haft geworden, auch wenn der Kampf der Wahrheit gegen die Lüge ohne Ende ist. Heute empfinden wir gerade Ibsens Kühnheit, sein direktes Zustoßen auf die Vorurteile der Zeit von reichlich viel Staub überlagert. Was immer noch seine Gültigkeit hat, und heute erst recht wieder, ist Ibsens Drängen nach einer Lebensform, in welcher der Mensch nicht verurteilt ist, Gespenst zu sein, Spielball von Wirklichkeiten, die ihn unaufhaltsam einholen und überwältigen. Um die Angst kreisen die Gespenster von heute. Um die Angst kreist die schleichende und wachsende Spannung dieses Dramas.
Die Bühnengeschichte der „Gespenster“ weist viele berühmte Namen auf. In den beiden namhaftesten Wiener Inszenierungen der letzten zwanzig Jahre spielten Käthe Dorsch und Helene Thimig die Frau Alving, Horst Caspar und Leopold Rudolf den Oswald, Ewald Balser und Anton Edthofer den Pastor Manders. In der Inszenierung des Volkstheaters unter der sehr modern wirkenden Regie Gustav M a n k e r s (der auch das prägnante, ausweglos wirkende Bühnenbild schuf) spielt Elisabeth Epp eindringlich das Schicksalhafte, die Unentrinnbarkeit, den grausamen Vollzug der tragischen Mutter, in welcher Gestalt wirklich die Hilflosigkeit einer ganzen Zeit, ja vielleicht eines ganzen Geschlechtes sichtbar wird. Recht gut ist Herbert Kucera als Oswald, unheilbar krank, leidenschaftlich und leidend, ausgezeichnet Ludwig Blaha in der richtigen Mischung von Servilität und Verschlagenheit als heuchlerischer Schurke Engstrand. Joseph Hendrichs als großsprecherischer, weltfremder Pastor Manders, dessen Muff-„Ideale“ nur zum Lachen reizen, füllte die Rolle, die seinem Typ zuwiderläuft, nicht so ganz aus, während Hilde S o c h o r als hemmungslos egoistische Regine, dieser ungute Zwitter zwischen der Welt der Herren und der Diener, doch bisweilen ein wenig stark ordinär auftrug. Das Publikum war von der Aufführung sichtlich beeindruckt.
Im Kleinen Theater in der Josefstadt im Konzerthaus lernte man zwei Kurzstücke eines in Wien bisher unbekannten französischen Dramatikers kennen, Franęois P a 1 i a r d, Professor für Philosophie in Paris, gibt als bevorzugte Lektüre die Bibel, Dostojewskij, Kafka und Beckett an. Als Dramatiker hält er also ungefähr die Mitte zwischen absurdem und realistischem Theater, bring! typische, nicht bloß psychologisch abgestützte Figuren, die in Sprache und Spiel über sich selbst hinausweisen. In einem Gespräch erklärte er für notwendig, aul dem Theater „Probleme nicht nur vorauszusehen. sondern zu meistern". Eines dieser großen Probleme sei „die Verständigung der Menschen untereinander“. Paliard interessieren demnach die menschlicher Beziehungen, ihr absurder Leerlauf. Abhold allen literarischen und philosophischen Ideen auf der Bühne, schildert er in seinen Einaktern in impressionistische: Manier Situationen. „Kandidat Corrn o r a n“ muß sich als unglückliche: Stellenbewerber einem derart unfreundlichen Test in einem psychotechnischen
Laboratorium unterziehen, daß er nichts als Angstträume produziert. Ihm tritt ein ungehemmterer junger Mann gegenüber, der zeigt, wie man selbstsicher und mühelos alle Schwierigkeiten meistert. „M onsieur Quino t“ ist der Mensch im Räderwerk der bösen Bürokratie, die ihm seine Papiere verweigert, aber bereitwillig den Strick zum Aufhängen liefert. Bis auf den tragischen Schluß erinnert dieses Stück an die grandios komische Bürokratenszene in Kafkas „Schloß“.
Unter der dichten Regie von Friedrich Kaili na wird im Konzerthaus treffliches Theater geboten. Hervorzuheben Nikolaus P a r y 1 a als sensibel verklemmter Kandidat, Peter M a t i i als smarter Gegentyp, Fritz Schmiedel als vergebens intervenierender Quinot und Renate Berg in zwei Rollen als attraktive junge Frau und Sekretärin. Bühnenbilder und Kostümentwürfe stammen von Inge Fiedler.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!