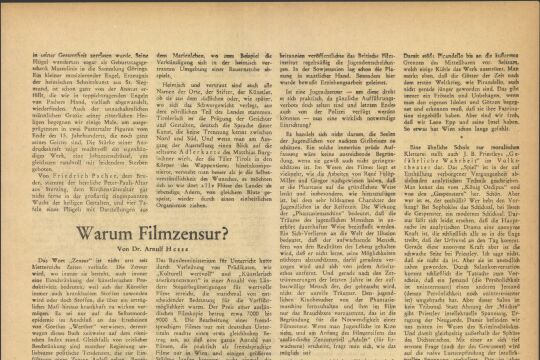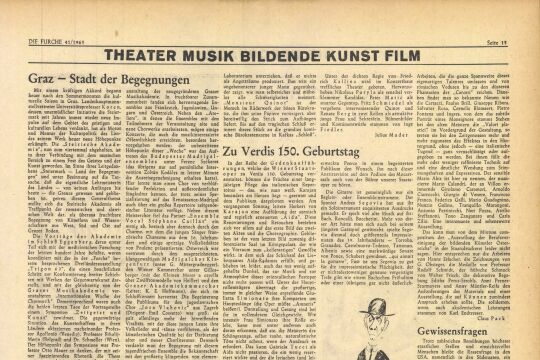Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Seele ist die Seele nicht mehr
Theater in der J o s e f s t a d t, „Gespenster“, Familiendrama in drei Akten von Henrik Ibsen, Inszenierung: Lothar Müthel, Bühnenbild: Rochus G1 i e s e.
Das zwanzigste Jahrhundert des Theaters begann mit Henrik Ibsen. Henrik Ibsens Wirksamkeit aber begann erst mit dem zwanzigsten Jahrhundert, als er keine Stücke mehr schrieb: denn erst die Jahrhundertwende brachte die revolutionäre Bewegung, die einen naturalistischen Aufführungsstil schuf, der allein eine werkgetreue Verwirklichung dieser ungestümen, kritischen, härten, gigantischen Dramen, die selbst eine Jahrhundertwende bedeutet hatten, ermöglichte. Zwei Dinge sind es, die uns an Ibsen wesentlich erscheinen: einmal seine sozialkritische Absicht, sein Wirken in der Gesellschaft,- die allein das Theater tragen kann (Theater ohne Gesellschaft ist undenkbar, nicht aber Kino ohne Gesellschaft!), und zum zweiten seine Gabe der Menschendarstellung. Durch diese sind seine Dramen lebendig geblieben; und durch den Wegfall ihres unmittelbaren Anlasses — der Zustände, gegen die sie sich wandten — erscheinen sie uns in ihrem Aufbau faszinierender als je. Ja: indem Ibsen so tief in seiner Zeit wurzelt, daß er in einer anderen gar nicht denkbar wäre, reicht er über sie hinaus und wird. bleiben, solange die Kunst der Menschendarstellung leben wird.
Die „Gespenster“ fangen dort an, wo „Nora“ aufhört; noch unbarmherziger und auswegloser erfüllt sich hier das Schicksal der Menschen. Eines freilich muß ich gestehen: selten habe ich mich Menschen auf der Bühne so wenig verwandt gefühlt wie denen Ibsens; über der Art seiner Seelenenthüllung und seiner Betrachtung seelischer Vorgänge liegt so viel grausamer Fatalismus, daß es keinen Augenblick, keine Stelle gibt, wo man sich mit einer der, Figuren identifizieren möchte, um dem Schicksal in den Arm zu fallen und alles anders kommen zu lassen.
Das Bühnenbild gibt einen hohen Raum, der in einen Erker ausläuft, von dem aus man hinausblickt
in die Enge eines Fjords: auch dort draußen in der Natur ist alles eng, düster, ausweglos, wie in der Seele der Menschen. — Eine große Aufführung, die mit starkem Beifall bedankt wurde: Ueberragend Helene Thimig als Helene Alving, eine kühle, verschlossene Frau, die das Verderben nicht aufhalten kann; Leopold Rudolf als ihr Sohn Oswald wächst erst langsam in seine Rolle hinein und hat gegen Schluß einige sehr starke Momente; Anton Edthofer als Pastor Manders war eine Spur zu liebenswürdig und naiv; dieser Pastor in seiner falschen Geistigkeit birgt ganz andere Abgründe in sich; Franz Pfaudler als Jacob Engstrand ließ sich keinen Effekt entgehen; Hannelore Schroth als seine Tochter Regina blieb kalt und hatte etwas zu wenig von dem Leben, nach dem sich Oswald sehnte, weil es ihm als Rettung erschien., *
Theater Die Tribüne, „Die Marquise von O.“, Schauspiel von Ferdinand Bruckner, Regie: Herbert K e r s t e n, Bühnenbild: Herta C a-n a v a 1.
Wie in der Geschichte die kleinen Negerlein der Reihe nach dahinsterben und immer weniger werden, so geht es jetzt unseren Kellerbühnen; heuer sind es nur noch fünf, die nach der Sommerpause neu begannen. Man weint den dahingegangenen nicht nach (denn mit den Kellertheatern ist es wie mit den Negerlein: die schwächsten sterben zuerst); und man fragt sich: welche Bühne wird die nächste sein, die das Schicksal ereilt? Die Tribüne zeigt sich einstweilen, trotz Mfcspäteten Saisonbeginns, dank der nachhaltigen Subventionen des Unterrichtsministeriums, recht lebendig.
Kleist (den das Programmheft nicht nennt) starb auf dem Wege von Kant zu Fichte (einem wahrhaft tödlichen Wege). „Die Marquise von O.“ (als Stück) stirbt auf dem Wege von Kleist zu Freud (einm ebenso tödlichen Weg). Als Frau wird der Marquise Julia von O. von einem französischen Hauptmann deutscher Nation Gewalt angetan; sie ist sich aber nicht
Im klaren, von wem das Kind ist; die Vaterfrage beschäftigt die Personen auf der Bühne aber weitaus stärker als das Publikum. Ferdinand Bruckner wollte, einer modernen Unsitte folgend, die Gestalten der. Kleistschen Novelle „psychologisch vertiefen“ oder „psychoanalytisch erklären“. Wir finden zwei Wirklichkeiten: die reale und die „idealistische“ (nicht metaphysische). „Damit, daß du es nicht wahrhaben willst, schaffst du es nicht aus der Welt“, sagt der Vater zu seiner Tochter, der Marquise. Sie aber hängt mit seltsamer Treue an einem Phantom, an einer eingebildeten Vatergestalt; „überall schlägt sich“ ihr „erdachtes Gebild vor“, und das tatsächliche Leben wird ihr leer. Aber auch der sehr „preußische“ Vater wurzelt nicht in dieser Welt. Mit Fichte verficht er absolute Forderungen gegen das sinnliche Leben, die ihn von einer echten Kommunikation mit allen Dingen ausschließen. — Es gibt ein Stück,, das ein ähnliches Problem behandelt: den „Oktobertag“ des expressionistischen Dichters Georg Kaiser. Auch dort wird die Vaterfrage aufgeworfen. Aber während hier der wahre Vater einem Phantom geopfert wird, siegt dort der „geistige“ Vater über den „zufälligen“ Zeuger des Kindes nach einem erregenden Kampf; dort ist sich die Liebende sehr wohl der Realität bewußt und hält unbeirrbar an einer Wirklichkeit fest, die sie als die höhere erkannt
hat; hier findet sich die Marquise in keiner der beiden möglichen Welten, der diesseitigen und der jenseitigen, zurecht.
Trotz allem: ein interessantes Stück, über das man lange diskutieren kann. Eine lebendige Aufführung in der Lia Ander als Marquise und Alfred Böhm als Hauptmann am besten entsprachen. Den stärksten Eindruck hinterließ das Bühnenbild, kleistisch einfach und sparsam, in wenigen, starken Farben gehalten. Es stammte von Herta Canaval; ein neuer Name, den man
sich wird merken müssen.
Kleines Theater im Konzerthaus.
„Der vergessene Himmel“ von John van Druten, Inszenierung: Friedrich Kallina, Bühnenbild: Robert H ö f e r - A c h.
Ort der Handlung: New York, Zeit: Gegenwart, zwischen Frühling und Herbst. Es ist das alte Lied vom Gerede, das so bühnenwirksam ist, wenn man es psychologisch aufzäumt und es ein paar „Menschen wie du und ich“ (sie könnten aus Reader's Digest sein) in den Mund legt. Es ist der „goldene Mittelweg“ zwischen echter Problemdarstellung und psychologischer Menschenskizzierung, der allen so gut gefällt, weil es der Weg des geringsten Widerstandes ist; er gibt jedem das, was er heraushören will, und im Grunde nichts, weil alles unverbindlich wird. Druten weicht den Problemen ebenso aus wie den Menschen. Dadurch, daß die Entstehung und das, Vorhandensein von Problemen psychologisch erklärt wird, verlieren diese ihre Realität, werden sie relativiert und zu bloßen Phänomenen. Der Autor kann auf die Lösung der Probleme verzichten, denn für Phänomene brauchen wir doch keine Lösung, nicht wahr? Es genügt, wenn er die Seele des Menschen „unter die Lupe nimmt“ und die Probleme, mit denen sie ringt, aufzeigt; „so sind wir eben, wit Menschen“. Aber mit der Lupe ist das ähnlich wie mit dem Spiegel, in den ein Affe hineinschaut: man sieht darin auch sich selbst. Und wer, wenn er die menschliche Seele betrachtet, nichts von der eigenen Seele dazugibt, wird immer enttäuscht sein. Denn psychologisch betrachtet, ist die Seele die Seele nicht mehr. — Ach, wie entsetzlich leer sind solche Stücke!
Eine ausgezeichnete Aufführung, ein einfallsreiches Bühnenbild (das beste, das wir hier je. sahen!). Die Darsteller, allen voran Hilde Nerber, Maria Groihs und Paul Barnay, verdienen alles Lob.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!