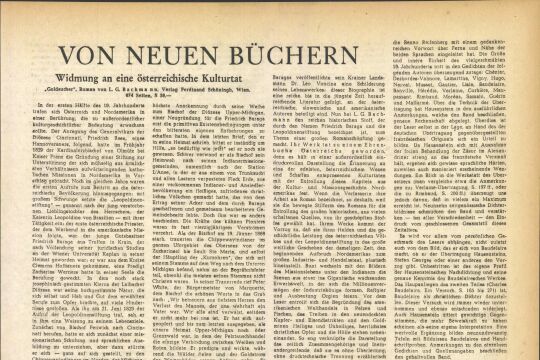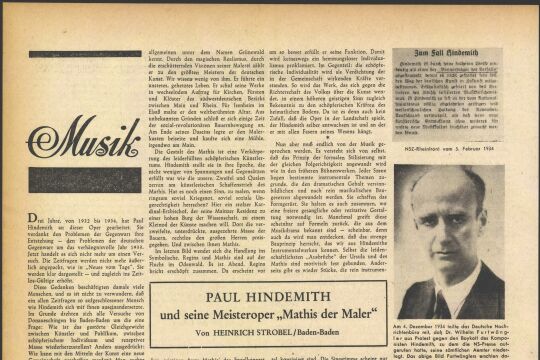Das Schicksal der nordamerikanischen Indianer wurde in den USA bis vor kurzem einseitig aus dem Blickpunkt der weißen Bevölkerung betrachtet. Wie auf vielen anderen Gebieten auch, deutet sich aber seit dem Vietnamkrieg eine Bewußtseinsänderung an. Die Situation der diskriminierten farbigen Minderheiten wird neuerdings wenigstens teilweise etwas objektiver zur Kenntnis genommen. Die schwarzen Amerikaner, immerhin zehn Prozent der Bevölkerung, haben berechtigte Ansprüche durchgesetzt, obwohl auch sie noch keineswegs gleichberechtigt sind.
Viel schlechter ging und geht es noch immer den Resten der indianischen Urbevölkerung, die zu schwach sind, sich einen angemessenen Platz in der amerikanischen Gesellschaft zu erringen. Immerhin gibt es in der Geschichtsschreibung der USA Ansätze, auf diese Mißstände hinzuweisen, die so sehr den Anspruch Amerikas widerlegen, Freiheit und Demokratie in ihrem Bereich allgemein verwirklicht zu haben.
Nun hat sich zu den amerikanischen Historikern, die dem Schicksal der Indianer nachgehen, der österreichische Völkerkundler Christian F. Feest gesellt, der in seiner Geschichte des „Roten Amerika“, objektiver als ein Betroffener der einen oder anderen Seite das tun könnte, die Leidenschronik der nordamerikanischen Indianer nacherzählt — von der Besitznahme der Gebiete durch weiße Siedler bis zur Besetzung des Dorfes Wounded Knee 1973 durch amerikanische Indianer, die mit diesem Akt gegen die Zustände in ihren Reservaten protestieren wollten.
Was dabei zutage kommt, ist ungeheuerlich. Die Geschichte der amerikanischen Urbevölkerung ist eine Kette von unzähligen Morden weißer Soldaten und Zivilisten an Indianern. Die Methoden, deren man sich zu ihrer Ausrottung bediente, waren verschieden. Am wirksamsten erwies sich die systematische Vertreibung der Stämme aus ihren angestammten Heimatgebieten, in die dann die weißen „Pioniere“ einzogen. Das führte zum Aushungern der Vertriebenen, die oft in den ihnen zugewiesenen Gebieten keine Existenzmöglichkeit fanden. Noch heute beträgt die Zahl der Un- und Unterbeschäftigten in manchen Indianer-Reservaten 84 Prozent. Auch die mit vertrauensvollen Häuptlingen im 19. Jahrhundert geschlossenen Verträge wurden kaum je eingehalten. Der Ausspruch „der einzige gute Indianer ist ein toter Indianer“, der General Sheridan zugeschrieben wird, drückt exakt die Haltung der weißen Siedler gegenüber der Urbevölkerung Amerikas aus, die sich teilweise bis heute erhalten hat.
Feest konfrontiert seine Leser mit der Schuld der weißen Siedler, die aus Übersee kamen und den Indianern ihr Land wegnahmen, und die heute noch ihre Gleichberechtigung verhindern. Heute zeichnet sich insofern Zukunftshoffnung für die kleinen Reste der nordamerikanischen Indianerstämme ab, als sie in den letzten Jahren an Selbstbewußtsein gewonnen haben und einen kulturellen Widerstand entwickeln, der an die alten Wertsysteme der Stämme anknüpft.
In der Oktober-Ausgabe der „Frankfurter Hefte“ fand ich zufällig einen Artikel von Karl H. Schlesier, „Vom Uberleben der nordamerikanischen Indianer“, der mit den Worten schließt: „Sie gehören zu den ersten Bewohnern des Kontinents; sie sind überzeugt, daß sie auch seine letzten seiri werden. “Sie wissen, daß in den Katastrophen der kommenden Jahrzehnte ihre Kulturen sich der weißen Industriegesellschaft als überlegen demonstrieren werden. Wenn niemand anderer, geben Ethnologen ihnen darin recht.“ Mir scheint diese Zukunftsvision nicht abwegig.
DAS ROTE AMERIKA. Nordamerikas Indianer. Von Christian F. Feest. Europa-Verlag Wien, 463 Seiten, öS 268,—.