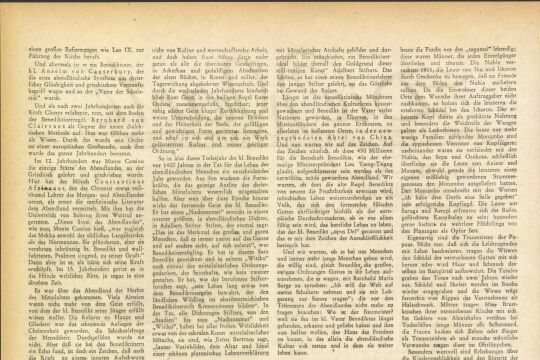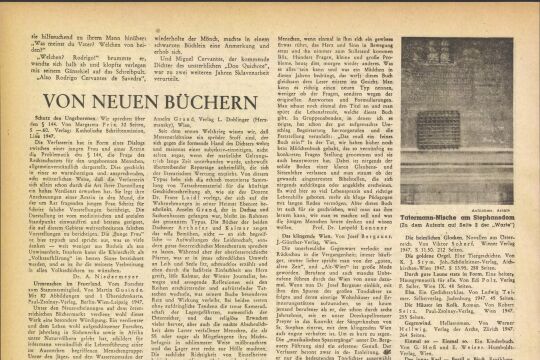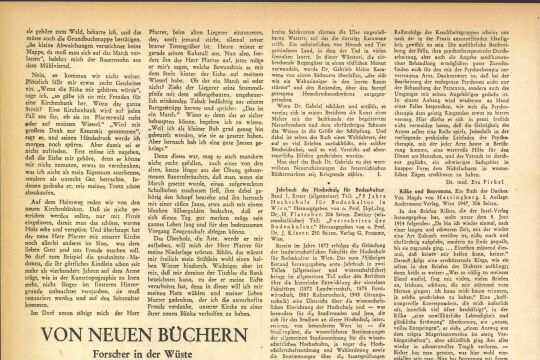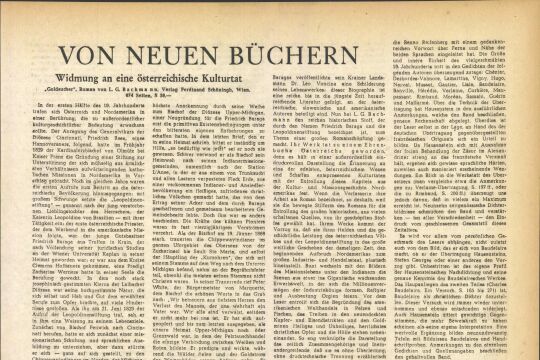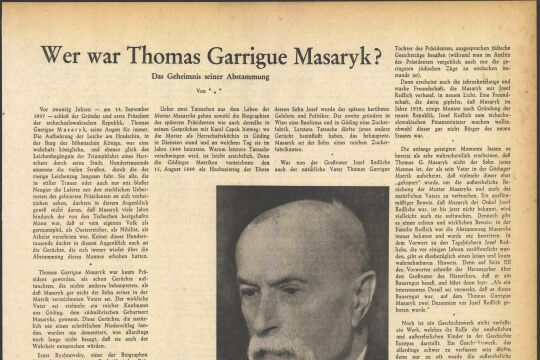Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Zeitgenossische indianische Malerei
Es war im Jahre 1917, als der Direktor des Neu-Mexico-Museums einen Puebloindianer von San Ilde-fonso bei Santa Fe bat, ihm einige Aquarelle zu machen. Das hörten noch andere Indianer und begannen auch, Aquarelle zu malen; sie hofften, sich etwas Geld zu verdienen auf leichte Art. Sie fanden Verständnis und wurden vom Museum in ihren Arbeiten unterstützt. So entstand die erste indianische Künstlergemeinschaft. i
Die Hinwendung zu einer primitiven, archaischen Kunst lag in der Zeit; der .Ueberdruß an der Zivilisation und ihren diversen Snobismen nährte die Sehnsucht nach unverdorbenen, urtümlichen Dingen. So war schon die erste Ausstellung der Indianer 1920 im Waldorf-Astoria in New York ein großer Erfolg, und viele weitere Ausstellungen folgten. Jetzt ist eine sogar bis nach Wien gekommen, wo sie im Museum für Völkerkunde gezeigt wird. Wir verdanken sie der Oesterreichisch-Amerikanischen Gesellschaft und der sehr rührigen University of Oklahoma.
Die Indianer, deren Freiheitskampf uns in unserer Jugend so begeisterte, treten heute im Zirkus auf. In den Reservationen in den USA, in denen sie jetzt leben, spielt der Fremdenverkehr eine große Rolle, und prominente Leute, die sie dort besuchen, dürfen mit ihnen die Friedenspfeife rauchen und eine Federhaube aufsetzen; so hörte man es zuletzt von Romy Schneider, die (wie Konrad Adenauer) irgendwo zum Häuptling h. c. ernannt wurde. Und nun malen die Indianer auch, und ihre Bilder haben Erfolg. Ich glaube, es ist einfach das Exotische, das Ungekonnte, das die Leute an diesen Bildern reizt. Was sonst? Ursprünglich sind sie nicht. Der Kunstbetrieb, immer auf Abwechslung bedacht, hat die „primitive Kunst“ entdeckt. Und da laufen die Indianer halt mit.
Fast alle die Indianer, deren Bilder wir in Wien sehen (insgesamt werden 48 gezeigt), wurden an amerikanischen Schulen und Colleges erzogen. Sie haben Kunstkurse an indianischen Schulen besucht, einige sogar richtige Kunstschulen. Irgendwelche ehrenwerte Männer werden ihnen dort beigebracht haben, was man allgemein unter Kunst versteht und wie man Vorlagen abzeichnet. Was herauskam, sind brave Schülerarbeiten, ein wenig ungelenk, aber sehr bemüht, es recht zu machen.
Wenn wir die Bilder aber näher betrachten, mit der Liebe, die wir in der Jugend für die Heldengestalten der Grenzzeit empfangen, so können wir aus ihnen die ganze Tragödie eines Volkes ablesen;vo#is?[uffiPch ifV'dSr Bwi&läÄtf ai i&ai* aufzwang, schlecht zurechtfindet. Indem es sich anzupassen versucht, verliert es sich selbst. Einstmals malten die Indianer der Präriegruppe, die Dakota, Kiowa und Cheyenne-Arapaho, auf Büffelhäuten. Als aber der weiße Mann, besessen von einem Bluttaumel, die Bisonherden ausrottete (jetzt stehen die letzten unter „Naturschutz“), gab es keine Büffelhäute mehr, darauf zu malen. Und nur noch wenige Indianer... Die heutigen Prärieindianer malen auf Papier. Darin schon liegt der ganze Substanzverlust beschlossen, den die Indianermalerei erlitten hat. Früher waren es Kundgebungen einer mythischen Welt, und die Darstellungen hatten magische Kraft. Man glaubte an sie, wie man an die alten Gottheiten glaubte. Es waren Bilder, in denen man leben konnte. Deswegen hatten die Indianer, als die ersten weißen Expeditionen kamen, auch instinktive Angst, sich malen zu lassen, in der Furcht, ihre Seele zu verlieren...
Heute machen sie Lesebuchillustrationen. Gewiß, sie sind interessant — aber nur des dargestellten Inhalts wegen, in dem wir noch alte Zeremonien erkennen. In den Bildern kann man ebensowenig leben, wie man auf dem kärglichen Boden der Reservationen leben kann. Es sind zahme, dressierte Bilder. Manchmal freilich bricht noch die alte Kraft duren. Das ist dann, wenn sie ihre rituellen Tänze ,malen: den Hirsch-Tänzer und den Antilopenjagd-Tanz, Kriegstanz, Korbtanz, Erntetanz. Die Gesichter, die sie malen, sind ohne Ausdruck. Wenn aber die Tänzer Masken tragen, dann kommt mit den Masken plötzlich wieder ein geheimnisvoller, dunkler Zauber in die Bilder, und schemenhaft wird die alte Zeit lebendig. — Wer Beispiele besonders gelungener Indianermalerei sehen will, der besorge sich das ausgezeichnete, authentische Werk „Ich rufe mein Volk“ von Black Elk, erschienen im Otto-Walter-Verlag in Ölten; es enthält viele farbige Reproduktionen von Bildern des Indianers „Stehender Bär“.
Die besten der in Wien gezeigten Arbeiten stammen von den Pueblo und Navaho; von diesen sind es wieder die Sandgemälde, die am meisten ursprüngliche Kraft verraten. Diese in den Sand gemalten Bilder, ohne Anspruch und Nebenabsicht entstanden, sind zugleich rituell und spontan: eines davon wird in einer sorgfältig ausgeführten Nachahmung in der Größe von etwa 2X2 Meter gezeigt. Umgeben von der Regenbogengottheit stehen vier Götter und zwischen ihnen die vier wichtigsten Kulturpflanzen (Mais, Bohnen, Kürbis und Tabak) um einen zentralen Wasserbehälter. Die Götter sind in den Farben der Weltrichtungen gemalt: der Osten ist weiß, der Süden blau, der Westen gelb, Norden schwarz. Die Figuren stehen auf einer radrunden Mitte, ihre Köpfe weisen in die vier Himmelsrichtungen. Dieses Bild bedeutet die Welt; da ist nichts von Lesebuchatmosphäre zu spüren, das Werk ist ganz von den Regeln m'Vthfs'cheri3RrttrMs Bestimmt*'*•* ♦ nM M
Eine apÄÄts1MäftaayäslM|P trefflich ergänzt durch Gegenstände täglichen Gebrauchs: bemalte Tanzstäbe der Hopi, Bilderschrift auf Birkenrinde, geflochtene Körbe, gewebte und bestickte Decken, bunte Ledertaschen und anderes mehr.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!