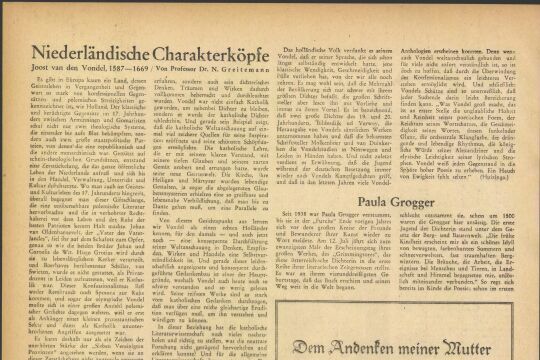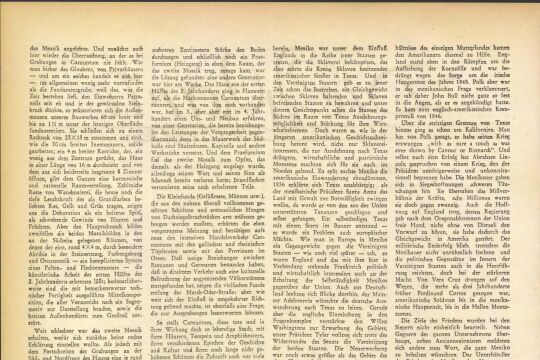Eine Nation schafft sich Identität
Zur Ausstellung "America - die Neue Welt in Bildern des 19. Jahrhunderts": Vom kulturellen Sibirien zum Impulsgeber für Europa.
Zur Ausstellung "America - die Neue Welt in Bildern des 19. Jahrhunderts": Vom kulturellen Sibirien zum Impulsgeber für Europa.
Mit 140 Bildern macht sich die Österreichische Galerie im Wiener Belvedere ab 17. März auf die Suche nach den Wurzeln amerikanischer Kunst und Identität.
Zwei Eckdaten geben den Rahmen: 1776 und 1917. Noch heute ist der 4. Juli 1776 in Form des wichtigsten weltlichen Feiertags in den USA gegenwärtig: Independence Day. Gefeiert wird die Loslösung vom Mutterland Großbritannien. Nicht länger gehorchten die seit dem frühen 17. Jahrhundert ausgewanderten "Kolonialengländer" dem Diktat der britischen Krone. Der Unabhängigkeit gingen heftige kriegerische Auseinandersetzungen voraus, eine Revolution.
Ein Postulat dieser Revolution, die Unabhängigkeit, wurde rasch erreicht; doch die übrigen Grundsätze, Gleichheit, Freiheit, das Streben nach Glück, sind den Amerikanern bis heute Ziele, denen es sich anzunähern gilt. Insofern ist das Urteil, die USA seien eine junge Nation, falsch. Welches alte europäische Land kann auf 200 Jahre ungebrochene Verfassungstradition zurückblicken? Amerikanische Präsidenten der Gegenwart nehmen ohne Probleme Bezug auf die Gründerväter ihrer Nation, auf George Washington oder Thomas Jefferson. Welchem österreichischen Bundeskanzler würde es je einfallen, in einer Regierungserklärung auf Maria Theresia oder Josef II. zurückzugreifen?
Der Kampf der Kolonialengländer, die sich ab 1760 zunehmend Amerikaner nannten, galt ihrer politischen Selbstbestimmung. Kulturell blieben sie an der Nabelschnur Englands. Einer ihrer Gründerväter, Benjamin Franklin, drückte das so aus: "Alles ist nur in dem Maße gut oder schön, indem es nützlich ist. Und die Nützlichkeit der Dinge richtet sich nach den obwaltenden Umständen. Poesie, Malerei und Musik sind notwendige und gute Resultate verfeinerter gesellschaftlicher Verhältnisse. In einer frühen Phase müssen wir sie aber ablehnen, denn das Verlangen, sie zu genießen, eilt dann den gegebenen Mitteln voraus." Zupacken, Wildnis urbar machen, kämpfen, darum ging es in der jungen Nation.
Künstlerisch waren die USA in ihren Anfangsjahren ein Sibirien. Es gab einige "limner painters", wandernde Porträtmaler, die reichen Kaufherren anboten, sie und ihre Familien auf die Leinwand zu bannen. Die Kunstwerke waren ungelenk, denn die frühen amerikanischen Maler lernten autodidaktisch, ohne jede Akademie. Und doch betraten sie schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts kühn Neuland. Im Europa des 18. Jahrhunderts wurde in der Malerei am höchsten das Historienbild geschätzt. Für die Themen griffen europäische Künstler auf antike und biblische Stoffe zurück. Nicht so die amerikanischen Künstler.
Sie stellten Szenen aus ihrer eigenen Gegenwart dar: Schlachten gegen englische Truppen, Kämpfe gegen die Indianer. Das war revolutionär, bedeutete es doch eine radikale Abkehr von allen bis dahin als bildwürdig eingestuften Sujets. Malerei wurde so zur Begründung einer eigenen nationalen Tradition.
Im Jahr 1803 kauften die Vereinigten Staaten - damals waren es 13 - von Frankreich die westliche Hälfte des Mississippi-Beckens: der sogenannte Louisana Purchase. Mit diesem größten Landkauf in der Geschichte der USA verdoppelte der junge Staat mit einem Schlag seine Größe. Das Ausgreifen nach Westen hatte begonnen. Bei dieser Expansion ging man nicht zimperlich vor. Nur ein Beispiel: Um Kalifornien der Union einzuverleiben, brach man einen Krieg mit Mexiko vom Zaun.
Im 18. Jahrhundert von Spaniern besiedelt, gehörte Kalifornien dann zu Mexiko, doch wurden Oberkalifornien und das Territorium von New Mexiko vom Staat Mexiko einfach abgetrennt. Das Schlagwort zur Rechtfertigung dieser Politik lautete "Manifest Destiny": "The fulfillment of our manifest destiny to overspread the continent allotted by Providence". Die Amerikaner bemühten also die Vorsehung, nach der sie eine offenkundige Bestimmung zu erfüllen hätten, welche lautete, den Kontinent in Besitz zu nehmen.
"Wilderness" Nach Westen gehen hieß im Selbstverständnis der Amerikaner, leere Wildnis in eine Gartenwelt zu verwandeln. Der Westen wurde zum Inbegriff des Neuen, des radikal anderen. Damals schuf Amerika jenes Bild von sich, das noch heute existiert: als Land unerschöpflicher Fülle. Als erste griffen Schriftsteller die Landschaft als Thema auf: Emerson, Thoreau, Walt Whitman. Dann folgten die Maler. Den Puritanern war die Wildnis ein unheimlicher Ort gewesen, bevölkert von Dämonen. In ihren Berichten nach Europa heißt es, das Land bestehe nur aus Wäldern. Die frühe amerikanische Landschaftsmalerei ist ein Beleg für das, was man aus dem Land gemacht hat: urbares Ackerland. Erst um die Mitte des vorigen Jahrhunderts entdecken die Maler die Schönheit der Niagara-Fälle, der Sierra Nevada, der Rocky Mountains. "Wilderness" wird zu einem zentralen Begriff der amerikanischen Kulturgeschichte.
Eine Nation schafft sich Identität über das Naturerlebnis. Amerikanische Landschaftsmaler verlassen in den Sommermonaten ihre Studios in New York, um im Westen großformatige Bilder zu malen, die den Menschen an der Ostküste die grandiose Natur des eigenen Landes zeigen sollten. Doch unaufhaltsam schreiten die Verstädterung und Industrialisierung voran. Die bildende Kunst wird zum Anwalt der Naturschönheiten.
Den Spaniern wird bis heute Völkermord an den Indianern Mittel- und Südamerikas zur Last gelegt. Auch Nordamerika ist nicht unbewohnt. Die Ureinwohner werden abgedrängt, viele fallen in Kämpfen, die übrigen werden in Reservate gewiesen. Und die Malerei läßt sich vor den Propagandakarren spannen . Auf Bildern erscheinen Indianer als grausam, verschlagen, hinterhältig, vertragsbrüchig. Der berühmte aus Deutschland stammende Albert Bierstadt zeigte auf einem Bild, wie ein Indianer den letzten amerikanischen Büffel mit einer Lanze ersticht. Dabei waren es von den Eisenbahngesellschaften gedungene Viehmörder, die die Büffel ausrotteten, um den Indianern die Lebensgrundlage zu entziehen: Geschichtsfälschung in der Malerei. Ein klassischer Fall von Verdrängung ist der amerikanische Bürgerkrieg (1861-1865).
Dieses Trauma, das mehr Amerikanern das Leben kostete als alle anderen Kriege in der Geschichte der USA zusammen, verschwiegen die amerikanischen Maler. Wer hätte auch Bilder des Grauens kaufen sollen? Der Kampf der Nordstaaten gegen die sklavenhaltenden Südstaaten rief bei den Malern Nostalgie nach den früheren besseren Zeiten hervor: sie malten heimelige Szenen aus dem Farmerleben.
Ein weiteres Thema, das die französischen Impressionisten emphatisch aufgriffen, fand nur zögerlich Eingang in die Malerei: Das Großstadtleben. Schließlich erzwang die Fotografie dieses Thema, und junge Künstler, von der Kritik als "ash-can school" (Mülltonnenmaler) abgetan, wandten sich mit raschem Pinselstrich Sujets zu, die bis dahin tabu waren: Alltagsszenen, Banales, die Hinterhöfe der Großstadt. Allmählich verloren amerikanische Künstler auch ihren Minderwertigkeitskomplex gegenüber Europa. Und jetzt wendet sich das Blatt.
Magnet für Europa Neue Impulse kommen zum erstenmal aus den USA nach Europa, zuerst auf dem Gebiet der realistischen Fotografie, dann in der Architektur. Das Hochhaus ist eine amerikanische Erfindung. Dem demokratischen Denken entsprechend, gibt es im Hochhaus keine Beletage mehr, kein Stockwerk für die noblen Herrschaften. Um die Jahrhundertwende wurden die USA zum Magneten für wagemutige Künstler aus Europa. Gustav Mahler geht an die "Met" in New York; Adolf Loos studiert in Chicago Architektur. Europas Künstler waren sensibel genug zu erkennen, daß Amerika nicht länger an der Nabelschnur Europas hing. Europäische Politiker hingegen unterschätzten die neue Weltmacht fundamental. Umso größer war die Überraschung, als die USA 1917 innerhalb kürzester Zeit ein Millionenheer zum Kriegseinsatz bereit hatten. Mit diesem Datum schließt die "America"-Ausstellung.
17. März bis 20. Juni 1999.
Österreichische Galerie, 1030 Wien, Prinz-Eugen-Straße 27, täglich 10-19 Uhr, Tel. (01) 79557 222.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!