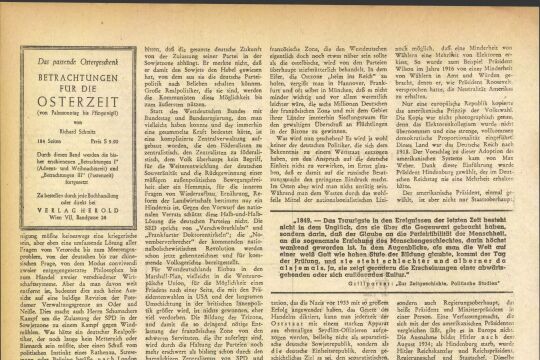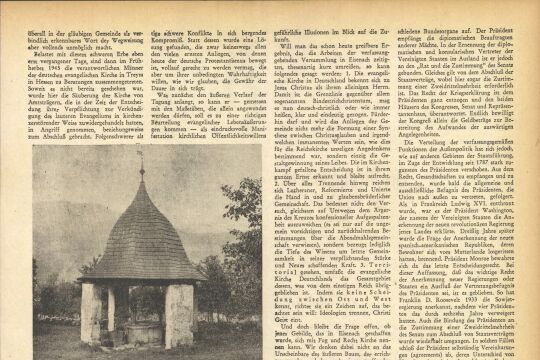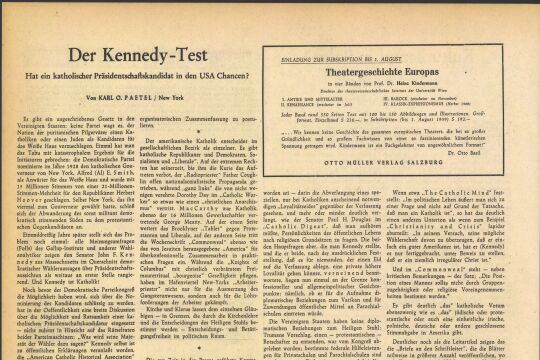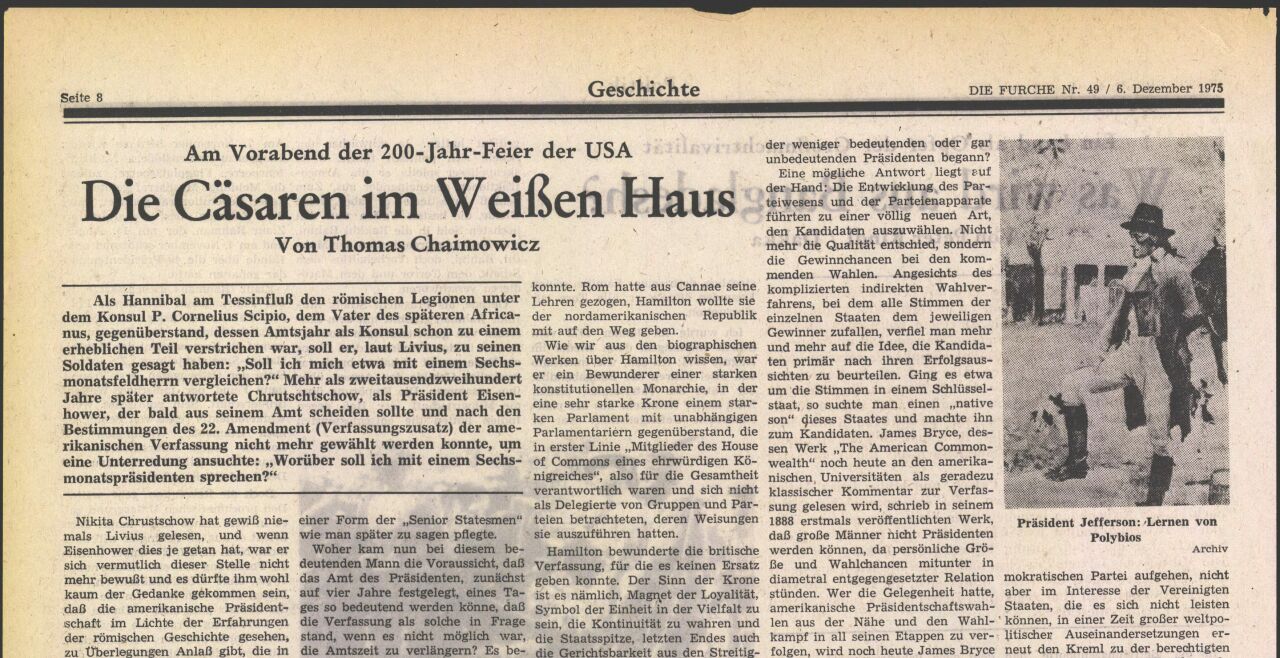
Die Cäsaren im Weißen Haus
Als Hannibal am Tessinfluß den römischen Legionen unter dem Konsul P. Cornelius Scipio, dem Vater des späteren Africa-nus, gegenüberstand, dessen Amtsjahr als Konsul schon zu einem erheblichen Teil verstrichen war, soll er, laut Livius, zu seinen Soldaten gesagt haben: „Soll ich mich etwa mit einem Sechs-monatsfeldherrn vergleichen?“ Mehr als zweitausendzweihundert Jahre später antwortete Chrutschtschow, als Präsident Eisen-hower, der bald aus seinem Amt scheiden sollte und nach den Bestimmungen des 22. Amendment (Verfassungszusatz) der amerikanischen Verfassung nicht mehr gewählt werden konnte, um eine Unterredung ansuchte: „Worüber soll ich mit einem Sechsmonatspräsidenten sprechen?“
Als Hannibal am Tessinfluß den römischen Legionen unter dem Konsul P. Cornelius Scipio, dem Vater des späteren Africa-nus, gegenüberstand, dessen Amtsjahr als Konsul schon zu einem erheblichen Teil verstrichen war, soll er, laut Livius, zu seinen Soldaten gesagt haben: „Soll ich mich etwa mit einem Sechs-monatsfeldherrn vergleichen?“ Mehr als zweitausendzweihundert Jahre später antwortete Chrutschtschow, als Präsident Eisen-hower, der bald aus seinem Amt scheiden sollte und nach den Bestimmungen des 22. Amendment (Verfassungszusatz) der amerikanischen Verfassung nicht mehr gewählt werden konnte, um eine Unterredung ansuchte: „Worüber soll ich mit einem Sechsmonatspräsidenten sprechen?“
Nikita Chrustschow hat gewiß niemals Livius gelesen, und wenn Eisenhower dies je getan hat, war er sich vermutlich dieser Stelle nicht mehr bewußt und es dürfte ihm wohl kaum der Gedanke gekommen sein, daß die amerikanische Präsidentschaft im Lichte der Erfahrungen der römischen Geschichte gesehen, zu Überlegungen Anlaß gibt, die in eben diesen Monaten höchst aktuell sind, vielleicht um so aktueller, als eben diese Überlegungen in dem Dokument aufscheinen, das mit Recht heute als Klassiker der Staatskunst und der Verfassungsgeschichte gewertet wird — in der Sammlung von Artikeln, mit welchen Madison, Jay und Hamilton für die Ratifizierung der neuen Verfassung im Staate New York warben, dm „Fe-deralist“.
Die Ratifizierung der Verfassung durch den neuen Staat New York war für das Inkrafttreten des Dokuments von entscheidender Wichtigkeit und so kommt den im „New York Packet“ von 1788 erschienenen Beiträgen des „,Federalist“, die sich mit der Präsidentschaft beschäftigen und insgesamt von Alexander Hamilton verfaßt wurden, größte Bedeutung zu. In diesen Beiträgen, die bezeichnenderweise mit „.Püblius“ gezeichnet waren, argumentiert Hamilton, daß die Präsidentschaft zwei Grundzüge aufweisen müsse: Positive Amtsdauer von beträchtlicher Länge und die unbegrenzte Wieder-wählbarkeit. Er beruft sich auf die kurze Dauer des römischen Konsulates, von dem während des Zweiten Punischen Krieges Q. Fabius Maximus gesagt hat, daß es bereits zur Half te verstrichen sei, wenn der Träger des Amtes sich in diesem zurechtgefunden habe. Hamilton zeigt auf, daß die Kollegialität und die Annuität des Amtes jeder kontinuierlichen Politik abhold gewesen seien. Und in der Tat, in der Verfassung der Vereinigten Staaten ist das Kapitel über die Präsidentschaft (Article II, Sect. 1,1) äußerst kurz und flexibel gehalten, um eine Anpassung an veränderte Umstände'“sowohl auf dem Wege des Amendment als auch auf dem Wege der Interpretation zu ermöglichen. Hamilton argumentiert, daß es möglich sein müsse, von der gesammelten Weisheit derer, die Präsidenten gewesen seien, auch nach dem Ablauf ihrer Amtszeit Nutzen zu ziehen, sei es durch die Möglichkeit der Wiederwahl, sei es durch das Heranziehen ehemaliger Präsidenten in irgendeiner Form der „Senior Statesmen“ wie man später zu sagen pflegte.
Woher kam nun bei diesem bedeutenden Mann die Voraussicht, daß das Amt des Präsidenten, zunächst auf vier Jahre festgelegt, eines Tages so bedeutend werden könne, daß die Verfassung als solche in Frage stand, wenn es nicht möglich war, die Amtszeit zu verlängern? Es besteht kein Zweifel darüber, daß Hamilton, wie viele andere Verfassungsväter, eine sehr gründliche Kenntnis der römischen Geschichte hatte. Der amerikanische Historiker Morison hat in seiner Oxford History of-the American People in überzeugender Weise dargelegt, daß die Gleichgewichtsvorstellungen der amerikanischen Verfassung, die „Checks and Balances“ auf den griechischen Historiker Polybios zurückgehen, der im zweiten vorchristlichen Jahrhundert die römische Verfassung als eine „Mischverfassung“ dargestellt hatte, bestehend aus einem monarchischen, einem aristokratischen und einem demokratischen Teil. Als die große Convention tagte, sandte Jefferson einer großen Anzahl der Teilnehmer aus Paris eine Ausgabe des Polybios.
Was Ortega in unseren Tagen bemerkte, wurde damals von den Angehörigen der geistigen Oberschicht gut verstanden: Wenn man den Zyklus der römischen Geschichte, der als einziger abgeschlossen vor uns liegt, nicht mehr als Vergleichsgrundlage heranziehen kann, wird jedes politische Urteil auf lange Sicht unmöglich und der moderne Mensch sinkt auf die Stufe des Barbaren herab. Dies ist im Falle Alexander Hamiltons um so bemerkenswerter, als dieser sich, in seiner Zeit als erster Finanzminister der Vereinigten Staaten, als Finanzgenie erwies und die kommende Bedeutung der wirtschaftlichen Macht der Vereinigten Staaten als einer der ganz wenigen Zeitgenossen voraussah. Er wußte, daß Kontinuität im Politischen und Entfaltung der wirtschaftlichen Möglichkeiten im kommerziellen Bereich eng miteinander verbunden sind. Er wußte, daß man im Zweiten Punischen Krieg in Rom alle geltenden Praktiken, welche eine „continuatio“, eine Kontinuierung der Konsuln im Amte verboten, beseitigt hatte, da man dem genialen Feldherrn und Staatsmann Hannibal, dem Rom durch volle zwei Jahrzehnte gegenüberstand, nur durch eine kontinuierliche militärische und politische Macht Widerstand leisten konnte. Rom hatte aus Cannae seine Lehren gezogen, Hamilton wollte sie der nordamerikanischen Republik mit auf den Weg geben.
Wie wir aus den biographischen Werken über Hamilton wissen, war er ein Bewunderer einer starken konstitutionellen Monarchie, in der eine sehr starke Krone einem starken Parlament mit unabhängigen Parlamentariern gegenüberstand, die in erster Linie „Mitglieder des House of Commons eines ehrwürdigen Königreiches“, also für die Gesamtheit verantwortlich waren und sich nicht als Delegierte von Gruppen und Parteien betrachteten, deren Weisungen sie auszuführen hatten.
Hamilton bewunderte die britische Verfassung, für die es keinen Ersatz geben konnte. Der Sinn der Krone ist es nämlich, Magnet der Loyalität, Symbol der Einheit in der Vielfalt zu sein, die Kontinuität zu wahren und die Staatsspitze, letzten Endes auch die Gerichtsbarkeit aus den Streitigkeiten der Parteien herauszuhalten. Sie hat auch die Aufgabe, zu verhindern, daß sich auf Parteibasis das persönliche Regiment etablieren könne, eine Gefahr, der heutzutage fast alle Republiken ausgesetzt sind. Der König war der Gegenpol zur Tyrannis.
Die Kurzsichtigkeit des Kabinettes
North im Mutterland hatte den britischen Siedlern in Ubersee aus mer-kantilistischen Erwägungen jene Rechte verweigert, die den Untertanen der Krone in Großbritannien selbstverständlich zustanden, unter anderem die Mitwirkung an der Besteuerung. Daß König Georg III. sich in dieser wirtschaftlichen Auseinandersetzung zwischen Anhängern des Merkantilismus und denen des Freihandels auf die ersteren stützte, liegt in der Macht der Gewohnheit und in der Tatsache begründet, daß eben damals, von wenigen ruhmreichen Ausnahmen abgesehen, die merkan-tilistische und protektionistische Mentalität vorherrschend war.
Eben dieser Umstand ließ den König nach und nach in den Augen vieler Amerikaner als seiner Aufgabe untreu erscheinen und als sich dann der Bruch mit dem Mutterland vollzog, mußte man, mehr nolens als vo-lens, nach einem Ersatz für die Monarchie suchen, der, wie Hamilton sehr wohl wußte, nur in begrenzter Form möglich war.
Bis zum Ende der Amtszeit von John Quincy Adams (1829) waren die Präsidenten der Vereinigten Staaten durchaus bedeutende Männer. John Quincy Adams hatte seinerzeit als Botschafter der Vereinigten Staaten am preußischen Hof die Schrift von Friedrich von Gentz: „Vergleich zweier Revolutionen“, in der die Amerikanische der Französischen Revolution gegenübergestellt wird, gelesen und sie ins Englische übersetzt. Wotan liegt es nun, daß mit dem Ende seiner Amtszeit im Jahre 1829 die Ära der großen Persönlichkeiten zu Ende ging und diejenige der weniger bedeutenden oder gar unbedeutenden Präsidenten begann?
Eine mögliche Antwort liegt auf der Hand: Die Entwicklung des Parteiwesens und der Parteienapparate führten zu einer völlig neuen Art, den Kandidaten auszuwählen. Nicht mehr die Qualität entschied, sondern die Gewinnchancen bei den kommenden Wahlen. Angesichts des komplizierten indirekten Wahlverfahrens, bei dem alle Stimmen der einzelnen Staaten dem jeweiligen Gewinner zufallen, verfiel man mehr und mehr auf die Idee, die Kandidaten primär nach ihren Erfolgsaussichten zu beurteilen. Ging es etwa um die Stimmen in einem Schlüssel-stäat, so suchte man einen „native son“ dieses Staates und machte ihn zum Kandidaten. James Bryce, dessen Werk „The American Commonwealth“ noch heute an den amerikanischen Universitäten als geradezu klassischer Kommentar zur Verfassung gelesen wird, schrieb in seinem 1888 erstmals veröffentlichten Werk, daß große Männer nicht Präsidenten werden können, da persönliche Größe und Wahlchancen mitunter in diametral entgegengesetzter Relation stünden. Wer die Gelegenheit hatte, amerikanische Präsidentschaftswahlen aus der Nähe und den Wahlkampf in all seinen Etappen zu verfolgen, wird noch heute James Bryce recht- geben.
Abgesehen von der bedeutsamen Veränderung in der Zusammensetzung der Bevölkerung, die sich im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert vollzog, spielt bei dieser Mentalität sicherlich auch die Tatsache eine Rolle, daß die Vereinigten Staaten erst gegen Ende des vorigen
Jahrhunderts zu einer wirklichen Großmacht mit Weltgeltung wurden. Es ist charakteristisch für die Mentalität kleinstaatlicher Politiker, daß sie, im Gegensatz zum wahren Staatsmann, immer nur in innenpolitischen Kategorien zu denken vermögen und ihnen die jeweils nächsten Wahlen mehr bedeuten als eine kontinuierliche Außenpolitik. Wer die jüngste Kabinettsumbildung Präsident. Fords näher betrachtet und sie in Relation zu der bevorstehenden Runde der Primärwahlen zu setzen weiß, wird sich davon überzeugen können, daß sich seit den Tagen von James Bryce nichts geändert hat.
Es ist allgemein bekannt, daß Gerald Ford zu einem Zeitpunkt von Nixon als Vizepräsident vorgeschla^ gen wurde, als jedermann annehmen mußte, daß der Vizepräsident fehr bald an die Stelle des Präsidenten treten werde. Ford wurde als eine allen genehme, unbedeutende Erscheinung auch von den Demokraten akzeptiert, die ja ihre Einwilligung in dem von ihnen beherrschten Kongreß geben mußten. Man wollte einen schwachen Kandidaten, um zu verhindern, daß bei den Wahlen im Jahre 1976 Gerald Ford als erfolgreicher Bewerber um das Amt des Präsidenten auftreten könne. Die Rechnung der Demokraten könnte noch im Frühjahr des kommenden Jahres aufgehen, falls etwa Gouverneur Reagan es gelingen sollte, bei einigen der Primärwahlen einen Erfolg über Gerald Ford davonzutragen, was diesen unter Umständen zur Zurückziehung seiner Kandidatur veranlassen könnte. Die Rechnung der Demokraten würde im Sinne der demokratischen Partei aufgehen, nicht aber im Interesse der Vereinigten Staaten, die es sich nicht leisten können, in einer Zeit großer weltpolitischer Auseinandersetzungen erneut den Kreml zu der berechtigten Frage zu veranlassen: „Worüber sollen wir mit den Sechsmonatspräsidenten reden?“ Wenn es nicht gelingt, das Problem der Kontinuität in der Präsidentschaft innerhalb der sehr weise konzipierten Verfassung zu lösen, wird die historische Dynamik eigene Wege gehen. Der Versuch Franklin Delano Roosevelts, unter dem Vorwand des Krieges die Präsidentschaft über die bis dahin nur gewohnheitsmäßig bestehende „two term tradition“ hinaus auszudehnen, der offensichtliche Griff der Kennedys nach der' Macht sind lediglich Sturmzeichen auf dem Weg zum persönlichen Regiment. Eines Tages könnte ein Präsident daran denken, seine Stellung als Oberbefehlshaber zur Verlängerung seiner Präsidentschaftsdauer zu mißbrauchen jind wie sehr derartige Befürchtungen vor gär nicht langer Zeit ernstgenommen wurden, zeigt der Umstand, daß alle höheren Offiziere der Armee, der Luftwaffe und der Marine einer genauen Überwachung unterzogen wurden, als es klär wurde, daß Richard Nixon nur noch ein Weg aus dem mutwillig angezettelten Water-gateskandal blieb: der Rücktritt. Als vor bald zwei Jahrzehnten in Amerika ein Buch mit dem Titel erschien: „The Coming Cesars of America“, war man geneigt, darin die extravagante Deutung eines geistreichen Franzosen zu sehen. Hamilton hätte die Warnung verstanden und der große deutsche Althistoriker Eduard Meyer, der im Jahre 1918 den Konflikt um die persönliche Macht als den bestimmenden Konflikt der amerikanischen Geschichte voraussagte, würde sich nicht weiter wundern. Wenn man angesichts eines besonders starken und gefährlichen außenpolitischen Gegners den jeweils schwächsten Mann für das höchste Amt wählt, um innenpolitischen Erwägungen Nachdruck zu verleihen, begibt man sich in die Gefahr, das große Ringen um die Weltgeltung 200 Jahre nach der Unabhängigkeit zu verlieren.