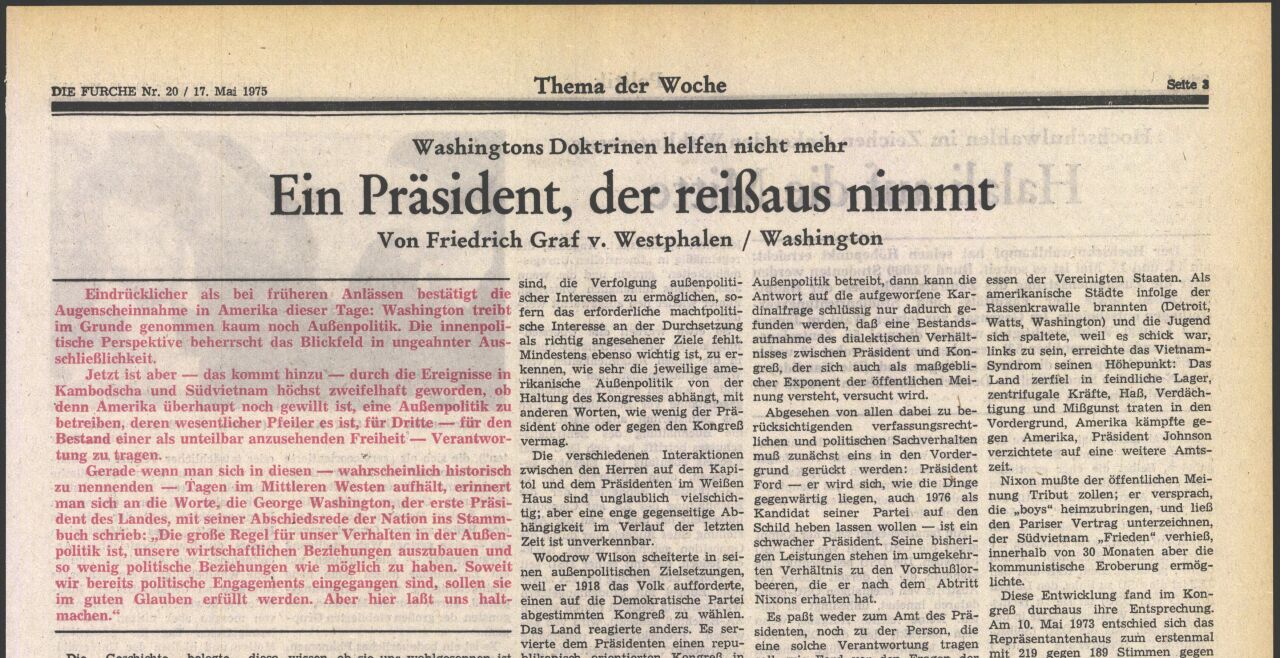
Ein Präsident, der reißaus nimmt
Eindrücklicher als bei früheren Anlässen bestätigt die Augenscheinnahme in Amerika dieser Tage: Washington treibt im Grunde genommen kaum noch Außenpolitik. Die innenpolitische Perspektive beherrscht das Blickfeld in ungeahnter Ausschließlichkeit. Jetzt ist aber — das kommt hinzu“— durch die Ereignisse in Kambodscha und Südvietnam höchst zweifelhaft geworden, ob denn Amerika überhaupt noch gewillt ist, eine Außenpolitik va betreiben, deren wesentlicher Pfeiler es ist, für Dritte— für den Bestand einer als unteilbar anzusehenden Freiheit — Verantwortung zu tragen. , Gerade wenn man sich in diesen —wahrscheinlich historisch zu nennenden — Tagen im Mittleren Westen aufhält, erinnert man sich an die Worte, die George Washington, der erste Präsident des Landes, mit seiner Abschiedsrede der Nation ins Stammbuch schrieb: „Die große Regel für unser Verhalten in der Außenpolitik ist, unsere wirtschaftlichen Beziehungen auszubauen und so wenig politische Beziehungen wie möglich zu haben. Soweit wir bereits politische Engagements eingegangen sind, sollen sie im guten Glauben erfüllt werden. Aber hier laßt uns haltmachen.“
Eindrücklicher als bei früheren Anlässen bestätigt die Augenscheinnahme in Amerika dieser Tage: Washington treibt im Grunde genommen kaum noch Außenpolitik. Die innenpolitische Perspektive beherrscht das Blickfeld in ungeahnter Ausschließlichkeit. Jetzt ist aber — das kommt hinzu“— durch die Ereignisse in Kambodscha und Südvietnam höchst zweifelhaft geworden, ob denn Amerika überhaupt noch gewillt ist, eine Außenpolitik va betreiben, deren wesentlicher Pfeiler es ist, für Dritte— für den Bestand einer als unteilbar anzusehenden Freiheit — Verantwortung zu tragen. , Gerade wenn man sich in diesen —wahrscheinlich historisch zu nennenden — Tagen im Mittleren Westen aufhält, erinnert man sich an die Worte, die George Washington, der erste Präsident des Landes, mit seiner Abschiedsrede der Nation ins Stammbuch schrieb: „Die große Regel für unser Verhalten in der Außenpolitik ist, unsere wirtschaftlichen Beziehungen auszubauen und so wenig politische Beziehungen wie möglich zu haben. Soweit wir bereits politische Engagements eingegangen sind, sollen sie im guten Glauben erfüllt werden. Aber hier laßt uns haltmachen.“
Die Geschichte belegte diese rhese: Erst am Ende des 19. Jahrhunderts griff die Nation über den eigenen Kontinent hinaus — im Krieg gegen Mexico sowie im spanischen Krieg um Kuba, Puerto Eico und die Philippinen. Nur widerwillig trat Washington in den Ersten Weltkrieg ein, leitete aber sogleich danach die isolationistische Epoche unter Präsident Coolidge ein. Und nur unter schweren Geburtswehen übernahm Amerika schließlich die Verantwortung, die ihm die Ereignisse von Pearl Harbour auferlegten.
Es ist bezeichnend, daß Washington während dieses Jahrhunderts immer wieder außenpolitische Doktrinen verwendete, um auswärtige Engagements zu rechtfertigen, während doch die machtpolitisch gebotene Verfolgung außenpolitischer Ziele — wie die Geschichte belegt — dessen gar nicht bedarf. Undenkbar, sich vorzustellen, Bismarck, Metternich oder Napoleon hätten sich an Doktrinen ausgerichtet, um ihre machtpolitischen Vorstellungen zu erklären und dem Bürger verständlich zu machen.
Zudem: die verschiedenen amerikanischen Doktrinen geben sich keineswegs nur politisch, sondern äußerst legalistisch oder moralistisch.
So versuchte die Wilson-Doktrin der 14 Punkte — fast ein Jahrhundert nach der Monroe-Doktrin —, eine auf dem Recht aufgebaute Völkergemeinschaft zu verwirklichen, aber sie scheiterte am Kongreß, der es ablehnte, den Beitritt des Landes zum Völkerbund zu ratifizieren.
Die Hoover-Stimson-Doktrin (1932) war darauf angelegt, Machtverschiebungen zu ignorieren, die infolge der Eroberung der Mandschurei durch die Japaner in Ostasien entstanden waren. Den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verhinderte die Doktrin nicht.
Roosevelt verkündete seine Politik der „vier Freiheiten“ — als Modell einer neuen Weltprdnung dokumentiert in der Charta der Vereinten Nationen —, das Klischee der amerikanischen Verfassung und Ausdruck des Glaubens an eine heile, vernünftige Welt, die es nicht gibt.
Fast aus nichtigem Anlaß entstand dann im Frühjahr 1947 anläßlich drohender Umstürze in Griechenland und in der Türkei die Truman-Dok-trin: ein universales Hilfe versprechen der amerikanischen Nation an andere Staaten — im Interesse der Freiheit. Außenminister John F. Dulles konstruierte daraus die Politik des „Containment“, der Eindämmung des kommunistischen Einflusses, wodurch Washington mit 42 Beistandsverpflichtungen in rechtlich bindender Weise „belastet“ wurde (Rio-Pakt, SEATO, NATO, ANZUS), eingerechnet die bilateralen Pakte mit Japan, Nationalchina, Korea und den Philippinen — nicht mitgezählt allerdings sonstige „Verpflichtungen“ Washingtons, wie zum Beispiel die des CENTO-Vertrages.
Ihre epochale Rechtfertigung und Erklärung fand die Truman-Doktrin — in verbaler Form — in der In-auguralansprache Präsident Kennedys im Januar 1961: „Jede Nation soll
wissen, ob sie uns wohlgesonnen ist oder uns übelwül, daß wir jeden Preis zahlen, jede Last tragen und uns jeder Anstrengung unterziehen, jeden Feind abzuwehren, um Überleben und Erfolg der Freiheit sicherzustellen.“
Nichts ohne oder gegen den Kongreß
Im Verlauf des Vietnam-Krieges ist von der Truman-Doktrin nichts
mehr übriggeblieben; 42 rechtlich fixierte Beistandsverpflichtungen der Nation, aus denen sich jeweils „zweite Vietnams“ ergeben könnten — das war zuviel für das Land, militärisch, politisch und vor allem psychologisch.
Die Konsequenz war außenpolitisch die Nixon-Doktrin, die Präsident Nixon am 28. Juli 1969 in Bangkok formulierte: „Unsere Entschlossenheit, die amerikanischen Engagements zu erfüllen, steht in voller Übereinstimmung mit unserer Überzeugung, daß die asiatischen Nationen in wachsendem Maß die Verantwortung für Frieden und Fortschritt in diesem Teil der Erde übernehmen können und müssen. Die Herausforderung an unsere Klugheit besteht darin, die Anstrengungen der asiatischen Nationen zu unterstützen, sich selbst zu verteidigen und weiterzuentwickeln, ohne daß wir der Versuchung unterliegen, deren eigene Verantwortung selbst zu übernehmen. Denn wenn Beherrschung durch einen Aggressor die Freiheit einer Nation zerstören kann, dann kann zu große Abhängigkeit von einem Beschützer eines Tages die Würde dieser Nation aushöhlen.“
Die Ereignisse der letzten Wochen haben auf tragische Weise bestätigt, wie sehr auch diese Doktrin in Südostasien versagt hat
Dies jedoch liegt nicht nur daran, daß Doktrinen eben nicht geeignet
sind, die Verfolgung außenpolitischer Interessen zu ermöglichen, sofern das erforderliche machtpolitische Interesse an der Durchsetzung als richtig angesehener Ziele fehlt. Mindestens ebenso wichtig ist, zu erkennen, wie sehr die jeweilige amerikanische Außenpolitik von der Haltung des Kongresses abhängt, mit anderen Worten, wie wenig der Präsident ohne oder gegen den Kongreß vermag.
Die verschiedenen Interaktionen zwischen den Herren auf dem Kapi-tol und dem Präsidenten im Weißen Haus sind unglaublich vielschichtig; aber eine enge gegenseitige Abhängigkeit im Verlauf der letzten Zeit ist unverkennbar.
Woodrow Wilson scheiterte in seinen außenpolitischen Zielsetzungen, weil er 1918 das Volk aufforderte, einen auf die Demokratische Partei abgestimmten Kongreß zu wählen. Das Land reagierte anders. Es servierte dem Präsidenten einen republikanisch orientierten Kongreß in beiden Kammern. Als Wilson dann — er liebte seine Ideen wie andere ihre Kinder — nach Versailles aufbrach, hatte er das Land nicht mehr hinter sich — und scheiterte, zumal am auswärtigen Senatsausschuß.
Dulles, der Außenminister Eisen-howers, vor ihm schon Marshall, der Verteidigungsminister Trumans, und Dean Acheson, der Außenminister
Trumans — sie alle konnten ihre auswärtige Politik des „Containment“ nur deswegen erfolgreich betreiben, weil Senator Vandenberg sie im auswärtigen Senatsausschuß voll unterstützte und weil das Land diese Führungsrolle anerkannte.
Es charakterisiert das Vietnam-Debakel an der „Heimatfront“, daß Präsident Johnson nach der „Golf-von-Tonking-Resolution“ (August 1964), die ihn zum Krieg in Vietnam ermächtigt hatte, im Auswärtigen Senatsausschuß unter Senator Ful-bright bald keine Gefolgschaft mehr fand. Bereits im Frühjahr 1966 begannen dort jene denkwürdigen Hearings über die Ziele der amerikanischen Außenpolitik, die die Vietnam-Opposition bestärkten.
Daß Präsident Ford in der letzten Zeit verzweifelt die Rhetorik der Johnson-Ära wieder aufgriff, Amerika müsse sich selbst und den Verbündeten beweisen, daß es in Treue zu seinen Verpflichtungen stehe —, läßt nur den Schluß zu, daß es immer noch nach wie vor völlig unklar ist, welche Ziele Washington im Rahmen seiner Außenpolitik tatsächlich im Konfliktfall verfolgen will. Wo liegen die Grenzen amerikanischer Engagements, wo der unverrückbare Punkt einer Intervention — außerhalb des eigenen Kontinents?
Wenn indes die These richtig ist, daß Amerika im Grunde gar keine an Machtinteressen orientierte
Außenpolitik betreibt, dann kann die Antwort auf die aufgeworfene Kardinalfrage schlüssig nur dadurch gefunden werden, daß eine Bestandsaufnahme des dialektischen Verhältnisses zwischen Präsident und Kongreß, der sich auch als maßgeblicher Exponent der öffentlichen Meinung versteht, versucht wird.
Abgesehen von allen dabei zu berücksichtigenden verfassungsrechtlichen und politischen Sachverhalten muß zunächst eins in den Vordergrund gerückt werden: Präsident Ford — er wird sich, wie die Efrnge gegenwärtig liegen, auch 1976 als Kandidat seiner Partei auf den Schild heben lassen wollen — ist ein schwacher Präsident. Seine bisherigen Leistungen stehen im umgekehrten Verhältnis zu den Vorschußlorbeeren, die er nach dem Abtritt Nixons erhalten hat.
Es paßt weder zum Amt des Präsidenten, noch zu der Person, die eine solche Verantwortung tragen soll, wie Ford vor den Fragen der Reporter, die sich nach seiner Einschätzung der Lage Vietnams erkundigen, im Laufschritt reißaus nimmt. Und nicht minder seltsam ist es, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten erklären läßt, die Nachrichten • aus Vietnam „machen mich krank“. Dies ist, wie der französische „Figaro“ kürzlich sarkastisch bemerkte, allenfalls die Haltung des
Bürgers Gerald Ford aus Grand Ra-pids in Michigan, nicht die des „Commander-in-Chief“.
Dies aber ist nach der Verfassung sein Rang. Indes, der Kongreß verlangt seinen Teil an der Macht — wesentlich mehr als früher, von Gesetzes wegen. Die Machtverteilung zwischen Präsident und Kongreß ist in der Verfassung keineswegs lupenrein verwirklicht Das Recht, völkerrechtliche Verträge rechtsverbindlich zu bestätigen, steht dem Senat zu; allgemein wirkt der Senat als zweite Kammer durch die Akzentuierung der öffentlichen Meinung bei der Zielbestimmung der Außenpolitik mit. Vor allem aber: der Kongreß hat das Recht der Kriegserklärung und die Budgetkompetenz.
Den Höhepunkt erreichte die Machtbefugnis der Exekutive sicherlich 1964, als Präsident Johnson durch die „Golf-von-Tonking-Reso-lution“ ermächtigt wurde, amerikanische Soldaten nach Vietnam zu entsenden, weil nordvietnamesische Patrouillenboote zwei amerikanische Schiffe angegriffen hatten.
Es dauerte jedoch nicht lange, bis die Opposition im Kongreß erwachte: Die Volksvertreter fühlten sich übergangen; Senator Fulbright redete von der „Arroganz der Macht“ und von politischer „Überanstrengung“ des Landes. Es hieß, Vietnam sei nicht „vital“ für die auswärtigen Inter-
essen der Vereinigten Staaten. Als amerikanische Städte infolge der Rassenkrawalle brannten (Detroit, Watts, Washington) und die Jugend sich spaltete, weil es schick war, links zu sein, erreichte das Vietnam-Syndrom seinen Höhepunkt: Das Land zerfiel in feindliche Lager, zentrifugale Kräfte, Haß, Verdächtigung und Mißgunst traten in den Vordergrund, Amerika kämpfte gegen Amerika, Präsident Johnson verzichtete auf eine weitere Amtszeit.
Nixon mußte der öffentlichen Meinung Tribut zollen; er versprach, die „boys“ heimzubringen, und ließ den Pariser Vertrag unterzeichnen, der Südvietnam „Frieden“ verhieß, innerhalb von 30 Monaten aber die kommunistische Eroberung ermöglichte.
Diese Entwicklung fand im Kongreß durchaus ihre Entsprechung. Am 10. Mai 1973 entschied sich das Repräsentantenhaus zum erstenmal mit 219 gegen 189 Stimmen gegen die Bombardierung Kambodschas — das erste, unübersehbare Warnsignal des Hauses gegen den Krieg in Südostasien.
Es entbehrt in diesem Zusammenhang sicherlich nicht der Ironie: Als das Repräsentantenhaus am 29./30. Juni 1973 beschloß, Präsident Nixon müsse bis zum 15. August die Bombardierungen in Kambodscha einstellen, spielte Gerald Ford, der damalige Führer der Republikaner im Haus, eine maßgebliche Rolle unter denen, die dies zu erreichen suchten. Er setzte die Verfügung durch, daß in ganz Südostasien amerikanische Truppen nicht mehr eingesetzt werden dürften. Das war eine Maßnahme, an die er jetzt als Präsident im Zusammenhang mit dem Vietnam-Desaster erinnert wurde.
Es könnte schicksalshafte Bedeutung erlangen, daß im Augenblick im Kongreß keine überragende Persönlichkeit zu finden ist, die durch ihren Einfluß auf die Außenpolitik die Glaubwürdigkeit der ersten Macht der freien Welt wiederherstellen kann. Sparkman, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, erreicht nur mit Mühe das Mittelmaß. Globalstrategische Perspektiven fehlen, sofern man von Kissinger absieht. Er aber kann weder Wunder vollbringen, noch kann er mehr tun, als ihm der Spielraum im Konflikt zwischen dem Weißen Haus und dem Kapitol noch erlaubt. Dies gilt es im Auge zu behalten: die amerikanische Außenpolitik ist eben nicht eine „One-man-show“.
Wenn man schlußfolgernd Vietnam und Watergate betrachtet, scheint sich das eigentliche amerikanische Interesse an der Außenpolitik hauptsächlich auf wirtschaftliche Sachverhalte zu richten, beeinflußt von dem Engagement amerikanischer Gesellschaften im Ausland. Allerdings hat das Militär noch eigene Denk- und Wirkungsansätze zu verzeichnen.
Im Vordergrund stehen die internen Probleme des Landes; sie verzehren nahezu die gesamte Energie, Phantasie und Willenskraft, deren Amerika zur Zeit fähig ist — und das ist nicht gerade viel. Für die Außenpolitik bleibt daneben wenig eigenständiger Raum, in dem eine neue Orts- und Zielbestimmung vorgenommen werden könnte. Formulierung und Durchsetzung der Ziele der amerikanischen Außenpolitik erfolgen zur Zeit auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner divergierender Interessen des Präsidenten, des Kongresses und der öffentlichen Meinung.
Die Resultante verdient indessen kaum den Namen Außenpolitik, zumal sich dem Beobachter der Eindruck aufzwingt: Die Eroberung Südvietnams und Kambodschas durch Kommunisten wird von vielen Amerikanern nicht als politische Niederlage Amerikas gewertet; man redet sich vielmehr ein, sie sei von „korrupten Regimes“ verschuldet worden. Die Kette der tragischen Ereignisse wirkt nur noch als eine Initiative für humanitäre Hilfe.




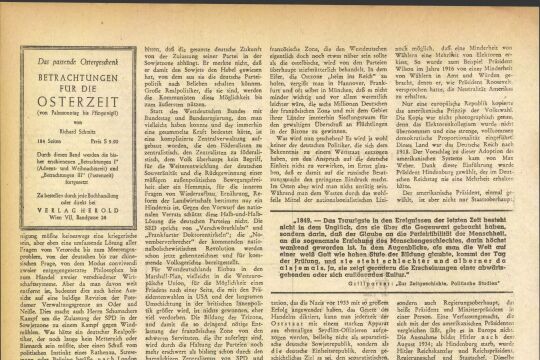




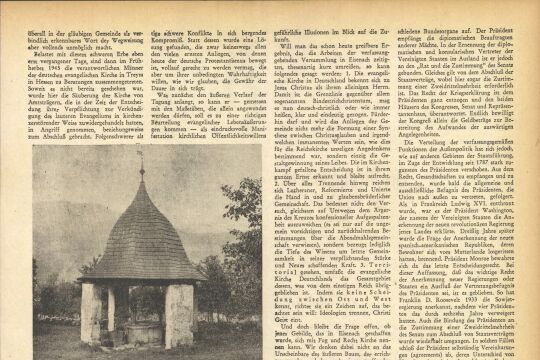






















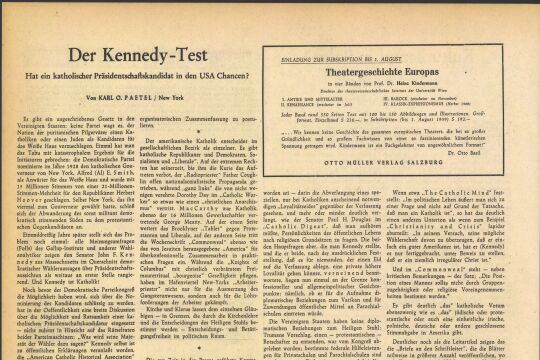









































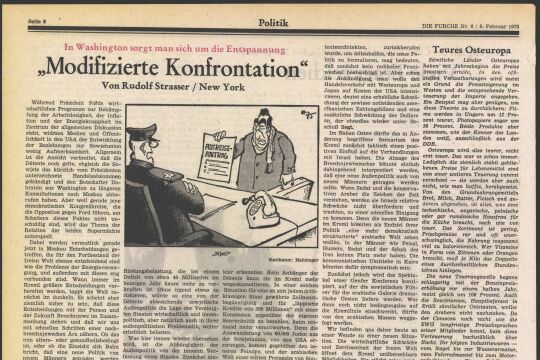


















833.jpg)




