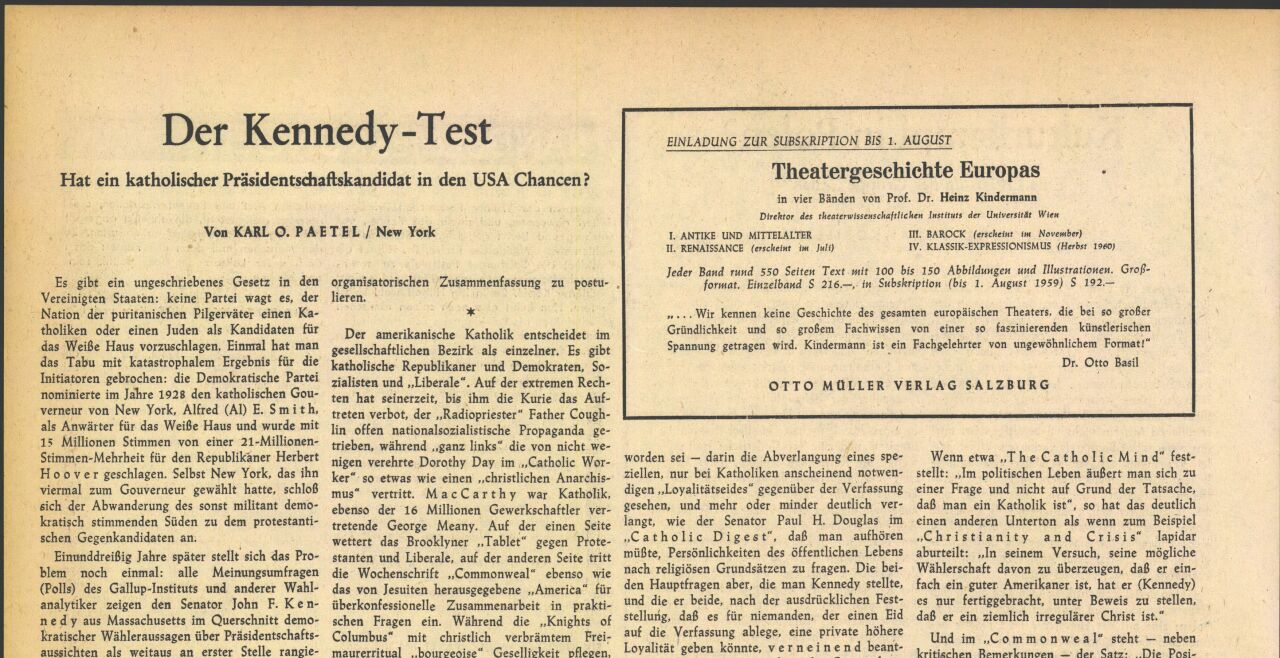
Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz in den Vereinigten Staaten: keine Partei wagt es, der Nation der puritanischen Pilgerväter einen Katholiken oder einen Juden als Kandidaten für das Weiße Haus vorzuschlagen. Einmal hat man das Tabu mit katastrophalem Ergebnis für die Initiatoren gebrochen: die Demokratische Partei nominierte im Jahre 1928 den katholischen Gouverneur von New York, Alfred (Al) E. Smith, als Anwärter für das Weiße Haus und wurde mit 15 Millionen Stimmen von einer 21-Millionen- Stimmen-Mehrheit für den Republikaner Herbert Hoover geschlagen. Selbst New York, das ihn viermal zum Gouverneur gewählt hatte, schloß sich der Abwanderung des sonst militant demokratisch stimmenden Süden zu dem protestantischen Gegenkandidaten an.
Einunddreißig Jahre später stellt sich das Problem noch einmal: alle Meinungsumfragen (Polls) des Gallup-Instituts und anderer Wahlanalytiker zeigen den Senator John F. Kennedy aus Massachusetts im Querschnitt demokratischer Wähleraussagen über Präsidentschaftsaussichten als weitaus an erster Stelle rangierend. Und Kennedy ist Katholik!
Noch bevor der Demokratische Parteikongreß die Möglichkeit haben wird, sich über die Nominierung des Kandidaten schlüssig zu werden, hat in der Oeffentlichkeit eine breite Diskussion über die Möglichkeit und Ratsamkeit einer katholischen Präsidentschaftskandidatur eingesetzt
— nicht zuletzt in Hinsicht auf das Rätselraten beider Parteimaschinen: „Was wird seine Majestät der Wähler dazu sagen?“ Kennedy selbst ist zu öffentlichen Erklärungen veranlaßt worden, die „American Catholic Historical Association“ hat eine Konferenz über die Frage einberufen, demokratische und republikanische Politiker und protestantische Gruppen beginnen sich dazu zu äußern.
Es ist offensichtlich, daß die Dinge sich seit 1928 geändert haben. Die zirka 36 Millionen Katholiken, die" Cs, heute über das ganze Land zerstreut, gibt, haben rückhaltlos die in der Konstitution festgelegte Trennung von Kirche und Staat akzeptiert, stellen im Kongreß 103 Abgeordnete und werden im Grunde nur noch vom
— verbotenen — Ku-Klux-Klan, der sie zusammen mit Negern und Juden bekämpft, und Restbeständen besonders doktrinärer „fundamentalistischer“ Sekten im Protestantismus, die an „papistischen“ Neurosen leiden, als „gefährlich“ angesehen.
Während 1940 noch 31 Prozent von Wählern, die gefragt wurden, ob sie einen Katholiken wählen würden, das verneinten, ist die Zahl heute auf 24 Prozent gesunken, und letztlich haben selbst baptistische Synoden ihnen vorgelegte militant-antikatholische Resolutionen verharmlost.
Daß das alte Ressentiment der — in viele Einzelkirchen aufgespaltenen — protestantischen Mehrheit sich merkbar abgeschliffen hat. hat unter anderem zwei Gründe. Es hängt erstens damit zusammen, daß sich die soziale Situation des katholischen Bevölkerungsteiles im Rahmen der Gesamtnation während der letzten Jahrzehnte weitgehend verändert hat. Aus der ersten katholischen Ansiedlerminorität, die den Grundstock des heutigen Staates Maryland legte, entwickelten sich kompakte katholische Zentren in einer Reihe von Staaten im Mittelwesten und an der Ostküste, insbesondere da, wo sich vor allem die Italiener, Polen, Spanier, Französisch-Kanadier, Iren, Mexikaner, Puertorikaner usw. niederließen. In der ersten Zeit fast ausschließlich ärmeren, ungebildeteren Schichten angehörig, vom „reinen“ angelsächsischen Element oft als „fremd“ empfunden und über die Schulter angesehen, haben diese Gruppen inzwischen gewissen Wohlstand und Bildung erworben und sich Schritt für Schritt aus der zeitweise vorhandenen Außenseiterposition befreit.
Dazu aber kommt etwas anderes. In den Vereinigten Staaten hat es nie das gegeben, was man den „politischen Katholizismus“ genannt hat. Dieser Verzicht auf „christliche Politik" hat verhindert, daß man im innerpolitischen Raum den Katholizismus und damit „die" Katholiken als Gruppe mit einem speziellen Machtstreben in Verbindung bringen konnte. Man hat bewußt davon abgesehen, „katholische Politik" zu formulieren, das heißt, die religiöse Gemeinsamkeit eines Bevölkerungsteils als Grundlage gemeinsamen politischen Handelns in irgendeiner organisatorischen Zusammenfassung zu postu- . lieren.
Der amerikanische Katholik entscheidet im gesellschaftlichen Bezirk als einzelner. Es gibt katholische Republikaner und Demokraten, Sozialisten und „Liberale“. Auf der extremen Rechten hat seinerzeit, bis ihm die Kurie das Auftreten verbot, der „Radiopriester“ Father Coughlin offen nationalsozialistische Propaganda getrieben, während „ganz links“ die von nicht wenigen verehrte Dorothy Day im „Catholic Worker“ so etwas wie einen „christlichen Anarchismus“ vertritt. MacCarthy war Katholik, ebenso der 16 Millionen Gewerkschaftler vertretende George Meany. Auf der einen Seite wettert das Brooklyner „Tablet“ gegen Protestanten und Liberale, auf der anderen Seite tritt die Wochenschrift „Commonweal“ ebenso wie das von Jesuiten herausgegebene „America“ für überkonfessionelle Zusammenarbeit in praktischen Fragen ein. Während die „Knights of Columbus“ mit christlich verbrämtem Freimaurerritual „bourgeoise“ Geselligkeit pflegen, haben im Hafenviertel New-Yorks „Arbeiterpriester“ nicht nur für die Ausmerzung des Gangsterunwesens, sondern auch für die Lohnforderungen der Arbeiter gekämpft.
Kirche und Klerus lassen dem einzelnen Gläubigen — in Grenzen, die durch die Kirchenlehre und die Entscheidungen des Heiligen Stuhls bestimmt werden — Entscheidungs- und Betätigungsfreiheit im politischen Raum.
Die zur Zeit in der Presse geführte Kontroverse hat sich im wesentlichen an einem Artikel Kennedys in der Bildzeitschrift „Look“ entzündet, und zwar zuerst einmal in Zusammenhang mit der Frage, ob der Senator recht daran getan habe, der Aufforderung zu folgen, sich dort „als Katholik“ über seinen religiösen Standpunkt und daraus sich ergebende politische Folgerungen zu äußern. Die katholischen Blätter haben fast ausnahmslos — unter Hinweis darauf, daß noch nie ein anderer Kandidat auf seine konfessionelle Ueberzeugung öffentlich „geprüft“
worden sei — darin die Abverlangung eines speziellen, nur bei Katholiken anscheinend notwendigen „Loyalitätseides“ gegenüber der Verfassung gesehen, und mehr oder minder deutlich verlangt, wie der Senator Paul H. Douglas im „Catholic Digest“, daß man aufhören müßte, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens nach religiösen Grundsätzen zu fragen. Die beiden Hauptfragen aber, die man Kennedy stellte, und die er beide, nach der ausdrücklichen Feststellung, daß es für niemanden, der einen Eid auf die Verfassung ablege, eine private höhere Loyalität geben könnte, verneinend beantwortete, liegen nun einmal an der Grenze konfessioneller und allgemeinpolitischer Gesichtspunkte: nämlich, ob er für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zum Vatikan und für Zuwendungen öffentlicher Mittel an Parochial- schulen eintreten würde.
Die Vereinigten Staaten haben keine diplomatischen Beziehungen zum Heiligen Stuhl: Trumans Vorschlag, einen — protestantischen — Botschafter zu entsenden, war vom Kongreß abgelehnt worden; bestimmte federale Hilfeleistungen für Privatschulen und Parochialschulen sind seit langem ein Diskussionsgegenstand bei Katholiken und Nichtkatholiken, wobei auch bei kirchlichen Würdenträgern, die teilweise eine damit verbundene Einflußnahme des Staates auf die Erziehung in diesen Schulen fürchten, keine Einmütigkeit besteht.
Auch wenn die katholischen Zeitschriften alle über die F o r m des „L o o k“-Artikels nicht glücklich siiid, differieren zwischen den Zeilen ihre Stellungnahmen doch beträchtlich.
Wenn etwa „The Catholic Mind"feststellt: „Im politischen Leben äußert man sich zu einer Frage und nicht auf Grund der Tatsache, daß man ein Katholik ist“, so hat das deutlich einen anderen Unterton als wenn zum Beispiel „Christianity and Crisis“ lapidar aburteilt: „In seinem Versuch, seine mögliche Wählerschaft davon zu überzeugen, daß er einfach ein guter Amerikaner ist, hat er (Kennedy) es nur fertiggebracht, unter Beweis zu stellen, daß er ein ziemlich irregulärer Christ ist.“
Und im „Commonweal“ steht — neben kritischen Bemerkungen — der Satz: „Die Position eines Mannes sollte nicht durch Gruppenzugehörigkeit oder religiöse Voreingenommenheiten bestimmt werden.“
Es gibt deutlich „das" katholische Votum ebensowenig wie es „das" jüdische oder protestantische oder auch eine einheitliche irische, polnische, deutsche oder andere geschlossene Stimmabgabe in Amerika gibt.
Deutlicher noch als die Leitartikel zeigen das die „Briefe an den Schriftleiter“, die die Blätter teilweise in größerer Anzahl veröffentlichen, wo sich Zustimmung und Ablehnung von Kennedys Standpunkt ungefähr die Waage halten.
„America“ zum Beispiel enthält eine Zuschrift, die die Grenze der Kritik abzustecken versucht: „Als römischer Katholik anerkenne ich das wahre Recht und die Pflicht der Kirche, in die menschlichen Angelegenheiten einzugreifen, wenn die Moral bedroht oder der Glaube angegriffen wird, aber ich stehe äuf dem Standpunkt, daß wir Katholiken in Amerika un's besser der Tatsache bewußt werden, daß wir in einer pluralistischen Gesellschaft leben … Als amerikanischer Bürger gab Senator Kennedy die einzig mögliche Antwort.“ — Irgendwie hat man den Eindruck, daß die ganze Diskussion falsch angesetzt worden ist. Vom Standpunkt der Demokratischen Wahlstrategie und der Nominationstaktik der Partei aus gesehen ist es durchaus möglich, daß sich die eine unerwartete Breite annehmende Diskussion des „L o o k“-Artikels und einer ihm folgenden Fernsehsendung Kennedys als Bumerang erweist.
Nicht nur, daß es keineswegs sicher ist, ob der hohe, ihn bejahende Prozentsatz der achtzig Prozent Wählerstimmen repräsentierenden Nichtkatholiken sich halten wird, nachdem das diesem abgezwungene „Bekenntnis“ Kennedys zum Katholizismus vermutlich einen Großteil der Befragten erst auf die konfessionelle Seite der Entscheidung aufmerksam gemacht hat — es kommt dazu, daß er auf der anderen Seite manchen Katholiken wegen seiner Stellungnahme als „unzuverlässig“ erscheinen mag. In beiden Fällen können sich, falls die demokratische „C o n- v e n t i o n“ John F. Kennedy als Präsidentschaftskandidaten nominiert, wesentliche Abstriche an der für die Wahl vorausgesagten Stimmabgabe ergeben. Scheut aber die Partei als Folge der Kontroverse von der Nominierung zurück, kann auch das schädlich sein, indem es als ..antikatholische“ Demonstration ausgelegt werden kann.
Bis zur Nominierung bzw. bis zum Wahlkampf wird noch Zeit genug vergehen, um übersehen zu können, welche Chancen dafür bestehen, daß sich ein Katholik mit Aussicht auf Erfolg heute um das höchste Amt der Nation bemühen kann. Wie es derzeit aussieht, herrscht bei den meisten Nichtkatholiken die Auffassung vor, daß man eine Persönlichkeit, vielleicht auch ihr „Programm“, aber kaum ihr persönliches Verhältnis zur Religion bejahen muß, um sich für einen Kandidaten zu entscheiden; manche Katholiken aber stellen sich auf den Standpunkt des „Wenn schon, denn schon’“, das heißt, sie würden, falls ein Katholik ins Weiße Haus einziehen würde, einen „nicht säkularisierten" vorziehen. Daraus ergibt sich, daß die Ja- und Nein-Stimmen zur etwaigen Kennedy-Kandidatur jedenfalls kaum parallel den Konfessionsgrenzen verlaufen dürften.






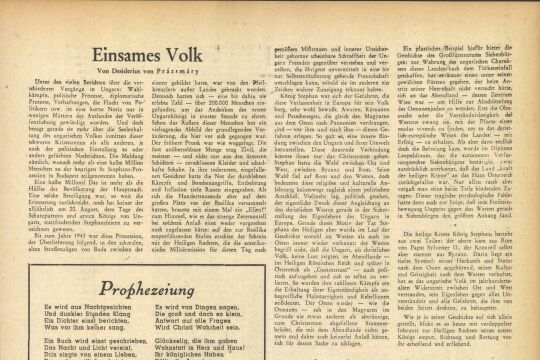




























































.jpg)































