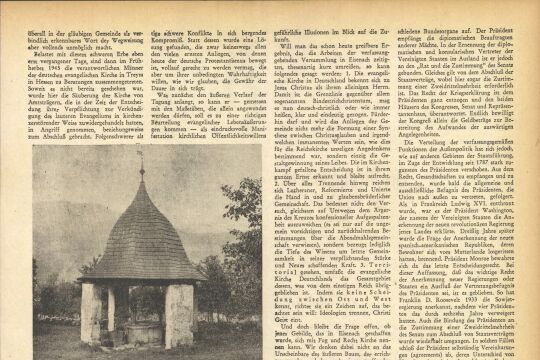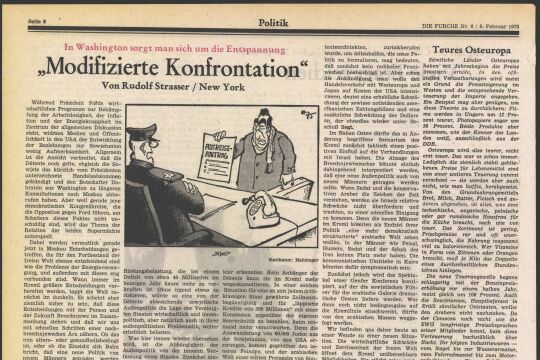Sind die Vereinigten Staaten ein Imperium? Titel
Die gemeinsamen ethischen Werte und die Bindung ans Gemeinwohl verblassen, doch die Weltunordnung verdammt die USA zur Weltmachtrolle. sdfsdf
Die gemeinsamen ethischen Werte und die Bindung ans Gemeinwohl verblassen, doch die Weltunordnung verdammt die USA zur Weltmachtrolle. sdfsdf
Die Einschätzungen Amerikas durch Europäer überraschen immer wieder durch ihre irrationale Komponente. Wenige haben Alexis de Tocqueville gelesen, der vor über 150 Jahren schrieb, was heute noch für die Vereinigten Staaten gilt. Christian Hacke beschränkt sich in "Zur Weltmacht verdammt" strikt auf die Außenpolitik, doch seine Analyse hilft, die tiefere Logik der amerikanischen Gesellschaft zu verstehen.
Nach Hacke setzten sich bei der Gründung der USA zwei meist gegensätzliche Tendenzen durch: "Die Gründungsväter waren geschichtsbewußt, kannten die Antike, die Stärken und Schwächen der griechischen und römischen Politik - realistisch und frei von einseitiger Idealisierung". Thomas Jefferson war zwar für die lokale Ausweitung der USA auf etwa den jetzigen Stand, jedoch: "Freier Handel mit allen Nationen, aber politische Händel mit niemandem - so könnte man Jeffersons außenpolitische Maxime umschreiben."
Dem amerikanischen Selbstverständnis entsprach Jeffersons Überzeugung, "daß der Friede von der Existenz und Weiterverbreitung der Demokratie abhänge, weil Demokratien keinen Krieg gegeneinander führten". Auch Machiavelli und Thomas Hobbes trugen zum Politikverständnis bei. "Alexander Hamilton, einer der Gründungsväter, verkörperte diese realistische Tradition. Für ihn waren Krieg und Macht unabänderliche Tatsachen des politischen Lebens.
Ende der Miniarmee Präsident Jefferson übernahm Washingtons Gebot, die Handelsbeziehungen zu erweitern und so wenige politische Bande zu knüpfen wie möglich. Dies wurde prägend für den Isolationismus der Amerikaner, die sich gleichzeitig stets als demokratische Weltreformer sahen. Dies führte immer wieder "zu Präsidenten wie Woodrow Wilson und Jimmy Carter."
Hamiltons Einfluß setzte sich erst zu Beginn dieses Jahrhunderts mit Theodore Roosevelt voll durch. Blieb bis dahin die Armee kleiner als die von Bulgarien, setzte er eine massive Aufrüstung durch, um im Konzert der Imperialisten mitzuspielen. Es ging vor 100 Jahren um die Aufteilung der Welt unter die Großmächte. Ähnliche Tendenzen gab es auch bei früheren Präsidenten, doch hatte der Kongreß stets einen Riegel vorgeschoben.
Theodore Roosevelt änderte das Kräfteverhältnis zwischen Präsident und Kongreß. "Mit dem Aufstieg des weltpolitischen Engagements der USA ist auch unweigerlich der Machtzuwachs des Präsidenten einhergegangen." Als Antwort auf die Entwicklung zur "imperialen Präsidentschaft" verstärkte der Kongreß seit Mitte der siebziger Jahre seine Kontrollfunktionen und seine außenpolitischen Mitbestimmungsrechte. Diese Reformen führten aber auch zu "einem Verlust an Macht, Berechenbarkeit und Kontrolle, weil die einzelnen Kongreßmitglieder zunehmend unabhängiger wurden".
Neue Eliten reden mit Nach dem Ende des kalten Krieges komme dazu noch eine Diversifizierung der öffentlichen Meinung: "Immer mehr Amerikaner afrikanischer, asiatischer oder lateinamerikanischer Abstammung steigen in die Zirkel der politischen Eliten auf, auch in der Außenpolitik." Wichtig sei dabei auch "der Einfluß der gesellschaftlichen und politischen Interessengruppen auf die Außenpolitik". Gewerkschaften, Kirchen, die China- und die Israellobbys, aber auch auf "der anderen Seite die Bürgerrechts- und Antikriegsbewegungen, die mit ihrer pazifistisch-liberalen Ausrichtung an Traditionen amerikanischer Außenpolitik vor der Zeit des kalten Krieges anknüpfen". Die Linke hat gerade im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg zur Entwicklung eines selbstkritischen und toleranten Verständnisses der Außenpolitik beigetragen. All diese Faktoren wirkten sich auf das Handeln der Präsidenten aus.
John F. Kennedy präsentierte die USA als zupackende, aber auch entspannungsbereite Großmacht. Lyndon B. Johnson personifizierte Verbitterung und außenpolitische Ohnmacht. Richard M. Nixon wies den Weg aus der außenpolitischen Krise, versäumte es aber, sein Land in demokratischer Tradition zu regieren. Letzten Endes bestand seine historische Leistung "darin, daß er in einer Phase der Schwäche die Außenpolitik ... vom ideologischen Ballast der Vergangenheit befreite".
Gerald R. Ford bemühte sich, außenpolitische Schocks und innenpolitische Verwirrung zu klären. James E. Carter bewies gute Absichten, aber Unvermögen, die außenpolitischen Krisen zu meistern. Er hatte mit seiner Menschenrechtspolitik wenig Erfolg, einzig beim Nahostproblem gelang ihm in Camp David ein Durchbruch. Doch war er der einzige, der damals "die weltpolitische Entwicklung kühn bis ins 21. Jahrhundert hinein einer kritischen Analyse unterzog". Der 1.500-Seiten-Report "Global 2000" förderte das Umweltbewußtsein in vielen Ländern.
Ronald W. Reagan personifizierte amerikanischen Optimismus. Unter ihm schwang das Pendel wieder zum anderen Extrem. Statt auf Entspannung setzte er mit dem "Krieg der Sterne" wieder auf totale Konfrontation. Das Projekt trieb die Staatsverschuldung auf 2.800 Milliarden Dollar hinauf. Allerdings holte er sich einen guten Teil zurück, was Hacke nicht erwähnt: Mit dem "Plaza-Accord" von 1984 wurde der Dollar um über 40 Prozent abgewertet. Ein Europäer, der 1.000 Schilling in US-Werte investiert hatte, hielt nur noch 600 Schilling in der Hand. US-Konzerne konnten ihre Schulden weltweit mit Dollars von stark verminderter Kaufkraft zurückzahlen. Bei der Abwertung der asiatischen Währungen handelten die Spekulanten genau entgegengesetzt. Die Sowjets trieb Reagan jedenfalls mit seiner Rüstungspolitik in den Ruin. Das, so Hacke, bleibe sein historischer Beitrag.
George H. Bush handelte beim Niedergang des Sowjetimperiums mit Vorsicht (doch zupackend bei der deutschen Vereinigung). Er schwankte zwischen Interventionismus und Nachgeben, wodurch er auf beiden Ebenen verlor.
William J. Clinton verkörpert den Paradigmenwandel zur Ökonomisierung der Außenpolitik, um für Amerikas Weltmachtrolle die Brücke ins 21. Jahrhundert zu schlagen. Mit dem Vollblutpolitiker "fand ein Generationswechsel statt". Kind armer Eltern, hatte er sich hochgearbeitet und nichts vergessen. "Für die Außenpolitik wünschte Clinton neue Vorstellungen von liberalem Internationalismus im Unterschied zu den klassisch hegemonialen Vorstellungen früherer Administrationen. Clinton wollte keineswegs die Führungsrolle der USA aufgeben, aber seine revolutionäre Forderung zielte auf außenwirtschaftliche Notwendigkeiten und multilaterale Vorgehensweisen."
Clinton hatte kaum neun Monate Zeit für die wirtschaftlichen Probleme, dann mußte er sich der dramatisch gewordenen Situation in Somalia widmen. Kaum war dort der Abzug in die Wege geleitet, wurde die Lage in Haiti kritisch. Haiti wurde Clintons erster großer außenpolitischer Erfolg. In Bosnien durchbrach er die stillschweigende Aufgabe des Landes durch die Europäer mit militärischem Eingreifen, was zum Dayton-Abkommen führte. Doch es fehlte immer noch ein "angemessenes außenpolitisches Konzept", der militärischen Macht war "der Sinn abhanden gekommen".
Lernfähiger Clinton Viele Probleme sind ungelöst, doch hat "Clinton einen bemerkenswerten außenpolitischen Reife- und Lernprozeß durchgemacht. Sein wacher Sinn für Wandlungsprozesse unterscheidet ihn von außenpolitisch lernunfähigen Präsidenten wie Johnson oder Carter oder Bush." Er "wurde außenpolitisch erfolgreich, weil er die Führung der USA wirtschaftspolitisch und ohne große militärische Einsatzmittel wieder herstellte".
Es sei "die Kraft der Erneuerung und der Wille, das Ruder herumzureißen, was Amerika und Amerikaner auch in der Außenpolitik stark gemacht und die Weltmachtrolle moralisch und realistisch begründet hat". Doch "während die Weltunordnung die USA zur Weltmacht verdammt, droht im Innern die Spaltung zwischen Arm und Reich und der Abstieg der Mittelklasse. Rassenspannungen, die Feudalisierung der Reichen könnte zu Konflikten führen und die Gesellschaft erschüttern, wenn das Land keine anderen Entwicklungsmöglichkeiten mehr bereithält." Denn das Leitbild, das, so Hacke, den Bürger an gemeinsame ethische Werte und Gemeinwohl gebunden hat, verblasse.
ZUR WELTMACHT VERDAMMT Die amerikanische Außenpolitik von Kennedy bis Clinton Von Christian Hacke, Propyläen Verlag, Berlin 1997, 688 Seiten, geb., öS 423,-
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!