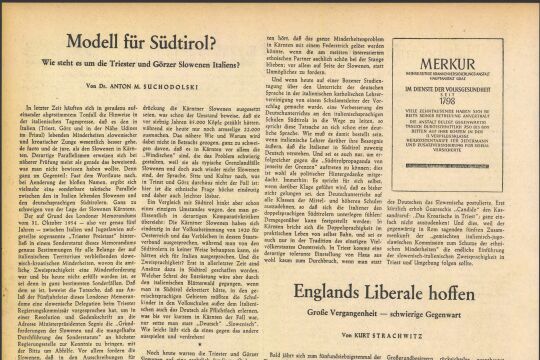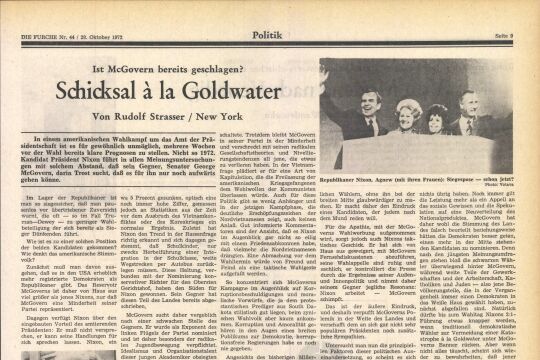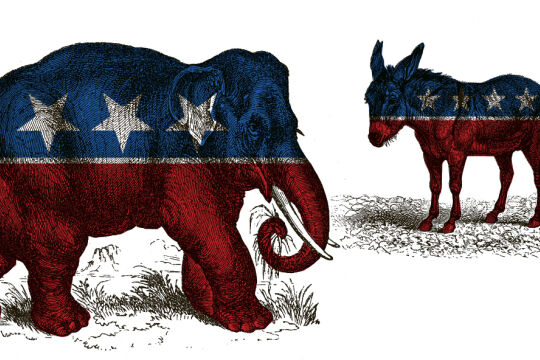Die große Wahl des kleinen Wünschers
Im Herbst wählen die USA ihren Präsidenten. Dabei geht es weniger um ein Programm als um eine Emotion, die die Wähler mit Kandidaten verbinden. Eine alternative Sichtweise zu Wendezeiten und ihrer Dämmerung.
Im Herbst wählen die USA ihren Präsidenten. Dabei geht es weniger um ein Programm als um eine Emotion, die die Wähler mit Kandidaten verbinden. Eine alternative Sichtweise zu Wendezeiten und ihrer Dämmerung.
Wer nach großen Weltentwürfen sucht, landet je nach Intensität der Suche früher oder später bei der ersten und besten dieser Phantasien. Thomas Morus hat sie 1516 zu Buch gebracht und sie Utopia genannt. Sie wurde aus Empörung gegen die damals grassierende Schafhaltung der Wollindustrie in England geschrieben, die eine breit angelegte Landvertreibung der Bauern und die Entstehung eines Armenheeres zur Folge hatte. Utopia, der Gegenentwurf zum Schafmagnatenstaat, hat viel von Platons idealem Staat aufgesaugt und dazu noch die absolute Gleichheit der Bürger, florierende Kooperativen, Geldverachtung und eine sanitäre Revolution: Nachttöpfe aus Gold. Morus hat (neben seiner Hinrichtung durch Heinrich VIII.) wohl auch dieser Vision von absoluter politischer Gerechtigkeit zu verdanken, dass er im Jahr 2000 zum Schutzpatron der Staatsmänner ernannt wurde.
Heuer, 20 Jahre nach diesem Akt, könnten die Politiker und auch die Wähler der USA ein wenig von der visionären Kraft des Thomas Morus gut gebrauchen. Denn im November soll ein neuer Präsident gewählt werden. Und es geht mehr denn je um die Wahl zwischen Weltentwürfen – und damit um eine Zeitenwende: Die Möglichkeit einer Administration Trump II oder etwas, das ganz anders sein wird: Elisabeth Warren vielleicht oder aber Joe Biden oder ein Außenseiter bei den Demokraten. Beides, die Entscheidung über Trump und die Hilfe, soll im Mittelpunkt dieser kleinen Abhandlung stehen. Geklärt werden soll, was die USWähler, aber auch die Politiker benötigen, um gut zu entscheiden. Hat das viel mit Utopien zu tun? Sicher, wenn man sich darauf einigen kann, dass politische Träume nicht derart unmodern geworden sind, dass Visionäre schon zum Arzt geschickt werden müssen, wie das noch vor 30 Jahren behauptet wurde.
Herz vor Verstand
Tatsächlich sind Visionen derzeit in der Weltpolitik nicht im Überfluss vorhanden, es scheint eher ein Mangel an ihnen zu bestehen. Die beispielsweise immer wieder an der EU kritisierte „Herzlosigkeit“ der Bürokratie ist ja eigentlich genau das: Das Fehlen von Visionen, denen sich eine breite Mehrheit „von Herzen“, also mit einem guten Gefühl in der Magengrube, anschließen könnte (beginnend bei Handelsabkommen und bis zur EUErweiterung reichend). Und wenn man es wieder auf die USA zurückwendet, zeigt sich, dass in den vergangenen Jahrzehnten nicht einzelne konkrete politische Forderungen oder gar Maßnahmen entscheidende politische Wenden gebracht haben. Es waren vielmehr einzelne Träume – und Alpträume.
Eines der herausragenden Beispiele dafür passierte vor etwas mehr als zehn Jahren im USVorwahlkampf der Demokraten. Bis 2008 hatten sich die USA nicht von den Terroranschlägen des elften September 2001 erholt. Es waren die Jahre der Präsidentschaft des Republikaners George W. Bush und sie endeten mit einem Land im Krieg gegen den Terror und einer heraufdämmernden Finanzkrise.
Und dann das: Winter 2007/08. Es ist schön, diese Rede des demokratischen Vorwahlkämpfers Barack Obama heute nochmals zu hören, die er damals in Vermont gehalten hat. Denn wenn man sie heute sieht, wie er da steht, umgeben von Menschen aller Berufs und Altersgruppen, aller Hautfarben, aller Klassen und Schichten – wie er von der Kraft spricht, die der Mensch hat, seine Probleme selbst zu lösen. Plötzlich wird die Hoffnung von damals wieder spürbar, dass alles wieder gut werden könne. Diese Paarung – Obama und Hoffnung – waren nicht schlagbar für die Republikaner, nicht einmal 2012, als sich die meisten der in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllt hatten. Solche ObamaMomente gab es in der USGeschichte des Öfteren – und auch die Republikaner hatten ihren Teil an den Hoffnungsträgern, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Etwa 1980/81, als der Wunsch nach Änderung nach einem so wahrgenommenen Totaleinbruch des USamerikanischen Einflusses im Nahen Osten durch die misslungene Geiselbefreiung im Iran 1980 übergroß wurde.
Der regierende Präsident Jimmy Carter unterlag nach nur einer Amtszeit einem Mann, der als Westernheld den starken Mann markierte und Gouverneur von Kalifornien geworden war: Ronald Reagan. Die Entscheidung im Wahlkampf 1980 war jene zwischen gefühlter Schwäche und Entscheidungsfreude und Führungsanspruch. Sie fiel erdrutschartig aus. Reagan schaffte es mit seiner entschiedenen Art herrschaftlicher Außenpolitik, den Nimbus des Kraftvollen bis in seine zweite Präsidentschaftsperiode zu halten. Nicht einmal die IranContra Affäre konnte ihm etwas anhaben. Aber an Reagans Fall zeigt sich noch etwas wenig Beachtetes: Dass die wirklich revolutionären Veränderungen, die mit einem Kandidaten kommen, von den Wählern oft gar nicht bemerkt werden.
Die neoliberale Wende, die Reagan im Wahlkampf versprochen hatte, hatte kaum Einfluss auf seinen Sieg. Sein Programm, durch Steuersenkungen mehr Staatseinnahmen zu lukrieren und damit die Vermögenden massiv zu entlasten, diese „Reagonomics“ waren in Umfragen vor der Wahl 1980 mehrheitlich abgelehnt worden. Und das trotz einer hohen Inflation während der CarterAdministration. Weitere Befragungen ergaben, dass das Hauptwahlmotiv war, Carter einfach loszuwerden.
Ganz ähnlich war es übrigens ein Jahr davor in Großbritannien gewesen. Dort hatte die junge Margaret Thatcher, eine ausgesprochene Verehrerin der Entfesselung der Wirtschaft von Gesetzen, bei den Parlamentswahlen 1979 die Mehrheit gewonnen und eine jahrelange Vorherrschaft linker Regierungen gebrochen, die dem Staat ein große Rolle in der Wirtschaft zugeschrieben hatten. Thatcher wurde aber nicht vordringlich wegen ihrer neoliberalen Wahlversprechen gewählt. Sondern weil die zutiefst zerstrittene und durch Gewerkschaftsstreiks gelähmte Labour-Regierung nach einem „Winter of Discontent“ unter James Callaghan den Eindruck lähmender Untätigkeit verbreiteten.
Das Irrationale als Nenner
Man kann diese Beispiele von Zeitenwenden auch auf den Nenner des Irrationalen in der Politik bringen. Demnach könnten entscheidende Änderungen der Weltentwürfe, von links nach rechts und umgekehrt oder von sozial marktwirtschaftlich zu radikal marktzentriert, mit rationalem Verhalten oder auf Fakten basierenden Entscheidungen der Wähler nur wenig zu tun haben. Sie wären hingegen wie eine leider noch nicht erforschte spieltheoretische Konstellation zu sehen: Eine Mehrheit von Probanden versucht, sich in einen Gefühlszustand zu versetzen und überträgt diese Aufgabe einem ihrer Mitglieder.
Es hat die Rolle des sentimentalen Führers. Aber nach der Wahl bestehen die „Wähler“ nicht etwa auf der Einhaltung der Erwartung durch den Gewählten. Sie nehmen die Erfüllung des Auftrages für gegeben an. Das klingt absurd, aber genau so könnten sich Wähler verhalten: Sie nehmen zwar inhaltliche Vorwände für die Wahl, wenn sie gefragt werden. Doch eigentlich haben sie kaum Inhalte wahrgenommen. Sie haben mit dem Politiker einen zumeist sehr einfachen sentimentalen Traum gewählt, der oft in ein Wort passt (Gerechtigkeit, Stärke etc.). Und diesen von ihnen gewählten Traum versuchen sie solange wie möglich für sich aufrecht zu erhalten. In diesem Sinn haben vor vier Jahren an die 50 Prozent der US-Amerikaner Donald Trump gewählt, weil er sie „groß macht“. Diese Stärke schreiben sie sich nun noch immer als erfüllt zu. Sonst ist es nicht zu erklären, dass trotz der eklatanten Mängel, die Donald Trumps Regierung und der Präsident persönlich aufweisen, immer noch mehr als 40 Prozent zu ihm halten und ihn wieder wählen würden.
Es zählen weder die nachgewiesenen Unwahrheiten und Lügen des Präsidenten, noch seine gebrochenen Wahlversprechen, noch die Kluft in der USGesellschaft. Trumps Fans wollen vielleicht, so muss man mutmaßen, einfach den Traum von der eigenen Größe weiterträumen, den sie vor vier Jahren gewählt haben. Es ist eine Utopie im Kleinen – sie braucht keinen großen Entwurf von der Art des Thomas Morus. Sie braucht nur ein Wort, und schon wird die Seele gesund. Bis auf Weiteres.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!