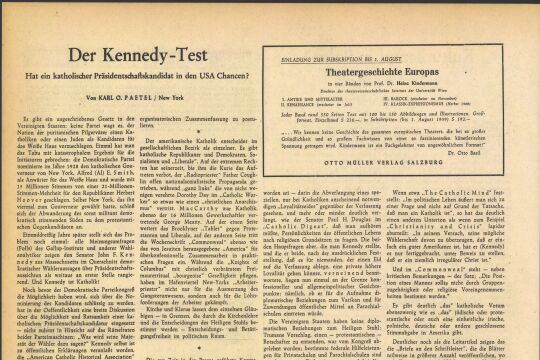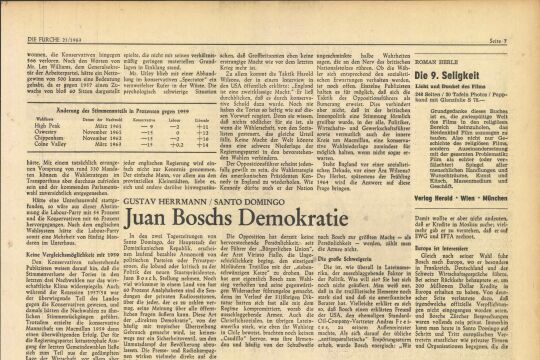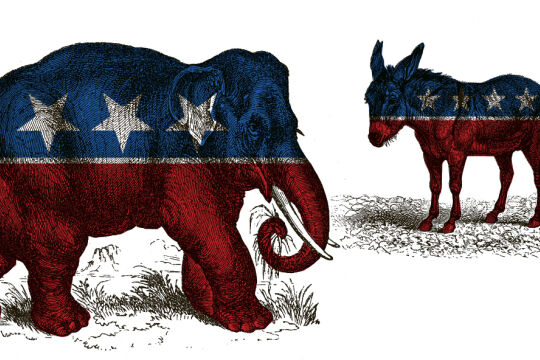Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Schicksal a la Goldwater
In einem amerikanischen Wahlkampf um das Amt der Präsidentschaft ist es für gewöhnlich unmöglich, mehrere Wochen vor der Wahl bereits klare Prognosen zu stellen. Nicht so 1972. Kandidat Präsident Nixon führt in allen Meinungsuntersuchungen mit solchem Abstand, daß sein Gegner, Senator George McGovern, darin Trost sucht, daß es für ihn nur noch aufwärts gehen könne.
In einem amerikanischen Wahlkampf um das Amt der Präsidentschaft ist es für gewöhnlich unmöglich, mehrere Wochen vor der Wahl bereits klare Prognosen zu stellen. Nicht so 1972. Kandidat Präsident Nixon führt in allen Meinungsuntersuchungen mit solchem Abstand, daß sein Gegner, Senator George McGovern, darin Trost sucht, daß es für ihn nur noch aufwärts gehen könne.
Im Lager der Republikaner ist man so siegessicher, daß man pausenlos vor übertriebener Zuversicht warnt, die oft — so im Fall Tru-man—Dewey — zu geringer Wahlbeteiligung der sich bereits als Sieger Dünkenden führt.
Wie ist es zu einer solchen Position der beiden Kandidaten gekommen? Wie denkt das amerikanische Stimmvolk?
Zunächst muß man davon ausgehen, daß es in den USA erheblich mehr registrierte Demokraten als Republikaner gibt. Das Reservoir McGoverns ist daher von Haus aus viel größer als jenes Nixons, nur daß McGovern eine Minderheit seiner Partei repräsentiert.
Dagegen verfügt Nixon über den eingebauten Vorteil des amtierenden Präsidenten: Er muß nicht versprechen, er kann seine Handlungen für sich sprechen lassen. Nixon, ein durch und durch politischer Präsident von großem taktischem Geschick, hat während seiner ganzen Amtsperiode Handlungen gesetzt, die den Demokraten den Wind aus den Segeln nahmen. Seine großen außenpolitischen Gesten und Initiativen gegenüber Rotchina und der Sowjetunion entsprechen an sich dem Wunschtraum jedes Demokraten, der an Verhandlung und Evolution glaubt und Konfrontation ablehnt. Nixons Vietnampolitik ist zwar in den Augen vieler Demokraten die bloße Fortsetzung eines falschen Engagements, aber auch sie müssen zugeben, daß unter Nixon dieses Engagement wesentlich abgebaut wurde und ein „ehrenhafter Friede“ in absehbarer Zeit Realität geworden ist. Die Mehrzahl der Amerikaner sieht ein, daß eine Kapitulation der USA den Frieden nicht herbeiführen und ihre in Peking und Moskau aufgewertete Weltstellung erschüttern würde. Schließlich fallen in Vietnam nicht mehr Amerikaner, sondern Asiaten, und Krieg ist nun einmal kein moralisches Anliegen.
Was schließlich die Wirtschaft betrifft, so ist es Nixon gelungen, die Inflationsrate zunächst durch eine drastische Abkühlungspolitik, dann durch Preis- und Lohnkontrollen, und schließlich durch eine graduelle Konjunkturförderung unter die 3-Prozent-Grenze zu drücken, und was das für das Elektorat bedeutet, sollte man gerade in Europa verstehen. Die Arbeitslosigkeit ist auf etwa 5 Prozent gesunken, optisch eine noch immer hohe Ziffer, gemessen jedoch an Statistiken aus der Zeit vor dem Ausbruch des Vietnamkonfliktes oder des Koreakrieges ein normales Ergebnis. Zuletzt hat Nixon den Trend in der Rassenfrage richtig erkannt und sich dagegen gestemmt, daß Schulkinder, nur zwecks Herbeiführung einer Integration in der Schulklasse, weite Wegstrecken per Autobus zurücklegen müssen. Diese Haltung, verbunden mit der Nominierung konservativer Richter für den Obersten Gerichtshof, haben den Süden für Nixon gewonnen. Sein Gegner hat diesen Teil des Landes bereits abgeschrieben.
McGovern sucht daher vergeblich nach einer schwachen Stelle des Gegners. Er wurde als Exponent des linken Flügels der Partei nominiert und ist daher besonders der radikalen Jugendbewegung verpflichtet. Idealismus und Organisationstalent dieser jungen Akademiker obsiegten im Vorwahlkampf über die eingefahrene Routine und Flachheit der Humphrey, Muskie und Jackson, während ein Attentat den vermutlich farbigsten der Demokratischen Kandidaten, George Wallace, ausschaltete. Trotzdem bleibt McGovern in seiner Partei in der Minderheit und verschreckt mit seinen radikalen Gesellschaftstheorien und Nivellie-rungstendenzen all jene, die etwas zu verlieren haben. In der Vietnamfrage plädiert er für eine Art von Kapitulation, die die Freilassung der amerikanischen Kriegsgefangenen dem Wohlwollen der Kommunisten überlassen würde. Auch für diese Politik gibt es wenig Anhänger und in der jetzigen Kampfphase, die deutliche Erschöpfungszeichen der Nordvietnamesen zeigt, auch keinen Anlaß. Gut informierte Kommentatoren sind der Ansicht, daß es Nixon im Augenblick gar nicht so eilig mit einem Friedensabkommen habe, daß vielmehr die Nordvietnamesen drängten. Eine Abmachung vor dem Wahltermin würde von Freund und Feind als eine taktische Wahlgeste aufgefaßt werden.
So konzentriert sich McGoverns Kampagne im Augenblick auf Korruptionsbeschuldigungen und moralische Vorwürfe, die ja dem protestantischen Prediger aus South Dakota stilistisch gut liegen, beim zynischen Wahlvolk aber kaum ankommen. Korruption und Amoralität gehören in den Augen eines breiten Publikums zur Demokratie, korruptionsfreie Regierungen habe es noch nie gegeben.
Angesichts des bisherigen Mißerfolges der Wahlwerbung McGoverns muß der Kandidat der Demokraten mit seinem Programm etwas zur Mitte rücken, wo ja in Wahrheit die Stimmen liegen. Dieses Schwanken schwächt ihn jedoch bei den jugendliehen Wählern, ohne ihn bei der breiten Mitte glaubwürdiger zu machen. Er macht daher den Eindruck eines Kandidaten, der jedem nach dem Mund reden will.
Für die Apathie, mit der McGoverns Wahlwerbung aufgenommen wird, sorgt jedoch auch Nixons taktisches Geschick. Er hat sich von Haus aus geweigert, mit McGovern Fernsehdiskussionen abzuführen, seine Wahlappelle sind ruhig und sachlich, er kontrolliert die Presse durch die Ergebnisse seiner Außen-und Innenpolitik und nimmt daher seinem Gegner jegliche Resonanz: Nixon arbeitet — McGovern schimpft.
Das ist der äußere Eindruck, und deshalb verpufft McGoverns Polemik in der Weite des Landes und verschafft dem an sich gar nicht sehr populären Präsidenten noch zusätzliche Sympathien.
Untersucht man nun die prinzipiellen Faktoren dieser politischen Auseinandersetzung, so scheint es sich zu erweisen, daß die Vereinigten Staaten durch eine eher konservative, absorbierende Phase ihrer Entwicklung gehen und für Gesellschaftsreformen im Sinne der Wohlfahrtsstaatideen McGoverns zur Zeit nichts übrig haben. Noch immer gilt die Leistung mehr als ein Appell an das soziale Gewissen und die Spekulation auf eine Neuverteilung des Nationalproduktes. McGovern hat daher wohl die Stimmung des Landes falsch beurteilt beziehungsweise hätten die Demokraten besser getan, einen mehr in der Mitte stehenden Kandidaten zu nominieren. Denn nach den jüngsten Meinungsumfragen stehen bloß die schwarzen Wähler überwiegend hinter McGovern, während weite Teile der Gewerkschaften und der Arbeiterschaft, Katholiken und Juden — also jene Bevölkerungsteile, die in der Vergangenheit immer einen Demokraten in das Weiße Haus gewählt haben, zunächst abgefallen sind. Natürlich dürfte bis zum Wahltag Nixons 2:1-Führung etwas knapper werden, wenn traditionell demokratische Wähler zur Vermeidung einer Katastrophe ä la Goldwater unter McGoverns Banner rücken. Aber wenn nicht alles täuscht, scheint sich wieder zu bewahrheiten, daß jener Kandidat in den USA die Präsidentschaft gewinnt, der die Mitte des politischen Spektrums beherrscht, und daß jener untergehen muß, der sich bloß am rechten oder linken Flügel verankert.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!