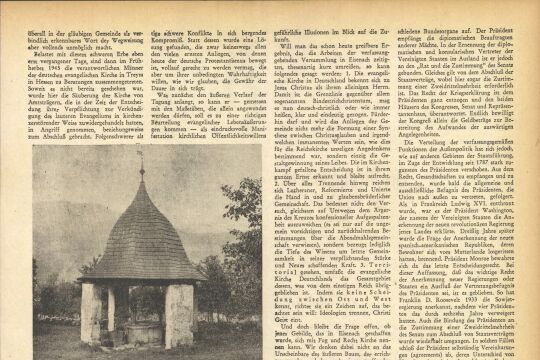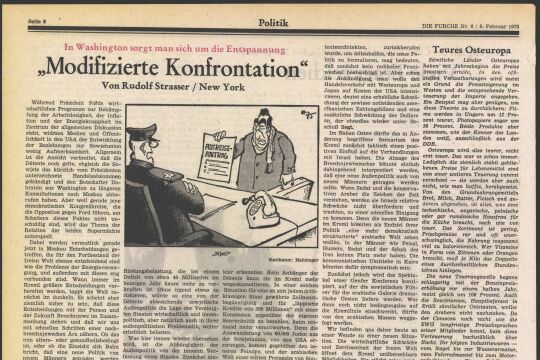Dem Weißen Haus entgleitet die Kontrolle: Carter sucht Erfolge in der Außenpolitik
Die für viele Betrachter der Szene schwer verständlichen Ausfälle, Rückzieher und Zickzackbewegungen im Bereich der Außenpolitik Präsident Carters haben dennoch einen gemeinsamen Nenner: das innenpolitische „standing” des Präsidenten. Zumindest seit der „Lance-Affäre” fühlt das Weiße Haus, daß ihm die Kontrolle entgleitet, daß es nicht mehr initiiert, sondern nur reagiert.
Die für viele Betrachter der Szene schwer verständlichen Ausfälle, Rückzieher und Zickzackbewegungen im Bereich der Außenpolitik Präsident Carters haben dennoch einen gemeinsamen Nenner: das innenpolitische „standing” des Präsidenten. Zumindest seit der „Lance-Affäre” fühlt das Weiße Haus, daß ihm die Kontrolle entgleitet, daß es nicht mehr initiiert, sondern nur reagiert.
Daß Carter seinen Freund Lance als Budgetdirektor nicht halten konnte, beweist, daß das innenpolitische Gewicht nach wie vor beim Kongreß liegt, wohin es seit den Nixon-Wirren lind der Niederlage in Vietnam geglitten ist und daß es dem Präsidenten, trotz anfänglich hoher Popularität bei der Bevölkerung, nicht gelungen ist, diese Machtstruktur zu ändern.
Auf die Lance-Niederlage folgten weitere Rückschläge in der Eriergie- politik, als der Senat die Konzepte und Gesetzesvorlagen des Präsidenten völlig zerpflückte und verlauten ließ, daß er eine andere Energiepolitik wünsche, die mehr Betonung auf die Erschließung neuer Energiequellen als auf das Sparen lege. Daß des Präsidenten wütende Reaktion in einem Unterleibshieb gegen die „profithungrige” Ölindustrie kulminierte, soll nicht von der Tatsache ablenken, daß die amerikanische Bevölkerung angesichts des momentan vorherrschenden reichlichen Energieangebotes eben nicht sparen will, aber sehr wohl ihre Zukunftsängste in erhöhte Anstrengungen zur Erschließung neuer Quellen umgesetzt sehen möchte.
Das weniger als robuste Wirtschaftsklima bei gleichbleibend hoher Arbeitslosigkeit erhöht auch die Nervosität eines Regierungste’ams, das auf einer politischen Erfolgswelle ins Weiße Haus eingezogen ist und plötzlich erkennen muß, daß ihm wenig gelungen ist, was die hochgeschraubten Erwartungen rechtfertigen könnte.
Unter Erfolgszwang haben amerikanische Regierungen noch immer ihre Zuflucht in der Außenpolitik gesucht. Hier ist ein Bereich, der die eigene Öffentlichkeit zunächst nicht direkt betrifft, der ja Verständnis für komplizierte Details in’fernen Ländern mangelt. Zudem ist der Schlußpunkt einer Vertragsunterzeichnung oder einer Staatsvisite meist recht spektakulär. Auch Präsident Carter dürfte das erkannt haben. So bereitet der Präsident derzeit eine Serie von Staatsbesuchen in Südamerika. Afrika Asien und Europa vor, denen man Nützlichkeit nicht absprechen kann, zugleich aber auch nicht zugestehen möchte, daß sie unaufschiebbar seien. Überdies hat der Präsident die Möglichkeit, Regierungsvertreter all der auf dem Reisep rog ramm stehenden Staaten während der Generalversammlung der Vereinten Nationen aus New York zu sich nach Washington einzuladen, eine Möglichkeit, von der er in der Nahostdiplomatie oder bei der Anbahnung neuer Abrüstungskonzepte reichlich Gebrauch macht. Jedenfalls kann man Präsident Carter mit südamerikanischen Militärs, afrikanischen Stammeshäuptlingen, mit dem Schah von Persien und dem französischen Staatschef Ehrenkompanien abschreiten sehen, und wer möchte bestreiten, daß da und dort dabei auch etwas Positives herauskommt?
Zugzwang
Solange die Ablenkungsbestrebungen sich in dem geschilderten außenpolitischen Rahmen halten, wäre dagegen nicht viel mehr einzuwenden als die Nichteinhaltung von Prioritäten. Anders jedoch, wenn unter Erfolgszwang außenpolitische Entscheidungen übers Knie gebrochen werden sollen, die scheinbar noch nicht reif sind, zumindest nicht in der geplanten Form. Klassisches Beispiel dafür ist das Panamä-Abkommen, dessen Unterzeichnung im Weißen Haus mit „eindruckschindendem” Slanz und Aufwand inszeniert wurde, das aber in seiner heutigen Form kaum, und sicherlich nicht mehr in diesem Jahr, Aussicht hat, vom Senat mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit ratifiziert zu werden. Obwohl an diesem Vertragswerk schon mehrere Präsidenten gearbeitet hatten, überraschte die Unterzeichnung ein nicht unterrichtetes Publikum Und einen unvorbereiteten Senat, so daß jetzt der Eindruck vorherrscht, man wolle etwas aufgeben/urdas man einst bezahlt und das man erbaut hat, und das überdies einen wesentlichen Sicherheitsfaktor darstellt. Wenn der Senat überhaupt ratifizieren wird, so nicht vor der Durchführung von Korrekturen hinsichtlich eines amerikanischen Interventionsrechtes zur Verteidigung der Neutralität des Kanals, und nicht ohne amerikanischen Vorrang bei der Benützung des Kanals im Falle einer internationalen Krise. Daß solche Formulierungen den Stolz der sich immer nationalistischer gebärdenden Pana- mesen verletzen, ist klar. Das Panamä-Abkommen verspricht also nicht den außenpolitischen Erfolg, mit dem im Weißen Haus ursprünglich gerechnet wurde.
Kissing er-Gastspiel
Dagegen schwelgt man in Hoffnungen auf ein Zusammentreffen der Genfer Nahost-Konferenz noch vor Ablauf dieses Jahres. Das Nahostproblem durch ein Abkommen zwischen Israel und den verschiedenen arabischen Interessenten zu lösen, ist ein vordringliches Anhegen der Regierung Carter, die während des Wahlkampfes Kissingers Taktik der kleinen Schritte heftig kritisiert und verurteilt hat. Das in der außenpolitischen Praxis unerfahrene Team Carter-Brezinski-Vance träumte immer schon von großen Konzepten, indes der Praktiker Kissinger das Mögliche an den Realitäten maß. Immerhin war es Kissinger gelungen, den sowjetischen Einfluß im Mittleren Osten auszuschalten und einen Modus vivendi einzurichten, der zwar niemandem gefiel, aber für die nahe Zukunft einen Zustand der „Kampflosigkeit” versprach. Carter wollte aber - wie in fast allem, was er anfkßt - die perfekte Lösung. Nur von ihr verspricht er sich geschichtliche Anerkennung und, last not least, innenpolitische Früchte.
Die Geschichte der von Carter enthüllten Pläne und Konzepte, aber auch der zurückgenommenen Initiativen, ist bereits Legende. Oft jagen sich Erklärungen und Dementis im Ablauf eines einzigen Tages, je nachdem, wer sich gerade auf den Fuß getreten fühlt. Wenn - wie das meist der Fall ist, so eine Initiative fehlgeht, dann muß sie eben hinausposaunt werden, weil Carter dem Elektorat versprochen hat, eine offene und transparente Außenpolitik zu führen - keine „Geheimdiplomatie ä la Kissinger”. Als dann Carters „approach” von den Arabern wie von den Israelis abgelehnt wurde und zu nichts führte, wurde allerdings Kissinger selbst konsultiert, der in letzter Zeit des öfteren wieder im Weißen Haus zu Gast war.
Der Trick, durch den schließlich eine Genfer Konferenz erzwungen werden sollte, war die unerwartete Einschaltung der Sowjetunion in Form eines gemeinsamen Kommuni- quės. Dieses wurde auf israeüscher Seite, aber auch von den amerikanischen Juden als ein Großmächte-Ok- troi abgelehnt und führte zu wütenden Protesten des amerikanischen Judentums, dem ja Carter zu einem nicht geringen Teil seine Wahl verdankt. Keine 24 Stunden später hat dann Isaraels Außenminister Dayan, wie die Israelis meinen, dem Kommuniquė die Giftzähne auszubrechen vermocht und im Verlauf einer Nachtsitzung mit dem Präsidenten eine Formulierung durchgesetzt, die den Israelis den Gang nach Genf erträglich scheinen läßt. Dieser Widerspruch läßt sich dadurch auflösen, daß eben jede Seite die Erklärung in ihrem Sinn auslegt: die Israelis beharren auf der Ablehnung einer palästinensischen Staatseinheit und einer Vertretung der PLO in Genf, die Araber glauben, ihrerseits einen Durchbruch erzielt zu haben.
Das Ganze dürfte spätestens in Genf platzen. Verbleiben wird jedoch die Wiedereinschaltung der Sowjets ins Spiel um den Nahen Osten, denn die Sowjets werden jetzt keine Schwierigkeit«) mehr haben, sich als legitime Vorkämpfer der arabisch-palästinen sischen Forderungen zu gebärden. Daß eine geplatzte Genfer Konferenz nicht nur der Sache selbst, sondern auch der politischen Fortune Präsident Carters schaden wird, kann ohne viel Phantasie vorausgesagt werden.
Wozu also der ganze Schachzug? Die Antwort hegt in einer Analyse der jüngsten amerikanischen Versuche, das Verhältnis zur Sowjetunion wieder zu normalisieren.
Wohl ist Präsident Carter in seiner Grundhaltung niemals vom „ererbten” Konzept der „Dėtente” abgewichen. Er hatte jedoch gehofft, sich durch seine wohl in erster Linie gegen den kommunistischen Ostblock gerichtete Kampagne für die Menschenrechte taktisch in eine stärkere Verhandlungsposition zu manövrieren - und das nicht nur gegenüber der Sowjetunion, sondern auch gegenüber dem Kongreß und dem Elektorat.
Während die zweite Hoffnung einigermaßen in Erfüllung ging - Carters anfängliche Popularität basierte sicherlich im wesentlichen auf seinem kritischen Auftreten gegenüber Moskau -, hat die Menschenrechtskampagne eine merkliche und bedrohliche Abkühlung zwischen den beiden Großmächten zur Folge gehabt. Solange die Kampagne nur propagandistischer Natur war, dürfte sie der Sowjetunion ziemlich gleichgültig gewesen sein. Moskau sah wohl auch den Vorteil in einem Gesprächspartner, der zu Hause stark war und durchzusetzen vermochte, was er an Kompromissen auszuhandeln sich anschickte. In Verbindung mit den Helsinki-Verträgen wurde die Forderung nach Wahrung der Menschenrechte jedoch zu einem Instrument, dessen sich nunmehr die Regimekritiker im Ostblock bedienen und zugleich ein Echo im Westen erwarten konnten. Jeder Protest wurde zu einem Prozeß, den man vor einem Welttribunal durchführen konnte. Tribunale dieser Art waren die Folgekonferenzen von Belgrad, denen man in Moskau mit gemischten Gefühlen entgegensah.
In Washington hatte man aber offenbar inzwischen erkannt, daß man etwas zu weit gegangen war. Schon wurde von Außenminister Vance die Formulierung „im Rahmen der außenpolitischen Realität” geprägt und auch Arthur Goldberg vermeidet in Belgrad jede Konfrontation.
Vor allem aber war man im Weißen Haus daran interessiert, die eingefrorenen Abrüstungsgespräche wieder in Schwung zu bringen. Eine Regierung, die Einsparungen im Rüstungsbereich versprochen hat, kann sich einen vertragslosen Zustand gegenüber der sowjetischen Atommacht auf die Dauer nicht leisten. Es fehlen die Maßstäbe dafür, was gen jg und was zuviel ist, wenn der potentielle Feind volle Handlungsfreiheit genießt. Schon Gerüchte über sowjetische Erfindungen auf dem Gebiet der Raketenabwehr durch Strahleneinfluß verpflichten in einem vertragslosen Zustand zu immer neuen, immer kostspięligeren Konzepten. Überdies dürfte sich in Carter geradezu ein Komplex gegenüber dem „Außer-Kontrolle-Geraten” atomarer Rüstungen entwickelt haben, so daß der Präsident jetzt in der Rüstungspolitik einen Eckstein seiner Außenpolitik sieht
Sowjetisches Comeback
Daß die SAL-Gespräche in den letzten Wochen so rasch vorangekommen sind, mag in den meritorischen Konzessionen hegen, die Carter den Sowjets gemacht hat. Schließlich ist er bereit, auf die Weiterentwicklung der Cruise-Rakete zu verzichten, die er nach der Einstellung des Baues von B-I-Bombem als seine stärkste und verläßlichste Waffe bezeichnet hatte. Den Paradebombem der Sowjetunion vom Typ „Backfire” soll dagegen keine Beschränkung auferlegt wer den, Spezialisten in Rüstungsangelegenheiten fragen sich daher, ob man hier eigentlich noch von einem Kompromiß sprechen könne. Neben diesen Konzessionen dürfte aber die entgegenkommende Haltung im Nahen Osten, die den Sowjets ein völlig unerwartetes diplomatisches Comeback einräumt, wesentlich zum verbesserten Klima zwischen Moskau und Washington beigetragen haben. So schnell hat sich die Szenerie gewandelt, daß man heute bereits Befürchtungen über die amerikanische Schwäche gegenüber den Sowjets äußert, während man noch vor wenigen Wochen um den Weiterbestand der Dėtente und vor dem Ausbruch des Kalten Krieges bangte. War der von Carter so sehnlich erstrebte außenpolitische „Erfolg”, wie schon oft in der jüngeren Geschichte der Vereinigten Staaten, wieder einmal durch Konzessionen gegenüber der Einhaltung von Menschenrechten vielleicht doch nicht mehr als eine taktische Geste, ein „abgecartertes” Spiel? In unserer schnellebigen Zeit werden wir bald Antwort auf diese erregende Frage erhalten. Es ist jedoch schon bezeichnend für die Außenpolitik Jimmy Carters, daß sie eine solche Interpretation überhaupt zuläßt.
Es darf daher auch nicht Wunder nehmen, wenn das Mißtrauen gegenüber der erratischen Politik des Präsidenten im Kongreß wächst und das, obwohl die erdrückende Mehrheit in beiden Kammern, und der Präsident selbst, der gleichen politischen Partei angehören. Hat man noch unter Carters Vorgängern den Kongreß oft als Hemmschuh bei notwendigen Entscheidungen empfunden, so gewinnt das Gefühl heute an Boden, daß hier glücklicherweise eine Institution am Werke ist, die unausgegorenen Entschlüssen einen Riegel vorzuschieben vermag.