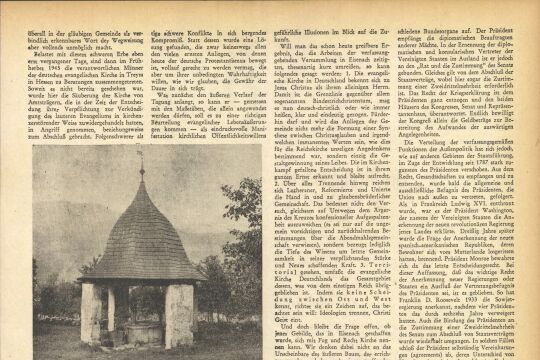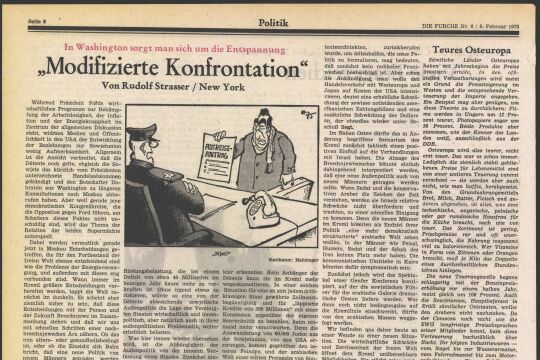Amerikas fatale Doktrinen
Es sollte öfter betont werden: Amerika treibt im strengen, eigentlichen Sinn des Wortes gar keine Außenpolitik. Amerika erfüllt vielmehr eine nach außen gerichtete Mission, indem die Nation für auswärtige Ereignisse im Interesse der Freiheit anderer in mehr oder weniger ausgeprägter Form Verantwortung trägt. Verantwortung zu tragen, ist jedoch etwas wesentlich anderes, als ein eigenes außenpolitisches Interesse zu verfolgen. Denn außenpolitisches Interesse im klassischen Sinn knüpft an machtpolitischen Faktoren an, auswärtige Ereignisse zu beeinflussen oder zu beherrschen. Verantwortung, wie sie Amerika trägt, zeigt zwar auch diese Züge — manche bezeichnen die amerikanische Außenpolitik sogar als „imperialistisch“ —, aber sie treten doch hinter der Verantwortung zurück, die Amerika, durch den Lauf der Geschichte bedingt, für Freiheit und Selbständigkeit anderer Nationen übernommen hat.
Es sollte öfter betont werden: Amerika treibt im strengen, eigentlichen Sinn des Wortes gar keine Außenpolitik. Amerika erfüllt vielmehr eine nach außen gerichtete Mission, indem die Nation für auswärtige Ereignisse im Interesse der Freiheit anderer in mehr oder weniger ausgeprägter Form Verantwortung trägt. Verantwortung zu tragen, ist jedoch etwas wesentlich anderes, als ein eigenes außenpolitisches Interesse zu verfolgen. Denn außenpolitisches Interesse im klassischen Sinn knüpft an machtpolitischen Faktoren an, auswärtige Ereignisse zu beeinflussen oder zu beherrschen. Verantwortung, wie sie Amerika trägt, zeigt zwar auch diese Züge — manche bezeichnen die amerikanische Außenpolitik sogar als „imperialistisch“ —, aber sie treten doch hinter der Verantwortung zurück, die Amerika, durch den Lauf der Geschichte bedingt, für Freiheit und Selbständigkeit anderer Nationen übernommen hat.
Nichts beleuchtet das Fehlen eines wirklichen außenpolitischen Interesses so stark wie die ständige, bewußte Verwendung von Doktrinen zur Kennzeichnung des außenpolitischen Spielraumes der Nationen, die einmal mehr das Moralistische, ein andermal mehr das Legalistische in den Vordergrund rücken. Außenpolitik aber, die auf Beherrschung oder Beeinflussung auswärtiger Ereignisse ausgerichtet ist, braucht zu ihrer Rechtfertigung oder Erklärung keine Doktrinen. Sie entfaltet sich aus sich selbst, sie versteht sich aus sich selbst. Es ist deshalb kaum denkbar, die Politik Talleyrands oder jene Metternichs als eine „doktrinäre“ Politik zu charakterisieren. Genauso ungewöhnlich und falsch wäre es, die Außenpolitik Bismarcks oder die der englischen Krone in ihrem ständigen Bestreben, das Gleichgewicht der Kräfte auf dem europäischen Kontinent zu erhalten oder im eigenen Interesse zu verändern, als „doktrinär“ zu charakterisieren. Gerade in dieser Gleichgewichtspolitik wird Außenpolitik in ihrem klassischen Gewand sichtbar: Das Ziel war klar durch das machtpolitische Interesse vorgezeichnet, die Methode — der bewußte und gewollte Einsatz politisch-militärischer Macht — oft erprobt, nur die Konstellationen, unter denen diese Macht eingesetzt wurde, waren je andere, sie wechselten ständig.
Die amerikanische Außenpolitik aber kleidet sich zu ihrer Rechtfertigung und zur Vereinfachung des Verständnisses — der Amerikaner denkt ja für gewöhnlich immer innenpolitisch, heimatbezogen und begreift Außenpolitik nur als Fortsetzung der Innenpolitik oder auf Grund moralisch-legalistischer Gesetzesformeln — in abwechselnder Weise in Doktrinen. So findet sich im 19. Jahrhundert die Monroe-Doktrin für die „westliche Hemisphäre“, die jeder auswärtigen Macht Einflußnahme in der gesamten amerikanischen Hemisphäre untersagt. Dann gibt es die Wilson-Doktrin der 14 Punkte und der auf dem Recht aufgebauten Politik einer Weltordnung. Schließlich ist die Roosevelt-Doktrin der „vier Freiheiten“ und jene der Vereinten Nationen zu nennen, die ja in vielerlei Hinsicht eine treue Kopie der inneramerikanischen Verfassung sein sollte. Als bekanntestes Beispiel in unseren Tagen ist die Truman-Doktrin zu nennen, die im März 1947 aus Anlaß der kommunistischen Bedrohung von Griechenland und der Türkei in die Form eines weltweiten amerikanischen Hilfeversprechens gekleidet worden ist. Aus ihr konstruierte John Foster Dulles, der Außenminister der Eisenhower-Administration, dann die „Politik des Containment“, der Eindämmung, indem er der amerikanischen Nation 42 Bündnisverpflichtungen schuf, die, wie Kritiker nunmehr behaupten, alle das gleiche Dynamit enthalten wie der SEATO-Vertrag und damit „zweite Vietnams“ gebären können.
Ihren verbalen Höhepunkt erreichte diese Politik in der Inauguraladresse Präsident Kennedys „Jede Nation soll wissen, ob sie un: wohl gesonnen ist oder uns übel will daß wir jeden Preis zahlen, jede Lasl tragen und uns jeder Anstrengung unterziehen, jeden Freund zu unterstützen und jeden Feind abzuwehren, um Uberleben und Erfolg dei Freiheit sicherzustellen.“ Lyndon Baines Johnson war der letzte, dei diese Politik konsequent in Vietnam praktizierte. Er ist eigentlich der Testamentsvollstrecker der Dulles-Ära.
Unter Präsident Nixon sehen sich die Dinge schon anders an. In seiner „Botschaft über die Lage der Nation“ sagte er im vergangenen Jahr: „Amerika kann nicht — und will nicht — alle Pläne entwerfen, alle Programme fertigstellen, alle Entscheidungen ausführen und die gesamte Verteidigung der freien Völker der Welt übernehmen.“
Diese Worte führen in gerader Konsequenz zur Nixon-Doktrin für Asien, die Nixon am 28. Juli 196S in Bangkok formulierte und aui deren Interpretation er auch jetzt in seinem außenpolitischen Lagebericht wieder zurückgefallen ist: „Unsere Entschlossenheit, die amerikanischen Engagements zu erfüllen, steht in voller Übereinstimmung mit unserer Überzeugung, daß die asiatischen Nationen in wachsendem Maß die Verantwortung für Frieden und Fortschritt in diesem Teil der Erde übernehmen können und müssen. Die Herausforderung an unsere Klugheit besteht darin, die Anstrengungen der asiatischen Nationen zu unterstützen, sich selbst zu verteidigen und weiterzuentwickeln, ohne dabei der Versuchung zu erliegen, deren eigene Verantwortung zu übernehmen. Denn wenn Beherrschung durch einen Aggressor die Freiheit einer Nation zerstören kann, dann kann zu große Abhängigkeil von einem Beschützer eines Tages die Würde dieser Nation aushöhlen.“
Doktrin vom Abzug aus Europa?
Außenpolitische Doktrinen sind nicht frei von Schwächen, das zeigt sich immer wieder. So hat die Nixon-Doktrin dazu geführt, die Europäer fürchten zu machen, Amerika werde die gleiche Politik — mit der gleichen Begründung und mit dem gleichen
Ergebnis: nämlich Abzug der amerikanischen Truppen — auch in Europa ausüben. Doktrinen müssen zudem fortlaufend sorgsam erklärt und interpretiert werden. Sie ersetzen keinesfalls die Konsultation, die politische Koordination. Doktrinen sind starr, sie lassen den Einzelfall, das Einzelinteresse außer acht — und damit sind stie für die Außenpolitik im Grunde genommen unbrauchbar. In der Hand der Amerikaner erhalten diese Doktrinen darüber hinaus noch eine gewisse Rigorosität. Die Alliierten werden gepreßt und manchmal auch erpreßt, um sich der Doktrin zu beugen, die die Amerikaner missionarisch im besten moralischen Glauben und guten Absichten anderen als das Heil verkünden und zur Exportware machen.
Wie wenig scharf die außenpolitische Begriffsabstimmung in Amerika unter Verwendung auswärtiger Doktrinen immer noch ist, zeigt sich am auffallendsten am Beispiel dessen, was eigentlich unter dem Begriff des „nationalen Interesses“, der „national security“, zu verstehen ist. Hier prallen die Gegensätze nach wie vor mit unverminderter Schärfe aufeinander: Fällt zum Beispiel das amerikanische Sicherheitsinteresse mit einem Angriff auf Berlin, auf Europa, auf Japan, auf Vietnam, auf Israel zusammen? Oder ist das amerikanische Interesse erst dann wesenhaft beeinträchtigt oder gefährdet, wenn die Sowjets einen nuklearen Angriff auf das Festland starten — oder schon dann, wenn Kuba in die Zange genommen werden soll?
Die Crux in Vietnam
Eng mit der Tatsache, daß Amerika in der Welt Verantwortung für den Bestand der Freiheit trägt und kein unmittelbares machtpolitisches Interesse verfolgt, hängt der moralistische Zug der amerikanischen Außenpolitik zusammen. Die Amerikaner wollen — zum Beispiel auch in Vietnam — im Grunde ihres Herzens Gutes tun. Sie wollen die Demokratie exportieren und den Vietnamesen die Geschenke der Freiheit ermöglichen. Sie wollen damit helfen. Sie wollen nicht unmittelbar Macht, nicht Einfluß — obwohl diese Motive doch in Gemengelage liegen. Wer aber helfen und nicht nur Macht ausüben will, der fragt sich eines Tages, ob es denn überhaupt Sinn hat, zu helfen, wenn man damit Südvietnam ruiniert — mit Napalm, mit Sex, Coca Cola, mit Bomben und Krieg. Darin ist ein wichtiges Indiz für die hintergründige Beurteilung der amerikanischen Außenpolitik zu sehen: Enttäuschung, Resignation, moralisch gescheitert zu sein.
Diese Erkenntnis führt zu dem nächsten Punkt, der oft übersehen wird: Die amerikanische Außenpolitik ist nur auf dem Hintergrund der innenpolitischen Situation zu verstehen und sachgerecht zu bewerten. Dort aber finden sich jene „Jahrhundertprobleme“, die unbewältigt sind und vermutlich auch von der
Politik überhaupt nicht bewältigt werden können, schon gar nicht über Nacht. Es sind Probleme, die die gesamte Gesellschaft angehen. Es muß nachdenklich stimmen, wenn drei große Berichte von Kommissionen des Präsidenten auf ihren jeweiligen Teilgebieten zu ernüchternden, niederschmetternden Ergebnissen gelangen. So stellte die Rassenkommission fest, die amerikanische Nation spalte sich in zwei Gesellschaften, eine schwarze und eine weiße, getrennt und ungleich. In ähnlicher Weise konstatierte der Scranton-Bericht über die Ursachen der studentischen Unruhe, Amerika sei in zwei Kulturen geteilt, eine alte und eine junge, die einander feindlich und unverständig gegenüberstehen. Schließlich vermerkt die Eisenhower-Kommission, die die Ursachen der Kriminalität und Gewalttäigkeit untersuchen sollte, es drohe eine allgemeine Bewaffnung, das Heim werde zur Festung, suburbia zur umfriedeten Zwingburg — „my home js my .Castle“.. . . .„ . .
Wie stark ausgeprägt dieses Spannungsverhältnis zwischen amerikanischer Außen- und amerikanischer Innenpolitik ist, erweist sich vor allem daran, wie sehr der Einfluß des amerikanischen Kongresses auf die Führung der Außenpolitik zugenommen hat. Sicherlich, der Präsident ist der Oberste Kriegsherr, und die Außenpolitik bedarf nur „der Beratung und der Zustimmung des Senats“. Aber im amerikanischen Verfassungssystem der „checks and balances“, der Schübe und Gegenschübe, sind Spannungen und Friktionen zwischen dem Herrn im Weißen Haus und den Herren auf dem Capitol nichts Ungewöhnliches, sie gehören zur Alltagswirklichkeit. Aber was man an Opposition aus dem Capitol im Augenblick vernimmt, sprengt den Rahmen des Gewohnten bei weitem.
Der Präsident kann heute kaum noch klar und eindeutig gegen den erklärten Willen des Senats handeln, wenn er nicht das psychische und politische Schicksal Johnsons erleiden will. Er muß der Stimmung des Senats in wesentlichen Punkten nachgeben, muß Kompromisse schließen.
Die politischen Erklärungen, Auslegungen und was sonst an Verlautbarungen offiziellerseits in die Arena geworfen wird, steht in der Gewichtigkeit hinter diesen Faktoren der Innenpolitik (öffentliche Meinung und Kongress) zurück. Erst nachdem die allgemeine innenpolitische Situation angemessen berücksichtigt worden ist, kann man über Wert, Nutzen und Aussagekraft offizieller amerikanischer Stellen, wie zum Beispiel des Pentagon, des State Department oder des Nationalen Sicherheitsrates urteilen. Im Gegensatz zu europäischen Ländern haben diese offiziellen Stellen nur sehr geringen Einfluß auf die amerikanische Außenpolitik. Jede solche allgemeine Behauptung stößt hier allerdings auf die Problematik des Details, das in verwirrender Fülle meistens vorliegt. Wie gering der Einfluß Außenminister Rogers ist, geht daraus hervor, daß der auswärtige Senatsausschuß unlängst ein heftiges Lamento darüber anstimmte, den eigentlichen Außenminister, Kissinger, nicht vorladen zu dürfen, weil er kein offizielles Amt hat. Gerade unter Nixon ist deutlich: Der Präsident selbst interessiert sich in erster Linie für Außenpolitik, hat mit Kissinger in diesem Punkt seinen einflußreichsten Ratgeber und stellt Rogers und teilweise auch Laird hintenan. Im Ganzen betrachtet, hängt hier natürlich sehr viel davon ab, wer im inneren Zirkel der Macht Sitz und Stimme hat, wie die Machtverhältnisse der verschiedenen Bürokratien gegeneinander und zueinander sind und last not least, welche Stellung der Präsident selbst zur Außenpolitik einnimmt. Nur das Konzert, der Zusammenklang der verschiedenen Stimmungen, Äußerungen, Strömungen und Absichten verrät den Trend der amerikanischen Außenpolitik. Die hier aufgezeigten und beleuchteten Quellen und Strukturen sollte man aber stets berücksichtigen, aus ihnen speist sich die amerikanische Außenpolitik und wird nach Maßgabe der einzelnen Gesetzmäßigkeiten und sachlichen Erfordernisse auswärtige Politik. Amerikanische Politik des Äußeren jedoch ist erst dann erkennbar, wenn der Zusammenklang disharmonisch und konsonant vernommen worden ist — und wenn man die Unterschrift des Präsidenten findet. Darin hat Dean Acheson, der Außenminister Trumans, völlig recht.