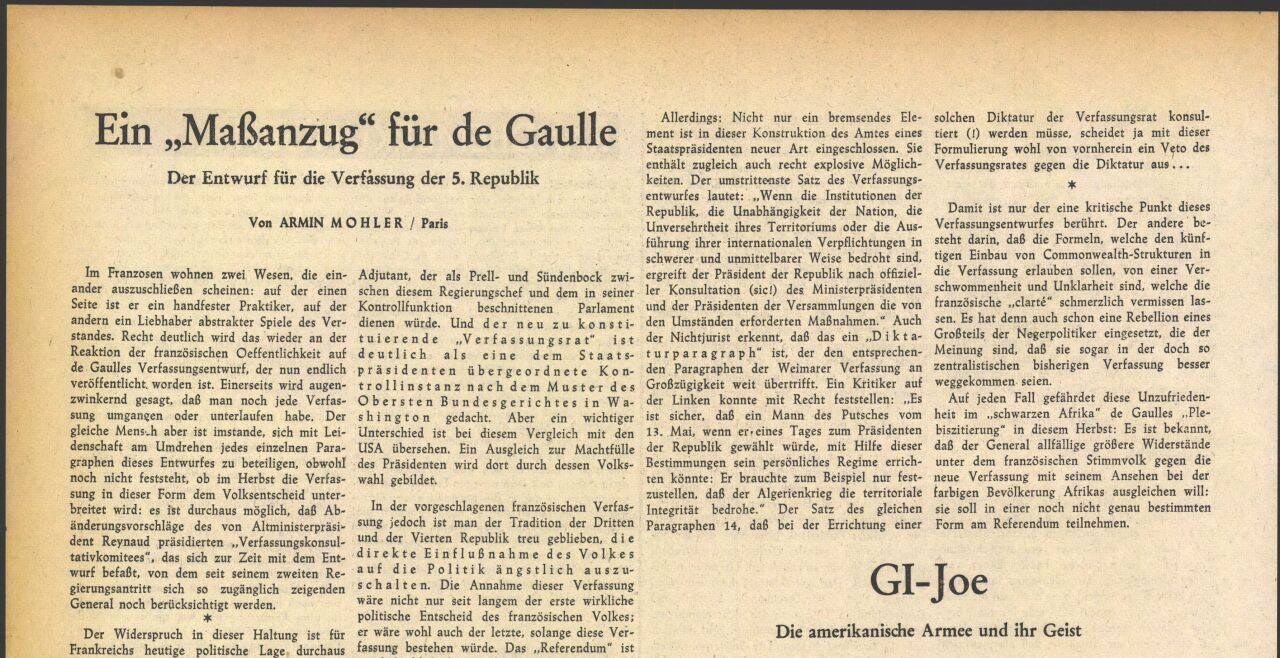
„Von den Hallen Montezumas bis zum Strand von Tripolis“ heißt es in dem stolzen Regimentsmarsch der US-Marineinfanterie, der „Weltpolizei“ der Vereinigten Staaten. Das Marinekorps, das in seinem Ursprung bis in das Jahr 1775 zurückreicht, war schon vor 130 Jahren eine Art „Weltpolizist“, als es den Piraten von Tunis das Handwerk legte, und seither hat es nur vorübergehend diese Rolle abgelegt. Als militärische Einheit ist es eine Art Kuriosum, denn es befindet sich sozusagen in dauerndem Kriegszustand in seiner jetzigen Gesamtstärke von 200.780 Mann. Laut Gründungsurkunde hat es nämlich jederzeit bereit zu sein, „zur Unterstützung der nationalen Politik“ eingesetzt zu werden. Und diese Einsätze zur Unterstützung der nationalen Politik der USA waren recht zahlreich, angefangen vom berühmten Sturm auf den befestigten Aztekenpalast von Chapulte-pec im Kriege gegen Mexiko. In schier endloser Kette folgten dann die Aktionen auf Kuba im Krieg gegen Spanien, die Einsätze auf den
Philippinen zur Unterdrückung der Revolte Aguinaldos im Jahre 1900, in China, in Nikaragua und anderen Bananenrepubliken und wiederum in Mexiko. Der erste Weltkrieg mit Chateau Thierry, der zweite mit Bataan, Saipan, Okinawa, Guadalcanal und Manila waren blutopferreiche Kapitel in der Geschichte dieses Korps, dem die Trumansche „Polizeiaktion“ in Korea allein 5500 Tote kostete. Augenblicklich spielt sich die Unterstützung der nationalen Politik an der libanesischen Küste ab, sehr weit von der engeren Interessensphäre der Vereinigten Staaten entfernt. Aber es hat wohl noch keinen Seesoldaten Onkel Sams gegeben, der nach dem Warum gefragt hätte, und so war auch die Frage eines amerikanischen Zeitungskorrespondenten eigentlich überflüssig, der von einem dieser Soldaten auf dem Flugplatz von Beirut erfahren wollte, ob er wisse, warum er hier sei. Der Seesoldat Dennis McCarthy antwortete wegwerfend: „Ich will verdammt sein, wenn ich das weiß.'“, wandte sich ab und kaufte bei einem Wanderhändler einen Eislutscher. Dieses rauhe Soldatenwort machte die Runde in jenem Teil der Heimatpresse, die Eisenhower und der libanesischen Aktion nicht gerade freundlich gegenübersteht, und sollte, in entsprechender Aufmachung gebracht, die Widersinnigkeit des Linternehmens dartun, vielleicht sogar die innere Ablehnung solcher Abenteuer durch den Frontsoldaten erweisen. Sinn oder Widersinn, Zustimmung oder Ablehnung spielen hier keine Rolle, und indirekte Rückschlüsse auf den Geist dieser Truppe zu ziehen, wäre grundfalsch. Die Mannschaften des Korps bestehen zum weitaus größeren Teil aus Freiwilligen, die sich aus Vorliebe für den Militärdienst, aus Abenteuerlust oder sonst einem persönlichen Grunde gemeldet und der sehr harten Ausbildung und scharfen Disziplin unterzogen haben. Sie sind die Befehlsempfänger par excellence, die mit Kipling sagen können: „ . . . uns ziemt es nicht zu fragen, nur zu sterben.“ Wer Glück hat, kann als Hauptfeldwebel nach zwanzig Dienstjahren mit etwa zweihundert Dollar monatlich in Pension gehen und in Erinnerungen an seine Dienstzeit bei dieser Truppe schwelgen, die als einzige in der Wehrmacht der USA über eine ununterbrochene Tradition verfügt und deren Glanz auf jeden Angehörigen des Korps strahlt.
Obzwar das Marinekorps organisatorisch ein Bestandteil der amerikanischen Kriegsmarine ist und seine Offiziere aus der Marineakademie in Annapolis kommen, steht es nach Tradition und militärischen Leistungen ebenbürtig neben den Eliteregimentern europäischer Heere. In der regulären Armee der Vereinigten Staaten — das sind die Verbände, die von der Bundesregierung erhalten und von ihr auch befehligt werden — ist Regimentstradition relativ selten. Das ist darauf zurückzuführen, daß noch nach jedem Krieg, den Amerika führte, mit einer manchmal geradezu naiven Gründlichkeit abgerüstet wurde. Das „Bring the boys home“ war für den USA-Kongreß stets gute Politik. Von George Washingtons Revolutionsarmee, die der preußische Offizier Friedrich Wilhelm von Steuben im Winter 1777/78 in Valley Forge unter der Nase der Briten erst zu einer Armee zusammenschweißte, ist keine Spur geblieben. Nach Beendigung des Krieges ging die Armee einfach heim, und es blieben nur SO Offiziere und Mann zur Bewachung von Depots übrig. Erst im Sezessionskrieg (1861 bis 1865) entstand so etwas wie eine Truppentradition, die sieb nur in den ersten zwölf Infanterieregimentern, bei einigen Artillerieeinheiten und bei den Kavallerieregimentern erhielt. Von den letzteren fand nur das siebente unter Oberstleutnant (Titular-General-major) Custer durch seinen Heldenkampf und seine spätere Vernichtung durch aufständische Indianer (1876) Eingang in die Kriegsgeschichte. Im Krieg gegen Spanien waren es Teddy Roose-velts „Rough Riders“, ein aus Freiwilligen bestehendes Reiterregiment, das sich auf Kuba Lorbeeren erfocht. Aber von diesen rauhen Reitern weilt heute keiner mehr unter den Lebenden, und die Erinnerung an das Regiment lebt nur mehr in den Schulbüchern fort. In den Panzerregimentern des zweiten Weltkrieges aber ging die Tradition der alten Kavallerieregimenter unter, die bei der Erschließung und Befriedung des Wilden Westens Jahrzehnte hindurch eine ausschlaggebende Rolle gespielt hatten.
In der heutigen US-Armee besteht regimenterweise höchstens eine Art landsmannschaftlichen Zusammengehörigkeitsgefühls. Einheiten, die sich vornehmlich aus Texas und anderen Südstaaten rekrutieren, sowie die aus Indianern bestehenden, zeigen dies am deutlichsten. Negerregimenter gibt es heute nicht mehr, seitdem vor einigen Jahren die Einordnung von farbigen Soldaten in alle Regimenter angeordnet worden ist. Im zweiten Weltkrieg bestanden sie noch, wie es ja an der italienischen Front auch zwei japanische Regimenter gab. Ein ungleich bunteres Bild zeigen die aus den Oststaaten kommenden Einheiten, die ein Abbild des amerikanischen Völkerschmelztiegels sind. Dort wimmelt es in den Standeslisten von irischen und polnischen, italienischen, serbischen, ungarischen, tschechischen und ukrainischen Namen, von der Legion deutscher Namen nicht zu reden. Besonders in den Listen der Offiziere des Heeres scheinen deutsche Namen häufig auf, von Eisenhower angefangen über Decker, Grünther, Lemnitzer, Arnold, Weible bis zu Fritzsche und Westphalinger, nur um einen Blick in die Generalsliste zu werfen. Das ist zum Teil darauf zurückzuführen, daß im Sezessionskrieg das deutsche Element unter den Offizieren (Schurz, Sigl, von Steinmetz u. a.) und den Mannschaften sehr stark vertreten war. Viele Nachkommen dieser Veteranen absolvierten die nach dem Entwurf des Generals von Steuben organisierte Militärakademie von West Point, wo' auch heute noch etwas von dem preußischen Geist militärischer Strenge lebt. An dieser 150 Jahre alten Akademie bildete sich eine Offizierskaste heraus, die jedoch keineswegs dem gesellschaftlichen Rang und Einfluß der deutschen oder alt-österreichischen entspricht. Sie ist vielmehr innerhalb des großen amerikanischen Sozialkörpers eine eng geschlossene, von Korpsgeist erfüllte Gruppe, deren äußeres Abzeichen der goldene Klassenring von West Point ist. Fast nach preußischem Muster nimmt sie den durchweg tüchtigen und im Kriege sehr bewährten Reserveoffizier nicht für voll. Das gleiche Verhältnis besteht auch in der Kriegsmarine, wo die Absolventen der Marineakademie von Anna-polis den Ton angeben. Die strenge Auslese beginnt bereits bei der Aufnahme in beide Akademien. Die Ernennungen erfolgen auf Grund der Vorschläge der Kongreßabgeordneten und Senatoren, sowie des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Die Aufnahmsprüfungen sind rigoros, die psychischen und körperlichen Anforderungen hochgespannt, der Lehrstoff umfangreich und die Prüfungen streng. Ein System von „schwarzen Punkten“, sogenannter „demerits“, die wegen Verstößen gegen die Akademieordnung oder Disziplin gegeben werden, schwebt stets über den Köpfen der Kadetten. Eine bestimmte Anzahl besiegelt automatisch die Laufbahn.
Wer nun die zahlreichen Klippen und Prüfungen glücklich umschifft hat, findet sich nach vier Jahren als Leutnant nach kurzem Urlaub zunächst in einer öden Garnison oder als Marinefähnrich auf einem stinkenden Oeler. Die Liebe zum Beruf erfährt also gleich eine harte Probe. Dabei beträgt die Gage eines jungen Leutnants auch heute noch kaum mehr als der Lohn eines kleinen Büroangestellten, nämlich 252 Dollar im Monat plus einer Subsistenzzulage von 48 Dollar. Nach je zwei Dienstjahren erhöht sich die Gage, aber die Friedensvorrückung in höhere Dienstränge ist bei Onkel Sam wie anderswo auch recht langsam und der Kommißdienst in Garnisonen Alaskas, im heiß-feuchten Panama oder in trostlosen Militärposten auf den Prärien des Westens, wo auch Eisenhower als Major und Oberstleutant Gamaschendienst versah, verlangt viel Entsagung, getreu den lapidaren Worten, die der Wahlspruch West-Points sind: Pflicht, Ehre, Vaterland. Ein enger Zusammenschluß ist da eine Selbstverständlichkeit. Heiraten innerhalb der Offizierskreise sind fast die Regel und Madame Kommandeuse ist dort eine ebenso bekannte Erscheinung wie seinerzeit in der alten k. u. k. Armee. In den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg fand allerdings eine gewisse gesellschaftliche Auflockerung dadurch statt, daß viele Reserveoffiziere im aktiven Dienst behalten werden mußten und so ein frischer Luftzug in die manchmal etwas muffige soziale Atmosphäre kam.
Für Gl-Joe gilt das jedoch nicht. Er ist der Zivilist in Uniform. Ihm fehlte es von jeher am sogenannten soldatischen Geist, der den kontinentalen Heeren in so hohem Maße zu eigen war. In der Wehrpflicht sieht er nicht etwa die ehrenvolle Ausübung eines Dienstes für das Vaterland, sondern eher einen Eingriff in die so hochgeschätzte und eifersüchtig gehütete persönliche Freiheit. Bereits im Bürgerkrieg hatte Präsident Lincoln die allgemeine Wehrpflicht im Kongreß durchgesetzt. Blutige Aufstände in New York waren die Antwort darauf. Dann gab es bis zum ersten Weltkrieg keine allgemeine Wehrpflicht, erst der zweite brachte wiederum ein Wehrpflichtgesetz, das mit einigen Abänderungen auch heute noch besteht. Populär ist es aber nie geworden. Und so war es immer wieder nötig, dem Amerikaner, der aus reichlich ungebundenen Zivilverhältnissen in die oft unnötig harte militärische Zucht kam, in der „Schleifer-Platzeks“ in zahlreichen Exemplaren blühten, klarzumachen, warum er seine heilen Knochen im Interesse des jeweiligen nationalen Notstandes zur Verfügung zu stellen habe. Im ersten Weltkrieg erleichterte das die von Englands Presse begonnene Greuelpropaganda. Trotzdem sah Gl-Joe (im ersten Weltkrieg nannte er sich „doughboy“, frei übersetzt etwa „Fußlatscher“) in dem Krieg nur einen peinlich unangenehmen Job, der schleunigst zu beenden sei, damit man heimgehen könne. Das änderte sich auch im zweiten Weltkrieg nicht wesentlich. Die Aushebung zum Wehrdienst riß den jungen Mann aus Heim und Familie in das Ausbildungslager und fegte ihn dann entweder auf die Schlachtfelder Europas oder in die Dschungel der Inseln im Südpazifik. Er fügte sich mit grimmem Humor ins Unvermeidliche und nannte sich Gl-Joe. Gl, die Abkürzung der Bezeichnung „government issue“ (Regierungsausgabe), war ein Stempelaufdruck, der auf jedem Wäschestück, Toilettenartikel usw. des Soldaten prangte. Der junge Soldat war abgestempelt, ein Stück Regierungsausgabe bei sehr guter Verpflegung und allzu reichlichem Sold, was sich besonders in der Besatzungszeit in Europa und Japan nicht gerade vorteilhaft auswirkte. Zuerst fühlte er sich ganz als „Eroberer“, aber als die Flitterwochen Roosevelt-Stalin ein jähes Ende fanden und die Moskauer Gefahr als direkte Bedrohung der Sicherheit von Heimat und Familie bemerkbar wurde, vollzog sich im Gl-Joe eine gründliche Wandlung.
Man sollte meinen, daß sich die Erkenntnisse Gl-Joes, der ja nach zwei Jahren Dienstzeit wieder in das Zivilleben zurückkehrt, in der heimischen Politik geltend machen würden. Gewiß, als der zweite Weltkrieg zu Ende ging, ließ Sien“ Joe in hunderttausenden Stimmen vernehmen, er werde dafür sorgen, daß im Frieden vieles daheim anders und besser würde. Die sich überstürzenden Weltereignisse überspielten ihn, die Initiative war ihm entrissen, bevor er noch beginnen konnte, und heute steht Freund Joe erst recht immer wieder vor vollendeten Tatsachen und sein gesunder politischer Instinkt warnt ihn vor Experimenten auf politischer Ebene daheim. Heute gilt für ihn mehr denn je das Wort des amerikanischen Admirals Stephen Decatur (1779-1820): „My country, right or wrong, my country.“




































































































