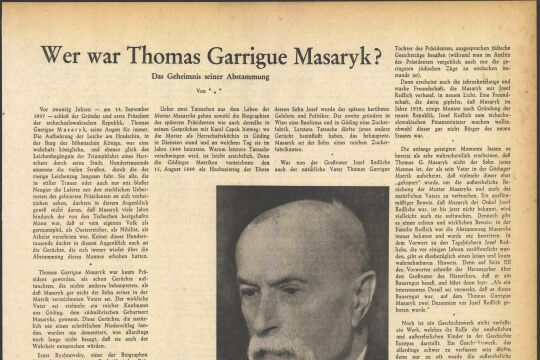Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Held des rauhen Westens wurde im Osten erfunden
Wie entstehen Mentalität und Identität einer Kultur, eines Volkes, einer Nation? Wie und unter welchen Umständen bilden sich Mythen? Kann man Mythen „machen"? Welche Bedeutung hat der Held für das Selbstverständnis der Menschen und ihrer Geschichte? Wer schreibt die Geschichte einer Kultur -und wer schreibt sie um?
Diesen Fragen geht der Ethnologe Dieter Rünzler am Beispiel der Konstruktion des Mythos vom amerikanischen Helden nach, wobei sich als Urbild des Helden eine kleine Gruppe von Arbeitern erwies, die mithalf, Rinderherden zu beaufsichtigen oder Tausende Meilen durch Amerika zu treiben und in den Cow-Towns zu verkaufen.
Warum wurde nicht der Minenarbeiter, der Arbeiter beim Eisenbahnbau, der Farmer oder die Lehrerin zum Mythos? Jeder von ihnen spielte eine weit bedeutendere Rolle bei der Entwicklung der USA als ausgerechnet die Rinderhirten. Um das zu verstehen, muß man, wie der Autor zeigt, tiefer in die soziale und kulturpsychologische Entwicklung der Vereinigten Staaten des 18. und vor allem 19. Jahrhunderts steigen.
Wofür steht der Cowboy? Zunächst ist er die Verkörperung eines sozialen Musterbildes, das für die Verhältnisse der USA an der Wende zum 20. Jahrhundert entstanden ist, aber er ist mehr als das. Es scheint nämlich, daß mit dieser Figur, ähnlich wie mit dem Tramp von Charlie Chaplin, ein allgemeiner Topos getroffen wurde. Denn der Cowboy läßt sich, etwa für die Zigaretten werbung, von Texas bis Kuala Lumpur verwenden, und die Western-Filme stoßen ebenso in allen Kulturkreisen auf Interesse, wie zum Beispiel auch „Derrick" in China gerne gesehen wird. Das Wesentliche derartiger Figuren besteht darin, daß sie auf eine sehr einfache Weise die Möglichkeit zur Identifikation bieten. Der Cowboy ist der namenlose Held, jedem vertraut, bereit zur Gewalt, um das Böse zu besiegen, er ist nicht familiär gebunden und in seiner Darstellung asexuell: Frauen spielen nur dann eine Rolle in seinem Leben, wenn er sich in der Cow-Town eine Dirne nimmt. Was aber das Entscheidende ist: Er lebt zwischen Zivilisation und Wildnis. Die offene Grenze zum noch nicht restlos in Besitz genommenen Westen, die „Frontier", spielt in der psychologischen Entwicklung des US-amerikanischen Volkes eine wesentliche Rolle.
Am Beginn des 19. Jahrhunderts waren die USA eine Agrargesell-schaft, die Industrialisierung in den Neu-England-Staaten steckte in den Anfängen. Der mit der Industrie und technischen Innovation einhergehende soziale Wandel wurde noch kaum wahrgenommen, und die politischen Konzepte orientierten sich an der „Yeoman-Democracy", die jedem Bürger das Recht gab, ein für seine Bedürfnisse ausreichendes Stück Land billig zu erwerben. Damit entstand das Bild vom freien Kleinbauern. Amerika sollte eine Gesellschaft von „freien Amerikanern" sein.
Dieses Bild, das noch vom 3. Präsidenten Jefferson in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts vertreten wurde, erlangte für das Selbstverständnis der USA große Bedeutung. Als sich die Viehzuchtindustrie im Niedergang befand, als die mit der Industrialisierung entstandenen gesellschaftlichen Probleme überhand nahmen und das Eigenbild des freien Amerikaners sowie der grenzenlosen Expansionsmöglichkeit in den Westen in den achtziger und neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts ins Wanken geriet, wurde aus der „Frontier" der Mythos vom „Wilden Westen" gemacht.
Typisch für diese Entwicklung ist, daß der Westen nicht mit einer konkreten geographischen Region verbunden wurde, sondern mehr mit dem, was das Wesen der, wie man glaubte, eigentlichen amerikanischen Kultur ausmachte.
Das Empfinden einer allgemeinen moralischen Krise und der Gefahr, daß alles, was die USA anderen Nationen so überlegen machte, verdorben würde, führte viele Künstler zur Um-Schreibung und Heroisierung der Geschichte. Aus der tatsächlichen amerikanischen Geschichte der Eroberung des Westens wurden griffige, plakative und eben „typische" Geschichten vom wahren Amerikaner, der an der Grenze zwischen Zivilisation und Wildnis lebt. Diese ergaben die Grundlage des Selbstverständnisses der Amerikaner.
Und es waren wieder Künstler (vorwiegend aus dem Osten der USA), die zu diesem Bild den Mythos vom typisch amerikanischen Menschen schufen, eben den Cowboy. Was man bis dahin von diesen Rinderhirten wußte, war wenig und wenig schmeichelhaft. Sie galten als Rowdies, als unmoralisch und ungewaschen. Also wurden sie ideologisch zurechtge-formt - und es entstand jener männliche Mann, der das Gute verteidigt und das Böse abknallt, der den Kampf mit der Wildnis aufnimmt und dem Amerika seine ständige Vergrößerung verdankt, der nicht von der Zivilisation „verweiblicht" ist, sondern im einsamen Heldentum eines mittelalterlichen Ritters steht. So wie der Cowboy müsse sich auch die Nation verhalten, um die Errungenschaften der überlegenen „angelsächsischen Rasse" der ganzen Welt zu bringen.
Dieter Rünzler zeigt in sehr eindrucksvoller und detailreicher Weise die geistigen und sozialen Hintergründe dieses Mystifikationsprozesses. Wer einen solchen Prozeß genau verfolgt, wird weniger anfällig werden auch für die Um- und Neu-Schreibungen jener Geschichte, die er selbst täglich erlebte und erlebt.
IM WESTIN IST AMERIKA
Die Metamorphose des Cowboys vom Rinderhirten zum amerikanischen Helden. Von Dieler Rünzler Picus Verlag, Wien 1995. 240Seiten, 66Abb., geb., öS 298-
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!