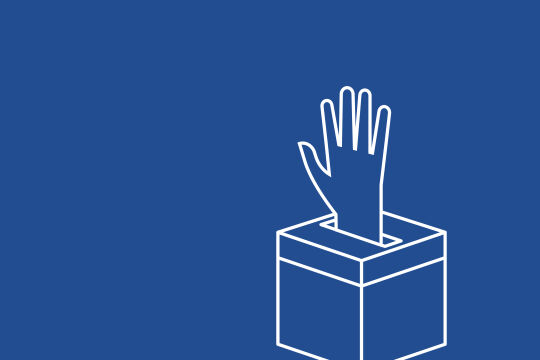Politiker und Verwaltung müssen lernen, mit Kritik umzugehen und digital zu interagieren. Diese Beteiligungsprozesse erfordern auch Spielräume, in denen sich die Akteure austauschen können.
Alte Glashäuser, saftige Wiesen - Schmetterlinge fliegen über eine scheinbar vergessene Gegend. Ein idyllischer Ort. Doch damit soll bald Schluss sein. Geht es nach dem Willen der Bezirkspolitiker von Wien-Ottakring, sollen an diesem Flecken am Fuße des Wilhelminenbergs in wenigen Jahren mehrstöckige Wohnungen errichtet werden. Wien wächst und es braucht Wohnraum, heißt es. Die geplante Verbauung dieses gewidmeten Grünlands im UNESCO-Biosphärenpark Wienerwald erzürnt aber die Gemüter; auch jenes von Christian-André Weinberger. Er wohnt auf dem Berg, und er möchte nicht dabei zusehen, wie auch diese Freifläche unwiederbringlich verbaut wird. Gemeinsam mit anderen rief er im Sommer 2017 die Bürgerinitiative "Pro Wilhelminenberg 2030" ins Leben. Die Organisatoren wollen das Vorhaben, wenn schon nicht verhindern, dann zumindest verkleinern.
Klaren Kopf bewahren
Seit über zehn Jahren setzt sich Peter Kühnberger, Geschäftsführer der Agentur Dialog Plus, mit digitaler Beteiligung (E-Partizipation) und Open Government auseinander. Er unterscheidet zwei Arten von Bürgerbeteiligungen: zum einen jene, die von Bürgerinitiativen ausgehen und oftmals Veränderungen etwa Bauprojekte -verhindern wollen; zum zweiten jene, die die Politik als organisierte Prozesse zur Verfügung stellt. In beiden Fällen müssen Politiker und Verwaltung lernen, mit Kritik umzugehen und digital zu interagieren. Diese Beteiligungsprozesse erfordern auch Spielräume, in denen sich die Akteure austauschen. Dabei sollte es sich nicht um Beteiligungen nur zum Schein handeln, deren Entscheidungen bereits gefallen sind, sagt der Experte.
Haben Politiker heute Angst davor, bei Entscheidungen der Bürger ihren Kopf zu verlieren? Nein, sagt Kühnberger, "aber sie sollten die Bürger bei Beteiligungsprozessen heute mehr denn je einbinden."
Die Schlüsselfrage der digitalen Demokratie lautet, welche Formate benötigt werden, um die Öffentlichkeit zu erreichen, ihr Interesse zu wecken und zu erhalten, erzählt Christoph Konrath von der Parlamentsdirektion. Er leitet dort die Abteilung für parlamentswissenschaftliche Grundsatzarbeit. Die digitale Demokratie müsse Antworten finden, wie man mehr Menschen für Demokratie begeistere und sie so anspreche, dass sie Prozesse möglichst gut verstehen. "Bereits seit über 20 Jahren wird hierzulande darüber diskutiert", sagt Konrath. "In der österreichischen Rechtsordnung besteht derzeit keine geeignete Rechtsgrundlage für Wahlen auf elektronischem Weg", erklärt Robert Stein, Leiter der Wahlabteilung im Innenministerium. Um eine elektronische Stimmabgabe via Internet, also außerhalb des kontrollierten Bereiches eines Wahllokals, zu ermöglichen, müsste das Bundes-Verfassungsgesetz geändert werden. Dafür müssten zwei Drittel der Abgeordneten im Nationalrat zustimmen. Im Regierungsprogramm der neuen Koalition finde sich aber keine Absichtserklärung in Richtung E-Voting, sagt Stein. Trotzdem verfolge das Bundesministerium für Inneres die Entwicklungen auf diesem Gebiet -insbesondere im Ausland oder auf der Ebene des Europarates.
Eines der Länder in Europa, das E-Voting heute bei Wahlen einsetzt, ist Estland. Hier brauchte es aber mehrere Wahlgänge, bis sich diese Form der Partizipation durchsetzte. Empirische Studien zeigen, dass beide Wege -die traditionelle Form des Wählens und E-Voting -weiterhin parallel angeboten werden müssen, um alle Bürger zu erreichen. "Damit ist aber ein höherer Aufwand verbunden", sagt Konrath.
Mehrwert dank Bürgerbeteiligungen
E-Voting sowie E-Partizipation -das sind zwei Paar Schuhe, betont Open-Government-Experte Kühnberger. Man müsse zwischen den Abstimmungsmethoden wie bei der Bundesheer-Volksabstimmung und partizipativ-demokratischen Methoden unterscheiden, erklärt er. Beim E-Voting geht es wie bei den regulären Wahlen darum, Stimmen zu gewinnen. Die Abstimmung verlagert sich nur weg von der Wahlurne hin zum eigenen Computer.
Bei der E-Partizipation spiele sich digitale Interaktion ab, erläutert Kühnberger. Diese erschöpfe sich aber nicht in einem Formular auf einer Website. Social-Media-Kanäle, Newsletter oder Votings sollten besser genutzt werden, um Interessierte zu erreichen und sie zur Mitwirkung zu bewegen, sagt Kühnberger. Er spricht sich für die Weiterentwicklung von digitalen Partizipationsprozessen in Österreich aus. Island etwa habe 2012 in einem Bürgerbeteiligungsverfahren eine neue Verfassung ausgearbeitet, in der die Bürgerbeteiligung festgeschrieben wurde. Partizipative Methoden wie Petitionen oder Bürgerbeteiligungen setzen eingehende inhaltliche Auseinandersetzung damit voraus. Dabei gehe es um mehrstufige Prozesse, die zur Meinungsbildung beitragen -angefangen beim Sammeln von Themen über das Verdichten der Vorschläge bis hin zum Diskurs über die entsprechenden Themen. "Der Mehrwert dabei ist, dass ich zu verbesserten Lösungen komme, die ich vorher nicht kannte", erläutert Kühnberger:
Wohin geht heute die weitere Entwicklung? Jeremias Stadlmair, Politikwissenschafter an der Universität Wien, ist skeptisch, dass Österreicher bald digital wählen können. Er setzt sich in Forschungsprojekten mit politischer Partizipation auseinander. Die Diskussion um die Briefwahl bei der Bundespräsidentenwahl zeige hier Grenzen auf, was an Innovationen möglich sei. Bei den Initiativen tue sich aber einiges, die Entwicklung sei hier noch nicht am Ende. Peter Kühnberger ist überzeugt: "Partizipationsprozesse werden künftig verstärkt mit Visualisierungen wie beispielsweise virtueller Realität arbeiten."
"Ich habe derzeit noch kein Vertrauen in E-Voting", sagt Peter Bußjäger, Leiter des Instituts für Föderalismusforschung in Innsbruck. Er befürchtet Manipulationsmöglichkeiten oder Hackerangriffe auf die digitalen Wahlkabinen. Die "manuelle" Wahl garantiere, dass allfällige Fehler nicht ins Gewicht fallen. Bei der digitalen Wahl können dagegen "erhebliche Verwerfungen unbemerkt bleiben." Für Peter Kühnberger ist entscheidend, dass die Technik verlässlich funktioniert. Spielraum für Improvisationen dürfe es hier kaum geben. Politikwissenschaftler Stadlmair sieht bei E-Voting das Wahlgeheimnis in Gefahr, da die Daten auf einem Server gespeichert werden müssten, um sie auswerten zu können. Die Sicherheit der geheimen Wahl wäre also in jedem Fall eine Herausforderung. In einem Wahllokal werde etwa auf einer Liste erfasst, wer gewählt hat. "Ob ich ungültig gewählt habe, weiß niemand", sagt Stadlmair. Bei Initiativen wie Volksbegehren, Petitionen und Bürgerinitiativen ist ersichtlich, wer sie unterstützt - außer der Unterzeichner spricht sich gegen eine Veröffentlichung aus. "Für Online-Partizipation brauchen die Teilnehmer nicht nur Online-Kompetenz, sondern auch Erfahrung im sicheren Umgang mit dem Internet", ist Kühnberger überzeugt.
Klick oder Kreuzerl
Über 4.000 Anrainer haben für eine Verkleinerung des Projekts am Wilhelminenberg gestimmt, freut sich Christian-André Weinberger. Die Online-Petition wurde über Facebook, E-Mails und die Website verbreitet. Die Petition an den Ausschuss des Gemeinderates des Rathauses konnte auch mittels Handy-Signatur unterzeichnet werden. Es sei einer großen Zahl der Unterzeichner bewusst gewesen, dass so bequem von zu Hause aus abgestimmt werden könne, ist Weinberger überzeugt.
Die Bürgerinitiative "Pro Wilhelminenberg" wurde zwar im Petitionsausschuss des Gemeinderats behandelt, dort aber letztendlich abgelehnt. "Partizipative Bürgerbeteiligung und kooperative Planungsprozesse sehen anders aus", sagt Initiator Weinberger. Ans Aufgeben denkt er deshalb aber noch lange nicht, wie er sagt: "Wir kämpfen selbstverständlich weiter - das ist keine Frage."