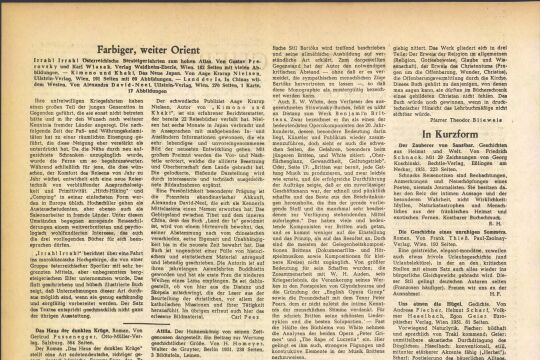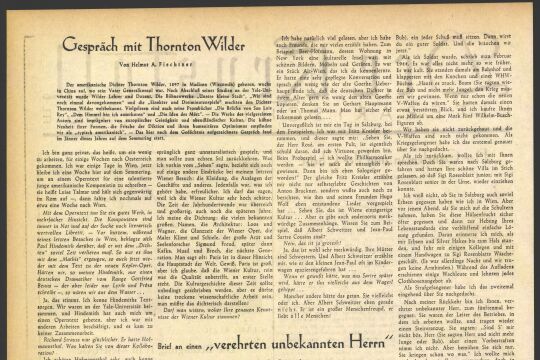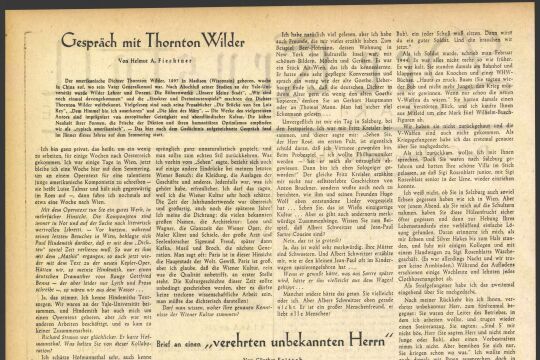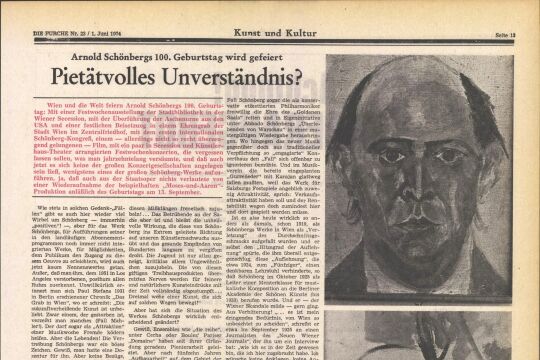Das Urbild des „Doktor Faustus
Sehr geehrter Herr Herausgeber!
In Ihrem letzten Musikbericht („Ausklang der VJičner Festwochenkonzerte“, „Die Furche“ vom 14. Juni 1952) dürfte Ihrem Musikkritiker, Prof. H. Fiechtner, den ich außerordentlich schätze, ein Fehler unterlaufen sein, den ich gerne berichtigen möchte. Im Zusammenhang mit der Aufführung von A. Schönbergs „Guerreliedern“ betont H. A. Fiechtner den Sprung, den der Künstler vom Romantischen, heute extensiv Wirkenden, in das Ätherblaue seiner Nachfolgewerke getan hat. Diesen gewagten, äußerst eindrucksvollen, von höchster künstlerischer Verantwortlichkeit zeugenden Sprung in eine neue Welt des Schaffens sieht Professor Fiechtner in der Nervosität Schönbergs gegenüber dem „Dr. Faustus“ von Th. Mann über alle möglichen Analysen hinweg besonders bestätigt. Eine solche Feststellung könnte beim Leser den Eindruck erwecken, als sei es tatsächlich das Anliegen Th. Manns gewesen, ein „Porträt“ Schönbergs in seinem großen Altersopus zu liefern. Wie irrig eine solche Feststellung ist, geht aus dem Briefwechsel A. Schönberg — Th. Mann hervor („Der Monat“, 1. Jahrgang, Heft 6, 1949), welcher mit aller möglichen Deutlichkeit beweist, wie wenig Th. Mann daran dachte, seinen Adrian Leverkühn als ein Porträt Schönbergs zu verstehen. Der Irrtum lag bei A. Schönberg, der Zuträgern sein Ohr lieh, ohne den Roman je zur Hand genommen zu haben. Dem Kenner des Buches wie auch der maßgeblichen Kritik ist es, wie Th. Mann selbst bemerkt hat, eh und je als „Nietzscheporträt“ erschienen, dem der Autor lediglich gewisse kompositorische Fähigkeiten zugewiesen hat, die von Schönberg stammen. Auf die Idee eines „Schönberg-Romans“ ist bisher außer dem bedauerlich Irregeführten niemand gekommen.
Post scriptum des Musikreferenten:
Der zitierte Briefwechsel war mir begannt. Aber es geht nicht darum, ob Thomas Mann in Adrian Leverkühn den Komponisten Schönberg dargestellt hat, sondern wie Schönberg lediglich auf Andeutungen von Freunden, meinetwegen als „Irregeführter“, auf die ihm nwr im Umriß bekanntgewordene Gestalt des Leverkühn, besonders aber auf deren „Idee“, reagierte. Dafür gibt es einen sehr persönlichen Grund, und diesen wollte ich andeuten.
Adrian Leverkühn ist übrigens nicht nur ein komponierender Nietzsche, seine Gestalt ist vielschichtig. Darüber hat Thomas Mann selbst einiges — aber nicht alles — in dem Roman eines Romans, „Die Entstehungsgeschichte des Doktor Faustus“, berichtet.
Eine Volksabstimmung
Sehr geehrter Herr Herausgeber!
Lassen Sie mich daran erinnern, daß kürzlich eine öffentliche Volksabstimmung über die österreichische Staatshymne stattgefunden hat. Darauf zielte jüngst ein Querschnitt der „Furche“, dem ich ein paar Worte — einen Schnitt tiefer — beifügen möchte:
Bei dem Fußballwettspiel England gegen Österreich saß auch ich am Radio wie Millionen andere Hörer in ganz Europa. Der Sprecher sagte: Man werde die österreichische Staatshymne „zum erstenmal im Chor von 70.000 Menschen“ singen hören. Dann hörte man die brave Polizeimusik, sonst njchti, aber auch gar nichts mehr. Von Gesang nicht einen Ton, in der Feme auch nicht die Sängerknaben. Ich habe mich wegen dieser öffentlichen Bloßstellung als Österreicher geschämt, aber zugleich mich doch auch über das gesunde Gefühl der Masse gefreut, mit der sie ein Tonwerk abgelehnt hat, das für einen Vaterlandsgesang ungeeignet ist. Ich glaube, die 70.000 Österreicher hätten kräftig gesungen, hätte es geheißen zu singen: „Sei gesegnet ohne Ende … Gott mit dir, mein Österreich!“