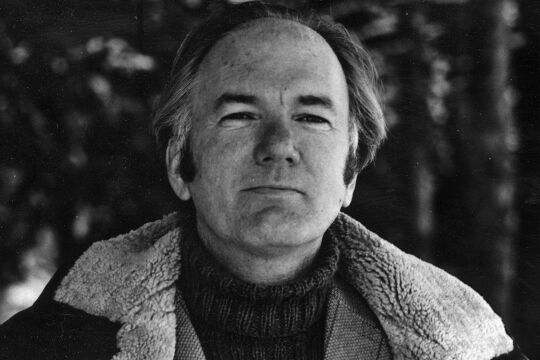Die Ohn-Macht des Vergangenen: Thomas Bernhards "Heldenplatz"
22 Jahre nach der skandalträchtigen Uraufführung spielt das Theater in der Josefstadt Thomas Bernhards "Heldenplatz". Nicht wirklich zwingend.
22 Jahre nach der skandalträchtigen Uraufführung spielt das Theater in der Josefstadt Thomas Bernhards "Heldenplatz". Nicht wirklich zwingend.
Skandale sind nur schwer planbar. Aber als 1988 der wenig konfliktscheue Burgtheaterchef Claus Peymann ausgerechnet Thomas Bernhard beauftragte, ein Stück für das 100-Jahr-Jubiläum des Burgtheaters zu verfassen, hat er das wohl mit einigem Kalkül gemacht. Denn nicht nur war 1988 das sogenannte "Bedenkjahr", in dem sich die Republik der Ereignisse von vor 50 Jahren erinnerte, das Land hatte darüber hinaus auch noch seit zwei Jahren Kurt Waldheim als Bundespräsidenten. Das, so dachte Peymann wohl, war der Stoff, aus dem ein Thomas Bernhard seine Abrechnung mit den Zuständen im Land und dem österreichischen Antisemitismus machen würde. Und weil die Stützen der Gesellschaft so prächtig mitspielten, sodass Bernhards Stück durch die Wirklichkeit bis zur Kenntlichkeit entstellt wurde, war der 4. November 1988 auch der erwartete Skandaltag mit tumultartigen Szenen vor, nach und während der Aufführung.
Ein Skandal als Aufklärung
Was damals effektvoll als Skandal geplant war, wirkte aber vielmehr wie eine Art Aufklärung für Österreich. Denn wie kaum etwas sonst brachte Bernhards Stück das bisher Verschwiegene und Verdrängte zur Sprache, und Bundeskanzler Vranitzky machte kurz darauf erstmals öffentlich das Eingeständnis einer "Mitschuld Österreichs" an der Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden.
Wie wirkt #Heldenplatz# beinahe eine Generation später? Jenes Stück, in dem Familienangehörige eines freiwillig aus dem Leben geschiedenen jüdischen Professors - er hatte sich aus dem Fenster direkt auf den Heldenplatz gestürzt, jenen Ort, an dem vor 50 Jahren Millionen Österreicher ihrem Heim-ins-Reich-Holer zujubelten - über die Gründe für den Selbstmord sprechen, die sie in der Vergangenheit sehen, sowie in der aktuellen geistigen Situation des Landes, die noch antisemitischer sei als vor 1938? Der politische Kontext hat sich, trotz der politischen Gruppierungen, die mit der Schürung xenophober Ängste Stimmung zu machen suchen, doch stark verändert.
Verzerrende Übertreibungen
Das eigentliche Thema von Bernhards Stück wird da noch stärker sein Welthass, sein Grant auf die aus seiner Sicht hinterwäldlerische Politik, die verlogene Kirche, die verrottete Presse, die Universitäten mit ihren vertrottelten Professoren. Das Stück ist im Wesentlichen eine - wenn auch mitunter vergnügliche - misanthropische Suada, ein Rundumschlag voller Bosheiten und verzerrender Übertreibungen, mit Urteilen über die Österreicher ("In jedem wohnt ein Massenmörder"), die heute mehr denn je zu pauschal wirken, um wirklich zu treffen.
Trotzdem ist Regisseur Philip Tiedemann für das Theater in der Josefstadt eine kunsthandwerklich feine Arbeit gelungen, die Peymanns Inszenierung bis hin zum Bühnenbild (Etienne Pluss) deutlich Reverenz erweist, und die durch hervorragende Schauspielerleistungen glänzt.
Vor allem Michael Degen als Bruder des Verstorbenen ragt heraus: Im starken zweiten Akt im nebelverhangenen Volksgarten, im Gespräch mit seinen Nichten Anna (energisch Sona MacDonald) und der stillen, in sich gekehrten Olga (Elfriede Schüsseleder) spielt er einen veritablen Bernhard'schen Schmerzensmann. Wenn er, tief gebeugt auf seine Krücken, erklärt, warum er die Augen verschließt vor all dem, was seinen Bruder in den Tod getrieben hat, dann sieht man hier einen Menschen, den Müdigkeit und Resignation in die innere Emigration getrieben haben. #Im Tod ist das Ziel#, sagt er - und den Hasstiraden und Verwünschungen zum Trotz wird "Heldenplatz" für einen kurzen Moment ein wehmütiges, fast melancholisches Stück. Degens Darstellung allein lohnt den Besuch in der Josefstadt.
Sonst aber gilt das Gegenteil von dem, was Helmut Karasek damals im Spiegel schrieb: Das Publikum habe, indem es Peymann und Bernhard den Gefallen getan, sich angegriffen zu fühlen, das Tote zum Leben erweckt. Hier in der Josefstadt blieb das Tote tot.