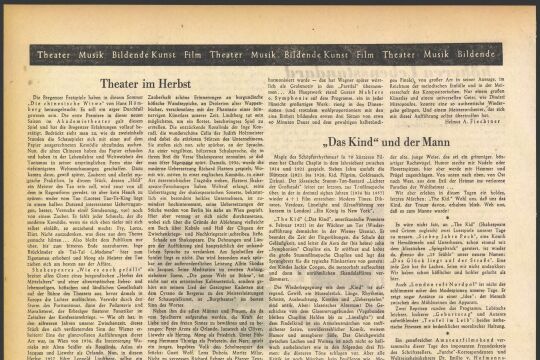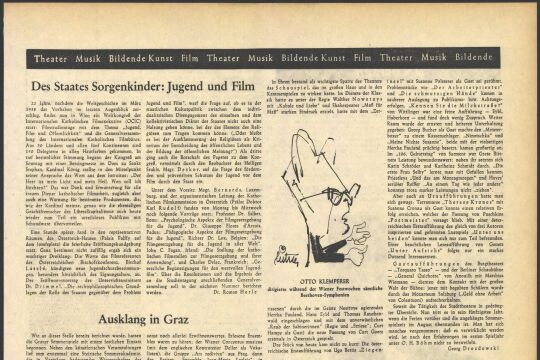Claus Peymanns Rückkehr an die Burg: Seine Inszenierung von Shakespeares „Richard II.“ lässt trotz unbestreitbarer Qualitäten seltsam kalt.
Standing ovations waren schon lange nicht mehr im Burgtheater zu sehen und hören, doch nach der Wiener Premiere von „Richard II.“ schien es fast wie in alten Zeiten: Claus Peymann kam mit Langzeit-Dramaturgin Jutta Ferbers auf die Burgtheater-Bühne, und der Applaus hob gewaltig an. Wobei der tosende Zuspruch eher Altmeister Peymann als seiner Inszenierung galt, denn Peymann hatte während seiner Direktion (1986–1999) das Haus stets ins Zentrum des Medieninteresses gerückt und selbst zu quasi allen gesellschaftspolitischen Fragen seine Meinung kundgetan – auch dann, wenn sie gar nicht gefragt war. Jedenfalls war unter Peymann das Burgtheater nicht nur künstlerisch tonangebend, sondern auch ein Theater, das kulturpolitisch Verantwortung übernahm. Er behauptete die Funktion des Burgtheaters als Nationalbühne wie kein anderer Intendant in den letzten Jahrzehnten, und dies dankte ihm das Publikum letzten Samstag auf bewegende Weise.
Zitat der 1980er-Avantgarde
Seine Inszenierung – eine Übernahme des Berliner Ensembles (BE), die bereits im Jahr 2000 Premiere hatte – wirkte hingegen wie ein Zitat der 1980er-Avantgarde. Sowohl Achim Freyers Bühne als auch Maria-Elena Amos’ Kostüme sind streng in Schwarzweiß gehalten: die guten Buben freilich weiß, die bösen schwarz. Die kahle, kubistisch wirkende Bühne sieht wie ein Domino-Spiel aus, und so funktioniert auch das Drama: Wenn ein Steinchen fällt, dann kippen die anderen zwangsläufig mit. Auch die Protagonisten sind nichts anderes als Figuren in einem Spiel, deren Geschicke die Himmelsmächte, aber noch mehr die handelnden Personen in ihrer Machtgier lenken. Sie sind allesamt weiß geschminkt, und mit ihren schwarzen Mündern wirken ihre maskenartigen Gesichter wie verzweifelte Fratzen.
In der Titelrolle ist der derzeitige Hauptfiguren-Abonnent Michael Maertens zu sehen; unter Hartmanns Direktion spielt er fast alle tragenden Rollen. Auch als charakter- und entscheidungsschwacher König Richard bringt er Leben und einen echten Ton in eine Inszenierung, in der vieles konstruiert wirkt. Freilich handelt es sich bei der mehrfach ausgezeichneten Aufführung um eine handwerklich exzellente Arbeit, in der Peymann den Konflikt ins Heute übersetzt: Heuchelei und Speichelleckerei, Demagogie und Populismus nimmt er unter die Lupe der Gegenwart und verwendet dafür nicht zufällig Thomas Braschs Übersetzung. Brasch, in Yorkshire (England) geboren und der DDR aufgewachsen, gilt als wichtiger deutscher Dramatiker und Shakespeare-Übersetzer. Er bringt die Sprache des Volkes und der Macht auf den Punkt und desavouiert die Sprache der Macht und Lüge. Zugleich kokettiert er mit den Shakespeare’schen Reimen.
Peymann wiederum betont allzu sehr die Aussagekraft dieser metaphernreichen Sprache, als hätte er plötzlich Angst bekommen, dass man ihn in Wien nach elf Jahren Absenz nicht mehr verstehen könnte. Plakativ demonstriert er den Zorn der Bevölkerung, etwa wenn sie Dreck nach dem abgesetzten König Richard und Königin Isabel (Dorothee Hartinger) wirft; zu dick legt er auch die Gärtnerszene an, in der er mittels Gartenschlauch-Lazzi Komik erzwingt.
Doppelter sentimentaler Rückblick
Richards Widersacher ist sein Cousin Bolingbroke, welchen Richard in die Verbannung schickt, womit sich spätere Rache und Putsch im ersten Akt ankündigen. Den Bolingbroke spielt Veit Schubert klassisch im DDR-Stil, möchte man sagen, also höchst distanziert. Er stellt die Figur aus, wodurch sie im Zusammenspiel mit Maertens seltsam hohl wirkt. Auch BE-Alt-Star Manfred Karge als Herzog von York – bei Peymann ein übler Hinterzimmer-Macchiavelli – ist mit schwarzweiß gestreiften Hosen ein skrupelloser Clown der Geschichte, während sich Maria Happel in den Herzoginnen-Rollen und als lustige Nonne ihr Profil erkämpft, ebenso wie Martin Schwab als sterbender Herzog von Gant. Schwab wurde – wie einige andere – neu besetzt, die Bühne der Burg angepasst, aber dennoch bleibt dieses ohnehin handlungsarme Königsdrama seltsam kalt – fast wie ein schönes, interessantes Bild aus fernen Zeiten. Die Begeisterung der Zuschauer galt wohl auch dem Wiedererkennen einer vertrauten Ästhetik, und wenn Markus Meyer als Cousin Aumerle „Richard II. forever“ an die weißen Wände sprüht, dann trauert er einer Herrschaft nach, die definitiv vorbei ist.
Und auch wenn Peymanns Wiener Zeit längst vorbei ist, machte der Premierenapplaus nicht nur den Respekt der Zuschauer vor seinen Leistungen deutlich, sondern bedeutete zugleich einen sentimentalen Rückblick auf jene Zeiten, in denen das Burgtheater noch Tagesgespräch war.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!