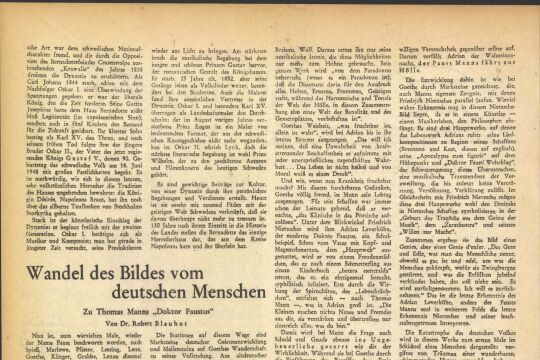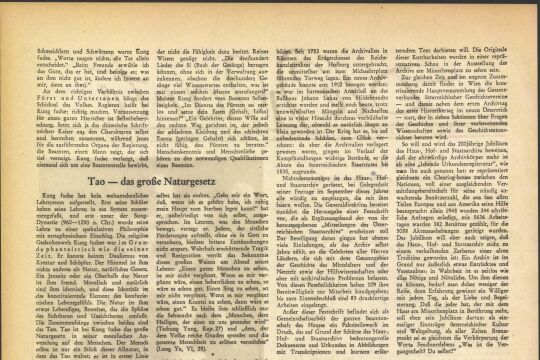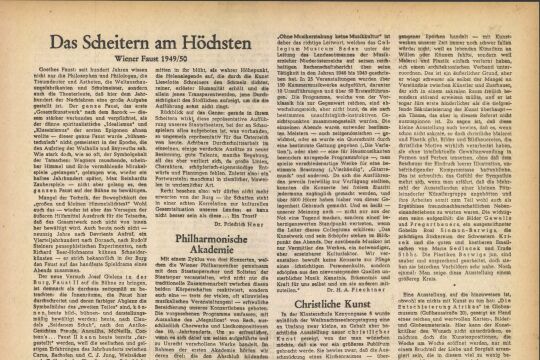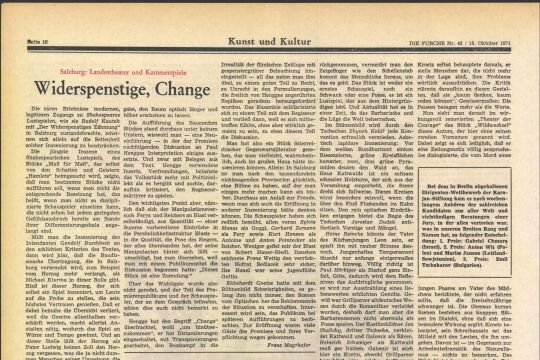Ein Medienhype sondergleichen: Der neue Hausherr des Burgtheaters, Matthias Hartmann, inszeniert beide Teile von Goethes „Faust“ an einem Abend. Der Tragödie erster Teil präsentiert sich konventionell, der Tragödie zweiter Teil zeitgeistig. Die internationale Presse ist von dem Premierenabend wenig begeistert, das Wiener Publikum schon eher.
Der neue Hausherr des Wiener Burgtheaters ist ein Mann der starken Sprüche. So ließ Matthias Hartmann in einem der zahlreichen Interviews im Vorfeld der Eröffnung verlauten, „ein großes Theater wolle nun mal groß eröffnet werden“. Und da schien ihm das bekannteste aller deutschen Dramen, nämlich Goethes „Faust“ in einer integralen Fassung mit über 12.000 Versen, für die größte und – wie man vor allem hierzulande überzeugt ist – wichtigste deutschsprachige Bühne gerade gut genug. Zudem wurde der „Faust“ im Haus am Ring das letzte Mal vor mehr als drei Jahrzehnten gespielt, der Tragödie erster und zweiter Teil gemeinsam noch überhaupt nie.
Nun, diese Eröffnung, die im Vorfeld zum Medienhype sondergleichen avancierte, war weniger groß als lang, obwohl sich der neue Burgherr gerade da ausnahmsweise fast bescheiden gab. Mit beinahe sieben Stunden, inklusive zweier Pausen, brauchte er für seinen „ganzen“ „Faust“ nur gerade ein Drittel der Zeit, die Peter Stein für seinen „Faust“-Marathon anlässlich der Expo in Hannover den Zuschauern abverlangt hatte.
Eigentlich wollte Hartmann bei seinem Einstand als inszenierender Direktor alles richtig machen. Daher inszenierte er die beiden Teile, wie er sagte, ganz bewusst mit zwei verschiedenen Ästhetiken. Das ist grundsätzlich nicht ungeschickt, denn erstens konnte er damit eine Vielfalt und seine Möglichkeiten andeuten, und zweitens war damit für fast jeden Geschmack was dabei.
Hübsche Ideen ohne analytische Tiefe
Der Tragödie ersten Teil inszeniert er konventionell, gefällig, mit manch hübschen szenischen Ideen, einigen Bühnentricks, aber leider ohne analytische Tiefe, ohne Idee für das Ganze des Stücks, obwohl er auf die Publikumslieblinge Tobias Moretti in der Rolle des Faust und Gert Voss – seit den guten, schlimmen Peymann-Zeiten der Star des Hauses – als Mephistopheles zählen konnte. Der Beginn ist noch durchaus vielversprechend: Nach dem „Vorspiel auf dem Theater“, bei dem sich Ignaz Kirchner als Direktor und Voss als Dichter ein heftig-komisches Wortgefecht darüber liefern, was man dem Publikum bieten müsse, und das selbstironisch in eine bestens bekannte Beschimpfung à la Bernhard („Stadttheater! Scheißtheater! Burgtheater!“) mündet, folgt vor einem Brecht-Vorhang mit der Aufschrift „Himmel“ ein witzig abgehandelter Metaphysik-Diskurs. Doch als weit hinten im Bühnendunkel der kahlgeschorene Moretti als Faust, nur vom Bildschirmlicht seines Macs beleuchtet, endlich zu seinem berühmten Habe-doch-ach-Philosophie-Monolog ansetzt, dämmert einem schon, dass dieser Faust vielleicht zu leicht sein würde. Denn der leise nuschelnde Moretti mit seiner Nickelbrille scheint wenig verzweifelt, kaum besessen und viel zu höflich zu sein für jemanden, der um jeden Preis wissen will, was die Welt im Innersten zusammenhält, der bereit wäre, für den schönen Augenblick, wenn er nur ewig währte, zur Hölle zu fahren. Dieser Faust ist kein vom wilden Trieb zur Erkenntnis Gejagter, sondern ein Fäustchen, ein farbloser Bürokrat, ein Mann ohne Eigenschaften. Als in der Pudel-Szene Voss’ Mephistopheles mit blutiger Zunge seinen ersten großen Auftritt hat, wird schlagend klar, dass Moretti keine Chance haben würde. Voss spielt, wie man ihn kennt: Er gibt den Mephistopheles facettenreich als tuntigen Galan mit phallischer Fasanenfeder am Zigeunerkäppi, als geilen Gigolo im Muskelhemdchen, als teuflischen Existenzclown oder als eloquenten, diabolischen Verführer.
Auf der von Volker Hintermeier eingerichteten Bühne zaubert Mephisto meist von Nebelschwaden halb verdeckte Kuben hervor, die sich auf offener Bühne vom kleinen Kästchen zum riesigen Kubus wandeln und die geschickt für die vielen Schauplatzwechsel genutzt werden – für Auerbachs Keller in Leipzig, die Hexenküche, Marthes Kleinbürgerstube oder die Walpurgisnacht.
Der als unspielbar geltende zweite Teil der Tragödie ist bei Hartmann eine zeitgeistige Videoinstallation mit Live-Cam und -Musik. Für dieses bühnentechnisch aufwendige Bildertheater wechselt Hartmann fast das gesamte Personal aus. Publikumslieblinge wie etwa Joachim Meyerhoff (meist) als Mephisto oder Caroline Peters unter anderem als Helena tragen den auf recht gnädige und dennoch zu lange zwei Stunden zusammengestrichenen Text in deklamatorischem Ton vor, wobei die vielen flinken Rollenwechsel und das meist kollektive Herunterlesen der Regieanweisungen nicht eben für ein besseres Verständnis der doch etwas kruden Gedanken des alten Geheimrats Goethe sorgen.
Die beiden Teile sind überhaupt nicht miteinander verbunden, weder was das Personal betrifft, noch was die Ästhetik betrifft. Gemeinsam ist ihnen nur eine gewisse Rat- oder Ideenlosigkeit, das Fehlen des interpretatorischen Zugriffs.
Man fragt sich, warum Hartmann die beiden Teile zusammen gezeigt hat, und kann nur eine Antwort geben: Diese Idee ist dem Hang zum Spektakel geschuldet, der Eventisierung der Eröffnung. Die allerdings ist geglückt: Schon lange hat man nicht mehr so viele Medienvertreter und Prominente auf der Bühne wie im Parkett sehen können, was auch dem ORF einen Themenabend wert war. Der Staatsfunk berichtete live aus dem Burgtheater („Faust. Geballt“) und sogar das Schweizer Fernsehen war mit einem Korrespondenten vor Ort, um den Start des ehemaligen, zuletzt eher ungeliebten Direktors des Zürcher Schauspielhauses zu verfolgen und in die Eidgenossenschaft zu senden.
Niederschmetternde Urteile
Obwohl die Wiener ihrem neuen Burgherrn mehrheitlich eher freundlichen aber doch enden wollenden Beifall spendeten, fiel das Urteil der internationalen Presse niederschmetternd aus. Die Neue Zürcher Zeitung beispielsweise sah in Hartmanns Eröffnungspremiere eine freie Reader’s-Digest-Bearbeitung mit dem „Best of“ Hartmannscher Regieeinfälle. Es mangle ihm nämlich an einer Idee, und so verkomme „Faust I“ zu einer in Kästchen verpackten Folge von Häppchen und Gags, während sich der „Faust II“ in Bilderfluten auflöse. Das böse Fazit: Hartmanns Inszenierung gleiche einem Chaos in progress, oder anders gesagt: Sie sei Augenauswischerei. Auch die Süddeutsche Zeitung beurteilte „Faust I“ ähnlich deutlich: Konzeptuell und intellektuell sei dieser ein Armutszeugnis, während das Urteil über Teil 2 etwas milder ausfällt: der Kontinent Faust würde hier nicht urbar gemacht, aber immerhin ein Ufer erreicht.
Auch die Frankfurter Allgemeine ist der Meinung, Hartmann habe vor Goethe versagt und beklagt ebenfalls die gedanklichen Untiefen: man sehe keine Gedankenlüstlinge, nur lauter Leerläufe, die ihren schnöde zusammengekürzten Versen verzweifelt hinterherklappern. Im zweiten Teil werde vor Goethes allegorischer Phantasie und Fülle aufs kläglichste kapituliert. Es sei, als hätte der Zahn der Zeit, den ihre moderne Kostümierung nahelegt, diese Aufführung bis auf die ödesten Banalknochen geist- und sinnfrei abgenagt.
Etwas milder urteilt die Frankfurter Rundschau, die Hartmann vorhält, eine einfache, publikumsfreundliche Fassung des schwergewichtigen Versmonuments gewollt zu haben – und dabei könne das Einfache eben leicht ins Einfältige zusammenklappen. Das sei der Spieleinsatz, der nun eben zunächst mal verloren gegangen sei.
Gert Voss
gibt einen facettenreichen Mephistopheles (o.r.): als tuntigen Galan, geilen Gigolo, teuflischen Existenz-Clown oder eleoquenten, diabolischen Verführer.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!