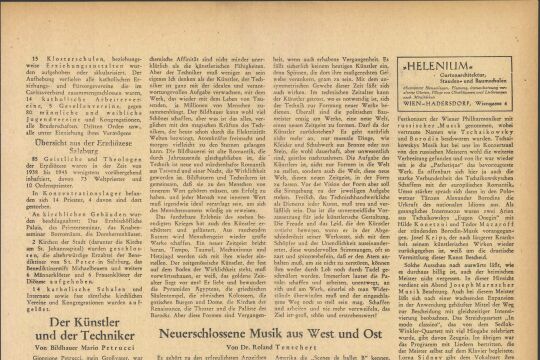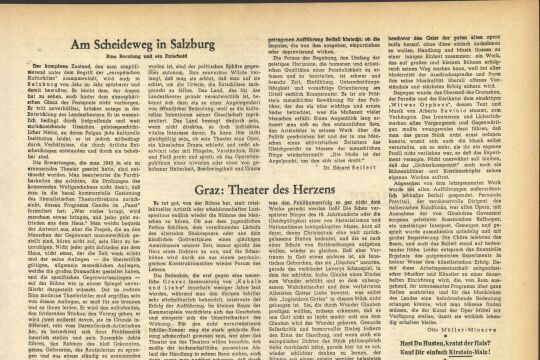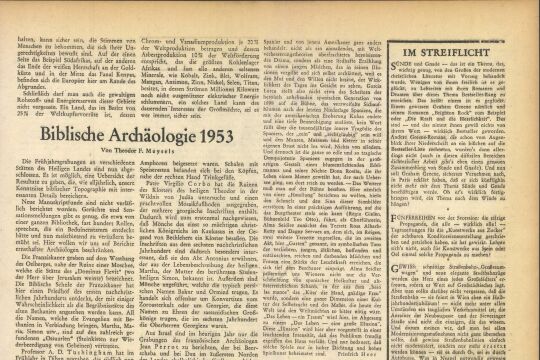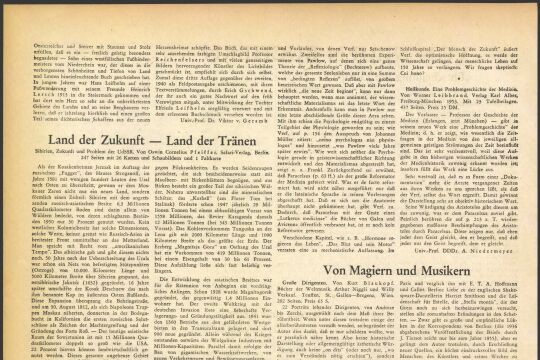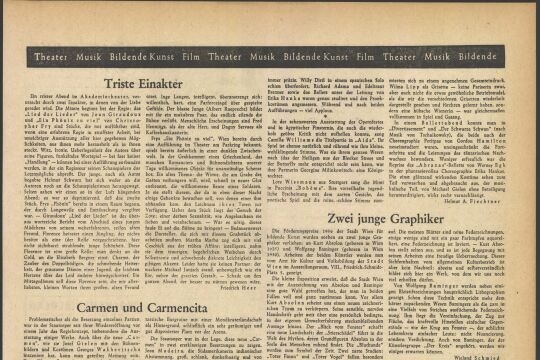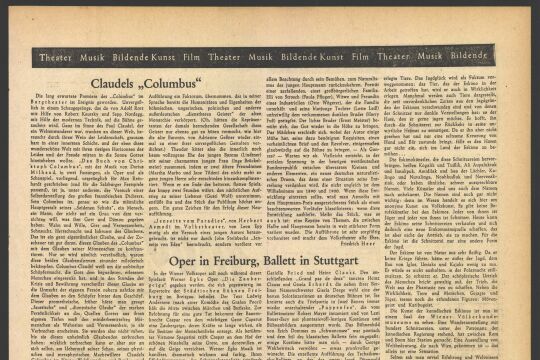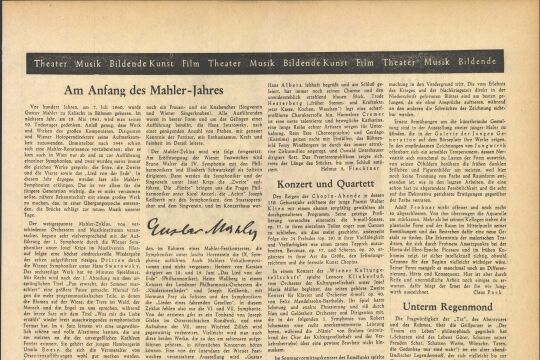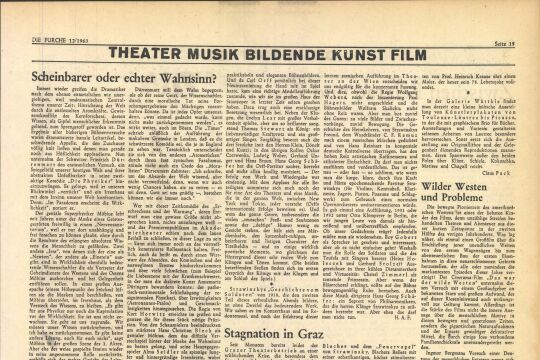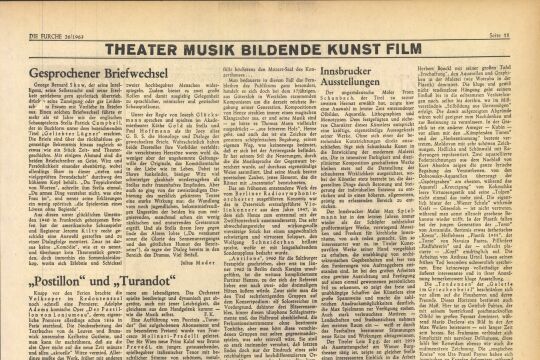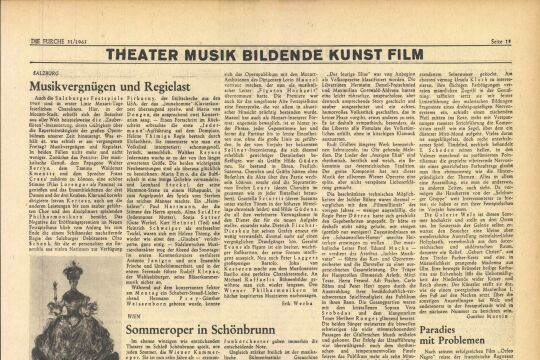Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Margarethe wurde nicht gerettet
In der Staatsoper fand am vergangenen Samstag die Premiere von Charles G o u n o d s Oper „F a u s t“ statt, die man an deutschsprachigen Bühnen unter dem Namen „M argarethe“ zu geben pflegt. Man spielte Gounods Werk ungekürzt in der Originalsprache und stellte für eine zweite Premiere eine volle zweite Besetzung bereit: eine Sorgsamkeit der Betreuung, wie sie an der Wiener Staatsoper bisher kaum einem Wetk der gesamten Opernliteratur zuteil geworden ist. Man war also recht gespannt, wie sich diese Faust-Renaissance anlassen würde und gab sich, besonders im Hinblick auf den französischen Dirigenten, den aus Paris kommenden Bühnenbildner und den berühmten Basler Gastchoreographen, den schönsten Hoffnungen hin. Diese wurden, das sei gleich vorweggenommen, arg enttäuscht. Die Wienet Staatsoper aber ist um eine schlechte Neuinszenierung reicher.
Nach jeder „Margarethe“-Premiere ist es üblich, daß sich die Kritik mit der Frage befaßt, ob das Libretto von Barbier und Carre überhaupt füt ein deutsches Publikum „tragbar“ sei. Der gute Rat, der einem von Verteidigern dieser „Faust“-Veroperung erteilt witd (unter denen sich natürlich auch der unfehlbare Hanslick befindet), lautet seit 100 Jahren, da6 man beim Anschauen und Anhören von Gounods Oper überhaupt nicht an Goethei Dichtung denken möge. Das ist leichter gesagt als getan beziehungsweise nicht getan. Dies Problem soll und kann aber hier vor allem deshalb nicht diskutiert werden, weil die Wiener Aufführung keinerlei emsthafte und solide Grundlage für eine solche Erörterung bietet. Ein in diese Richtung zielendes Stteitgespräch könnte sich nur an einem „Faust“ entzünden, der als große Oper, mit allem Drum und Dran, inszeniert wurde, oder aber an einem Versuch, durch eine moderne Regie und entsprechende Bühnenbilder Gounods „Faust“ für die Gegenwart zu retten.
Ein solcher Versuch wurde aber von Paul Hager als Spielleiter und von Jean-Pierre P o n e 11 e als Bühnenbildner leider nicht unternommen. Was wir sahen, war das Resultat von Unentschlossenheit und Hilflosigkeit; Unentschlossenheit in bezug auf den Gesamtstil, Hilflosigkeit und Dilettantismus in unzähligen Einzelheiten der Inszenierung. — Das erste Bild: ein weiträumiges Laboratorium, wo allerlei Gerät von der offenen Decke herabhing, eine Art Zauberkabinett wie aus „Hoffmanns Erzählungen“. Das zweite Bild: ein turbulentes Volksmaskenfest auf überfülltem offenen).Platz,.im Hintergrund eine phantastische Waldgebirgslandschaft mit sechs winzig kleinen Burgen darin — wie von Dali gemalt. Drittens: ein sehr konventionelles Gartenbild mit niedrigem Laubengang, links ein altdeutsches Bürgerhaus mit Söller, in dessen Fenster Margarethe erscheint und wohin sie Faust, nach Mephistos dämonischer Nachtbeschwö-rung einlädt. Der gemalte Hintergrund: eine Art Alt-Nürnberg. Hierauf, stilistisch einheitlich, wenn auch konventionell-realistisch: das Innere des Doms, eindrucksvoll in seiner düsteren Pracht. Aber was da der Teufel, das arme Gretchen bedrängend, treibt, grenzt ans Komische.
Schon zu Beginn, als Mephisto in Fausts Stube plötzlich auf den Tisch springt, und wen» wenig später Margarethe — eine Vision, ein Teufelsspuk I — in persona im Hintergrund erscheint, kamen einem Zweifel am Ernst des Regiekonzepts. Sie verstärkten sich im Lauf des durch drei Pausen (von insgesamt etwa einer Stunde Dauer) auf ärgerliche Weise verlängerten langen Abends. So kam es. daß eine sonst gefürchtete Szene — das auf dem Brocken beginnende, alsbald in einen großen Saal mit düster schwelenden Lichtern verlegte Bacchanal — zu einer wahren Erholung und Augenweide wurde. Wir danken sie dem Gastchoreographen Wazlaw Orlikowsky, der hier, zu sieben wirkungsvollen Musik-nummern Gounods, seine Kunst (und die des Wiener Opernballetts) zeigen und seine Phantasie spielen lassen konnte & womit er sich den wohlverdienten und langanhaltenden Applaus des überaus geduldigen Premierenpublikums holte. Schließlich die Kerkerszene, ohne nennenswerte Malheurs, ganz auf das ausdrucksvolle Spiel und den makellosen Gesang Wilma Lipps gestellt — da konnte nichts schiefgehen. Alle anderen Sänger, einschließlich des Chores — in der doppelten Zwangsjacke der Regie und der französischen Sprache —, waren nicht zu beneiden, wenn auch immer wieder zu bewundern: Waldemar Knien tt als Faust, Eberhard Wächter (der sich die meiste Freiheit nahm) als Valentin, Hermann U h d e (der für den erkrankten Nicolai Gjaurov einsprang) als Mephistopheles, Ludwig W e 11 e r als Brander sowie die Damen M i 1 j a k o v i c und Rössel-M a j d an.
Die Musik .Gounods lag bei i «einem Landsmann Georges P r i.t r e in ebenso sicheren wie sensiblen Händen. Das Vorspiel, bevor der desillusionierende Bühnenzauber losgeht, erweckte die schönsten Erwartungen. Was für ein gewandter, eleganter, treffsicherer — zuweilen auch feiner — Musiker ist doch dieser Herr Gounodl —, zu dessen sehr französischer Kunst sich so wählerische jüngere Kollegen wie Debussy. Ravel, Poulenc, Mil-haud und Strawinsky bekannt haben. Aber da man nicht in die Oper geht, um Musik mit geschlossenen Augen zu hören, müssen wir zusammenfassend konstatieren, daß diese Neuinszenierung eine arge Entgleisung war. Und gerade für sie hat man eine der ersten durchaus gleichwertige zweite Besetzung vorgesehen (die Damen Güden, Höngen und Dutoit sowie die Herren Zampierei, Uhde, Pascalis und Pcrnerstorfer).
Ohne nach dem Kadi zu rufen — was man in Kunstdingen nicht tun soll —, erhebt sich doch die Frage nach der Verantwortlichkeit für solche kostspielige Pleiten. Hoffentlich war es die letzte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!