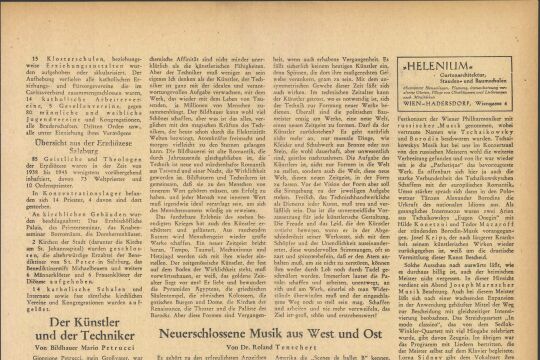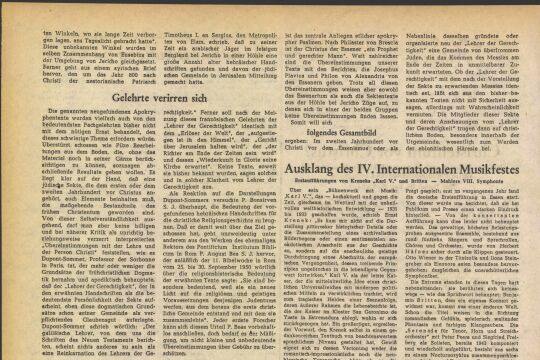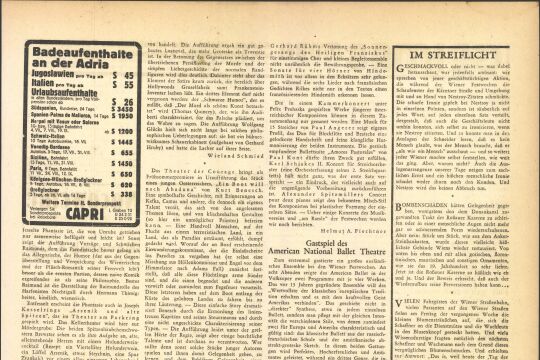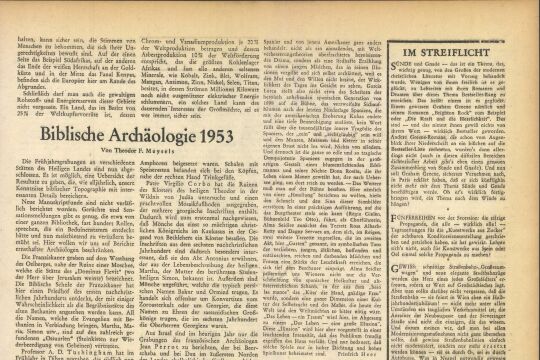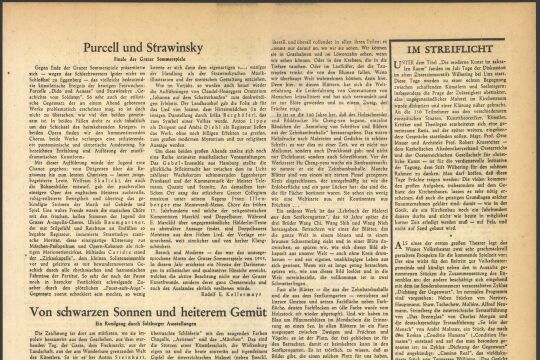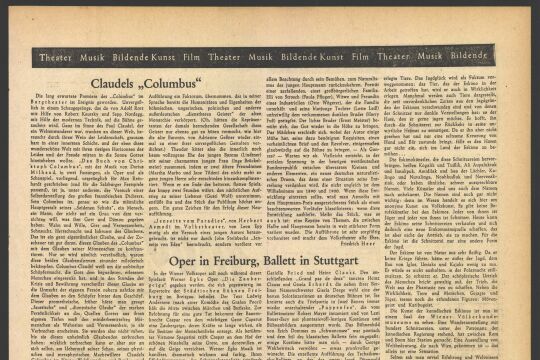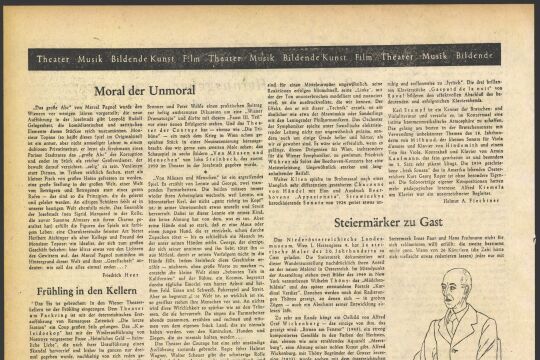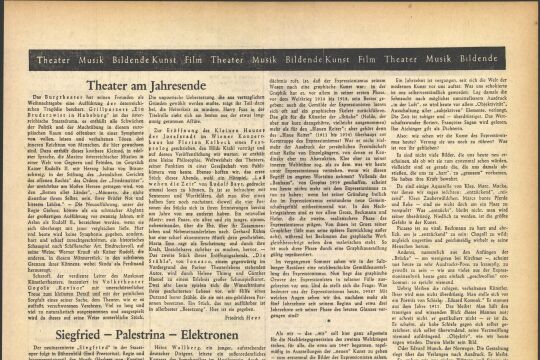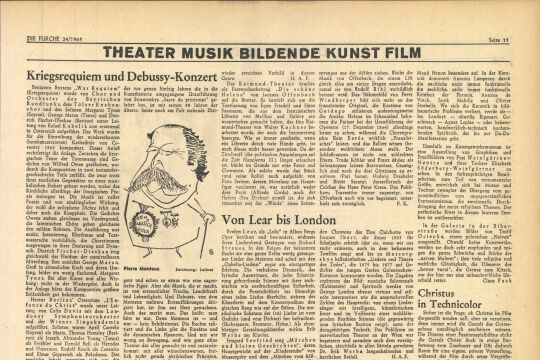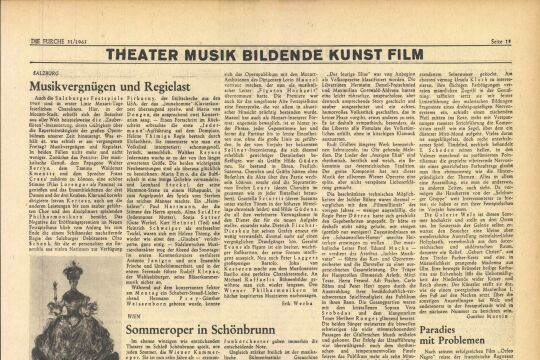Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Kluge und der Soldat
Carl Orffs Geschichte von dem König und der klugen Frau sahen wir zuletzt vor zehn Jahren in der Volksoper. Damals war „Die Kluge“ erst zehn Jahre alt, und man kann nicht behaupten, daß sie heute, als Zwanzigjährige, an Reiz verloren hätte. Höchstens am Reiz der Neuheit und ihrer so unverbindlich-vernünftigen Sentenzen, die damals. Anno 1943, als Anzüglichkeiten wirkten. Diese Bilderbogenhistorie von der klugen Bauem-tochter, die ihren Vater aus dem Gefängnis befreit, einem Übervorteilten zu seinem Eselsfüllen verhilft und dabei selbst zu einem königlichen Gemahl kommt, wurde von dem jungen Grazer Regisseur Wolfgang Weber inszeniert und von dem Grazer Bühnenbildner Wolfram S k a-1 i c k i (unseren Lesern aus zahlreichen Berichten unseres ständigen Grazer Korrespondenten bekannt) mit Requisiten, Prospekten und Kostümen ausgestattet: sehr hübschen, märchenhaften und zugleich „standesgemäßen“ Kostümen sowie praktikabeln und eleganten Bühnenbildern. Und da Carl O r f f persönlich bei dieser Neuinszenierung die Hand mit im Spiel hatte, kam eine richtige Modellaufführung zustande, wie wir sie im großen Haus der Staatsoper in letzter Zeit selten gesehen haben. Dazu trug auch eine erstklassige Besetzung wesentlich bei. Neben der Klugen, die Evelyn Lear mit großer Verhaltenheit spielte, aber um so brillanter sang, stand Thomas Stewart als König: ein liebenswürdiger Kraftprotz und ein großartiger Sänger. Sorgfältig besetzt auch die drei Strolche (mit den Herren Klein, Döncfa und Kunz); in den übrigen Rollen Oskar Czerwenka, Ludwig Weber, Gerhard Un-ger und Hans Braun. Hans Georg Schäfer hat die Orff-Partitur sauber, korrekt und nicht allzu knallig musiziert. — Der Erfolg von Werk und Wiedergabe war eindeutig. Mit dem Applaus für alle Beteiligten summierte sich auch noch der für eine Art des Theaters und eine Musik, die in der ganzen Welt, zwischen New York und Tokio, jeder versteht (Orffs internationale Erfolge beweisen es). Und wem das ganze Genre, insbesondere die vielen „teutschen“ Freß- und Saufszenen sowie der „deftige“ Humor wenig zu Gesicht stehen, der hält sich ans Märchenhafte, den katzenhaft-ruhigen, unbeirrbaren und listigen Charakter der Titelheldin — und an einige wirklich poetische Momente, wo gleichsam der Hintergrund dieser sehr realen Welt zum Klingen und Tönen kommt. (Die beiden betreffenden Stellen finden sich im ersten Gespräch des Königs mit der Klugen und am Schluß des Spiels.)
Strawinskys„Geschichte vom Soldaten“ von 1918, die den zweiten Teil dieses erfreulichen Abends bildete, ist ohne Zweifel das bedeutendere Werk. Wir sahen es im Konzerthaus und im Re-doutensaal, und nach der Erfahrung dieser letzten szenischen Aufführung im Theater an der Wien entscheiden wir uns endgültig für die konzertante Fassung. Und dies, obwohl die Regie Wolfgang Webers, nach der Inszenierung Paul H a g e r s, nicht ungeschickt und die Bühnenbilder Wolfram Skalickis nicht ohne Reiz waren. Aber man bot zuviel des Guten: zu viele Bilder und Zwischenvorhänge, zuviel Bewegung. Die Geschichte des Heimkehrers, von Strawinskys Freund, dem Waadtländer C. F. R a m u z nach einem russischen Märchen gedichtet und von Hans Reinhart in kongeniale deutsche Knittelverse übertragen, hat den hohen Reiz artistischen Raffinements und stilisierter Einfachheit. Da darf man nichts ausführen und verdeutlichen. Das ist genau — oder fast — so schlimm, wie wenn man die karge, klare, durch ihre Kraft und Härte epochemachende Partitur Strawinskys (für Violine, Kontrabaß, Klarinette, Fagott, Piston, Posaune und Schlagwerk) zum Gebrauch eines normalen Opernorchesters uminstrumentieren würde. Es gab einmal eine Aufführung, 1931 oder 1932 unter Otto Klemperer in Berlin, die wir jungen Leute von damals als hinreißend und unübertrefflich empfanden. Ob unser Gedächtnis trügt? jedenfalls müßte man sie wiedersehen. Boy G o b e r t als Sprecher ist gescheit und interessant, aber ob es nicht einfacher geht? Weshalb man die Rolle des Soldaten und die des Teufels mit Sängern besetzt (Heinz H o-1 e c z e k und Gerhard Stolze)? Ausgezeichnet in ihrer kühlen Distanziertheit und Virtuosität: Christi Zimmerl als tanzende Prinzessin. Aber wenn der Bläserchoral erklingt, sollte auf der Bühne bewegungsmäßig Ruhe herrschen. Auch diese Musik dirigierte Hans Georg Schäfer: ein Septett von Philharmonikern, das die harten Klänge Strawinskys zu mildern bestrebt war. Aber eben das darf man nicht tun.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!