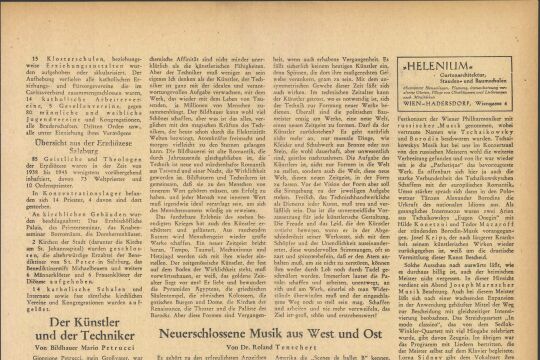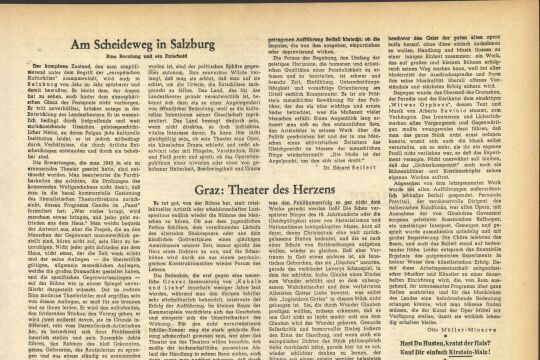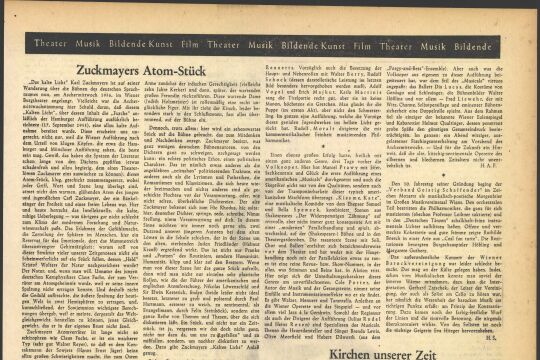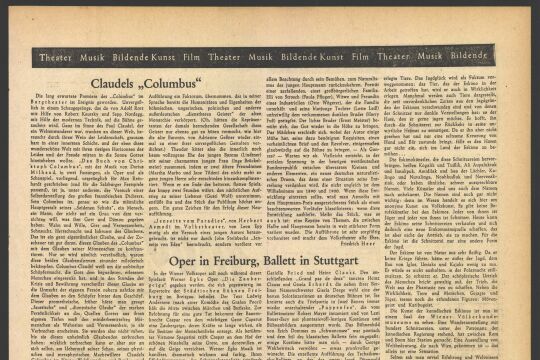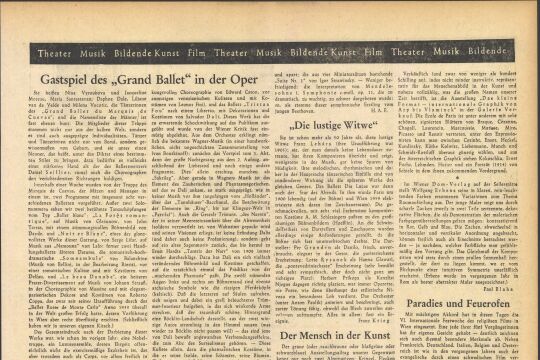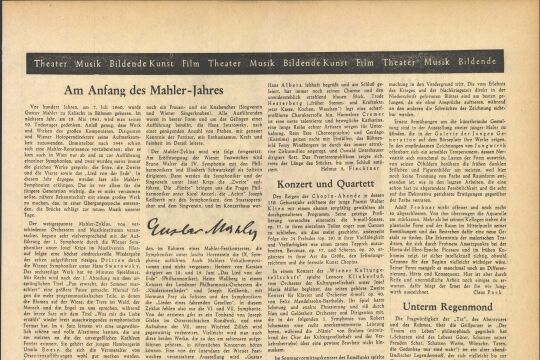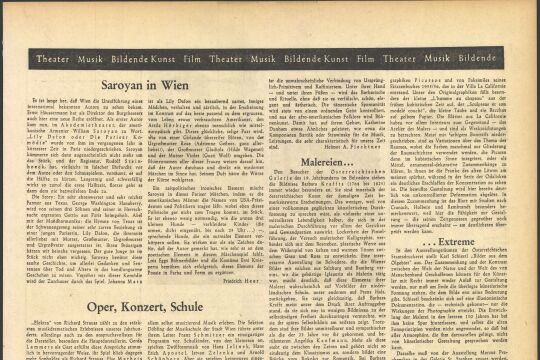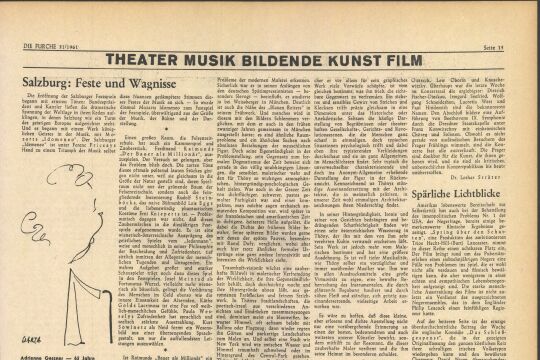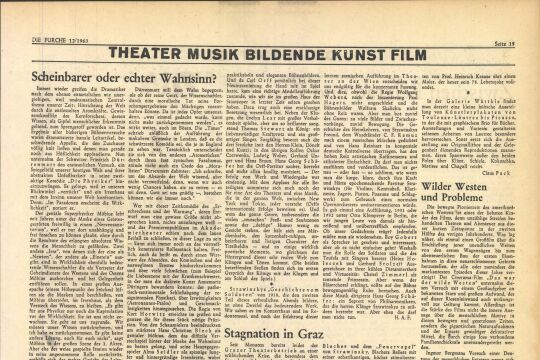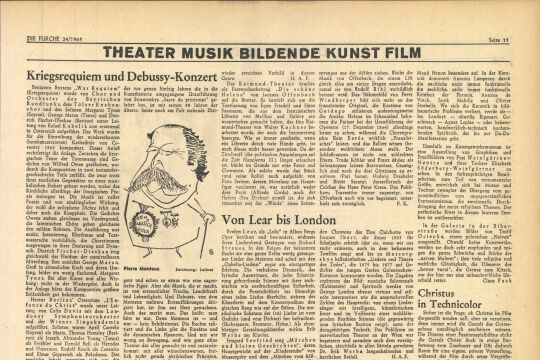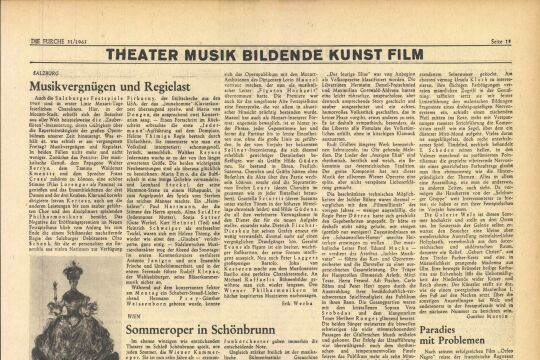Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Grobes Ballett und Ein-Mann-Pantomime
„Dem einen ist es gegeben, von der Liebe des Romeo und der Julia zu singen, dem andern, das wilde Brüllen und die albernen Verrenkungen von Affen zu schildern“, so schrieb der sowjetische Kritiker Kolomytsew Anno 1916 nach der Aufführung von Sergei Prokofieffs „Skythischer Suite“. Die Liebe der beiden jungen Veroneser-Kinder hatte Tschai-kowsky in seiner „phantastischen Ouvertüre“ gesungen; aber 20 Jahre später griff auch P r o-k o f i e f f nach dem Stoff. Der damals schon weltberühmte Komponist war 1934 zum zweitenmal — und endgültig — zu Mütterchen Rußland zurückgekehrt, denn er war zu der Überzeugung gelr.ngt, „der Künstler sollte nicht fern seiner heimatlichen Quellen herumschweifen“. Im Jahr darauf schrieb Prokofieff die große, etwa 100 Minuten dauernde BaJIettjnusik^ nach., Shakespeares „Romeo und Julia“ und .stellte in den folgenden Jahren zur nächst drei Orchestersuiten daraus zusammen. Die Uraufführung des ganzen Werkes fand erst 1940 im Kirow-Theater in Leningrad statt, und zwar nach Überwindung beträchtlicher Schwierigkeiten. Galina Ulanowa, die erste Julia, beklagte sich über „Unerwartetes, Ungewohntes, für den ^Tanz Unbequemes“ in Prokofieffs Musik. Besonders der häufige Wechsel des Rhythmus behindere die Tänzer. „Kein herb'res Los gibt's, möcht' ich wetten, als die Musik Prokofieffs in Balletten“, so lautete der Trinkspruch nach der . trotz allem erfolgreichen Leningrader Premiere. — Nach dem, was unsere westlichen Zeitgenossen, etwa ein Fortner, Henze oder Strawinsky (mit der vertrackten „Agon“-Parti-tur) den Tänzern zumuten, können uns solche Klagen nur ein Lächeln entlocken. Prokofieff hatte nicht umsonst dem Westlichen Formalismus abgeschworen und erklärt: „Ich werde nach einer klaren musikalischen Sprache suchen, die meinem Volke verständlich und lieb ist.“ — Diese Sprache hat er in der Tat gefunden (nicht nur in dieser Partitur), und sein einst umstrittenes „Romeo-und-Julia“-Ballett ist heute gewissermaßen staatsrepräsentativ und wird unweigerlich den ausländischen Ehrengästen, sei es in Moskau oder in Leningrad, vorgeführt.
Prokofieffs Musik ist melodisch, rhythmisch prägnant, abwechslungsreich, farbig und fast durchweg gestisch empfunden. Sie hält im ganzen ein gutes Niveau, ohne sich freilich zu Höhepunkten aufzuschwingen. Sie entspricht durchaus dem Libretto Lawrowskis, der aus dem Stoff eine breitangelegte, echt russisch-epische Geschichte gemacht hat. Die Wiener S t a a t s o p e r brachte dieses Werk nach langer — allzu langer! — Premierenpause heraus und gab damit dem für uns immer noch neuen Ballettmeister Dimitrije P a r 1 i c eine Chance. (Wir hatten bisher selten genug Gelegenheit, seine wirklichen Fähigkeiten kennenzulernen!) Partie hat die eher umfangreiche als schwierige und artistische Aufgabe zufriedenstellend bewältigen können, zumal ihm das Werk wohlvertraut ist. (Wir sahen es zuletzt vor etwa drei Jahren unter seiner Leitung mit dem Belgrader Ensemble in der Volksoper.) Im Stil verbinden sich Elemente des klassischen Tanzes mit denen des Handlungsballetts, der Pantomime. Die Gruppen, das Corps de ballet, schienen uns besser geführt als die einzelnen Hauptrollenträger, und obwohl die Musik im letzten Teil (wenn Julia den Schlaftrunk nimmt, vor der Gruft der Capulets) ausdrucksvoller wird, kann von besonders intensiven Momenten, die der Choreographie zu danken sind, kaum gesprochen werden. Und dies, obwohl die Hauptpartien mit durchweg jungen Tänzern sehr gut besetzt waren: Edeltraut B rexner ist als -Julia anmutig und ausdrucksvoll und sieht aus, wie einem Bild von Botticelli entstiegen, Richard A d a m a, seinem Typus durch pechschwarzes Haar entfremdet, ist ein echter junger Edelmann, der freilich durch seinen Freund Mercutio (Paul V o n d r a k, der sich als hervorragender Ausdruckstänzer zeigen kann) sowie, durch Tybalt (Willy. D i r 11 : männlich-kraftvoll und virtuos) ein wenig in den Schatten gedrängt wird. Mehrere gut geprobte Fechtszenen sind besonders hervorzuheben. *
Georges Wakhewitsch hat mit den Bühnenbildern und den Kostümen den realistischen Stil des Werkes gut getroffen. Die Kostüme sind schön und farbenprächtig, die gemalten Landschaften manchmal ein wenig allzu gefällig und „typisch italienisch“. Mjchael G i e 1 e n am Dirigentenjjuk^ ljat-^it jienJPhil-harmonikern diese Riesenpartitur ganz ausgezeichnet zum Klingen gebracht und für Exaktheit, dynamische Differenzierung und schöne, kraftvolle Farben gesorgt.
Auf der zwar verkleinerten, aber immer noch sehr großen Bühne der Volksoper stand ein einzelner Mann, Marcel M a r c e a u, und spielte: den Plakatkleber, einen Apachen, Szenen im Cafe und auf einem Ball, zum Schluß „Der Maskenmacher“, eine besonders virtuose Pantomime, bei der Marceau wohl an die 50mal blitzschnell hinter vorgehaltenen Händen den Gesichtsausdruck wechselte. — Marceau spielt „Menschen wie du und ich“, mit ihren Schwächen, ihren Eitelkeiten, Marotten und Sehnsüchten. Er ist ein scharfer, geradezu erbarmungsloser Beobachter, aber ein liebenswürdig-ironisieren-der Darsteller. — Ähnlich wie die von Chaplin mit Vorliebe dargestellte Figur ist Marcel Marceaus BIP ein Wesen, das sich mit den Tücken des Objekts herumschlagen muß, sich gleichzeitig aber eine Scheinwelt erschafft, in der es sich besser lebt.
Mit dieser seiner selbsterfundenen Gestalt reist Marceau nun schon seit 13 Jahren (früher mit einer kleinen Truppe, jetzt mit nur zwei Assistenten) umher und wird in Skandinavien und Japan ebenso verstanden wie in Kanada oder Venezuela. — Der äußere Rahmen: schwarze Vorhänge, ein Phantasiekostüm von unauffälliger Häßlichkeit, zu Beginn jeder Nummer ein paar Takte Musik vom Tonband — dann beginnt Marceau stumm zu spielen. Um so lauter der Beifall.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!