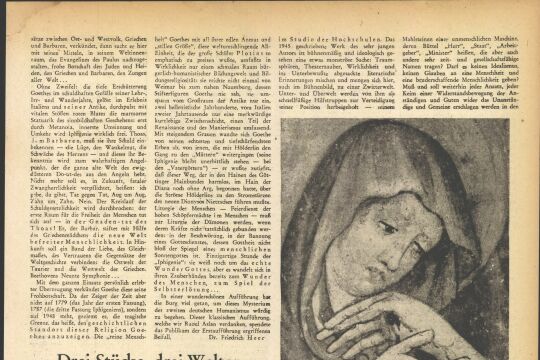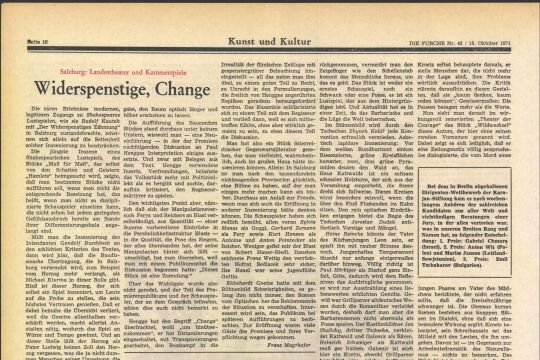Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Obszönität - ein Mode-Muß?
Daß unlängst ein Kritiker der Londoner „Times“ enthusiastisch schrieb: „Im Westberliner Theatertreffen wird die anhaltende Lebenskraft des deutschen Theaters offenbar“, stimmt besonders in der Retrospektive nachdenklich. Sowohl in bezug auf die ausgewählten „bemerkenswerten Inszenierungen deutschsprachiger Bühnen“, wie durch die hartnäckige Beschränkung auf die Bundesrepublik. Leider fehlte wieder einmal Österreich. Das Rahmenprogramm war attraktiv. Da gab es einen „Stückemarkt“ mit Lesungen junger Autoren, lyrische und ironische Songpoesie berühmter Chansonniers der 20er Jahre, Polit-dichtungen, den manieristischen Alleinunterhalter Robert Wilson in abstraktem Zwiegespräch mit seinem alter ego, und Peter Brooks zeigte Jarrys „Ubu“ in französischer Cpmedie-Tur-bulenz. Ein großangelegtes Pantomime-Musik-Tanztheater gipfelte in einem rauschenden nächtlichen Fest in der Akademie mit hervorragenden Kleinkunstdarbietungen. Doch das eigentliche Theatertreffen - brachte es Außergewöhnliches? Rechtfertigte es den Aufwand?
Der Trend, Klassiker modernistisch zu zersetzen, ist mittlerweile ein alter Hut Düsseldorf bleibt da trotz lärmenden Beiwerks mit erfundener Bahnhofsouvertüre und einem angekündigten Expreßzug „Schiller“, mit Festgelage beim Präsidenten, noch wohltuend stabil. Der junge Roland Schäfer inszenierte „Kabale und Liebe“ zwar mit revolutionärem Impetus, führte aber die Personen - trotz gelegentlicher Leerläufe - sensitiv, leidenschaftlich engagiert und durchleuchtete die Liebesszenen mit schwebender Heiterkeit. Claus Peymanns „Iphigenie“ (Stuttgart) mißdeutete
wieder einmal das Barbarenproblem, indem Thoas als Geck in Zylinder und schmuddeligem Frack, mitZigarre und Feuerzeug um den Hals, behängt mit Plunder, Federn und Affenmaske, herumtobte, während Iphigenie im Malerkittel Schiefertafeln mit Wortfetzen bekritzelte und einen Abschiedsbrief auf der Schreibmaschine tippte. Goethes Humanitätsgedanken zerstörten skandierte Wortfetzen. In Wien verlieh schauspielerisches Niveau einer vieldiskutierten Umdeu-tung des Werkes Qualität, was dem laienhaften Stuttgarter Ensemble gänzlich mißlang. Luc Bondys Hamburger „Gespenster“-Darstellung hingegen blieb leise und brütete Verzweiflung zwischen lähmender Stille und grellen Ausbrüchen.
Der Deutschen unbewältigte Vergangenheit' demonstrierte sich in Thomas Braschs „Rotter“ und „Prinz Friedrich von Homburg“. „Rotter“ (Stuttgart, Regie: Christof Nel) zeigte grelle Kollagen: Schweineschlachten detailreich zelebriert, Aufstieg eines dumpfen Träumers durch Stiefeltritte vom Mitläufer zum Anführer beim Kommiß, zum Drangsalierer beim Wiederaufbau nach verlorenem Krieg im Arbeiter- und Bauernstaat. Laichen, Brutalität, familiäres Versagen, Obszönitäten in Worten und Darstellungen, männlicher Striptease, und zwischen Götter- und Geisterdämmerung als Lichtblick vergreiste Kinder, frech, aber bestürzend in ihrer Hellsichtigkeit.
„Homburg“, ein Alptraum auf ständig dunkler, mit Zentnern von Kartoffeln bestreuter Bühne, veranschaulichte Armut und Getretehheit und räumte brutal auf mit Preußens Glanz und Gloria. Karge/Langhoff, die DDR-Regisseure, provozierten mit einem Hamburger Gastspiel: ein eckiger, plumper Anti-Kriegsheld, ein Psychopath, peinlich in seinem tölpelhaften Liebeswerben und in kreischendem, gotterbärmlichen Winseln um sein Leben, steht am Ende splitternackt mit Augenbinde, wollüstig seinen Körper tätschelndr im, Regen und verfällt nach scheinheiliger Rehabilitierung hemmungslosem Irrsinn. Seine marionettenhaften Gegenspieler, eine hysterische Natalie, ein verlogener kahlköpfiger Kurfürst, diese ganzen Popanze von Militärs - sie verschwindeln in schreienden oder flüsternden Passagen Kleist'schen Text. Eine brutale Entstellung mit filmischen Einblenden zerbombter Städte, aber eine konsequente Demonstration zynischen Blut, Schlachtengreuel und Rot-Kreuz-Raum von faszinierender Widerwärtigkeit. In adäquater Besetzung wäre diese Zerstörung Kleist'-scher Ideen sogar vertretbar gewesen.
Einsame Qualitätsmitte hält Peter Stein in seiner Schaubühnen-Inszenierung der „Trilogie des Wiedersehens“ von Botho Strauß. Eine im Hintergrund der ebenerdigen Spielfläche
stattfindende Vernissage ist Anlaß zum Treffen von Menschen verschiedenster Berufe und sozialer Schichtungen. Ihre Seelenkonflikte spulen sich in endlosen Monologen oder hektisch aufbrandenden Zwiegesprächen ab, in einer Folge von Miniaturszenen, die scheinbar beziehungslos nebeneinander aufflackern und wieder verebben. Alltagsfragmente, Standardgesten, surreale Bilder von tiefer Vereinsamung und quälendem Aneinander-Vorbeireden, ein ständiges Kommen und Gehen, wie zufällig anmutende Auftritte - das alles hat Stein in einem Konferenzzimmer des Ausstellungsleiters brillant arrangiert. Selbst der Abzug der Schauspieler durch die Publikumsreihen und ihre Wiederkehr in regennasser Kleidung hat Bedeutung. In diesem im Grunde genommen dramatischen Nichts hegen so viel Intimität, Information und Dichte, wird der eigentliche Anlaß des öffentlichen Skandals von privaten Enthüllungen derart überwuchert, daß selbst Banalitäten zu fesseln vermögen. Aber auch Stein kommt ohne den schmuddeligen Griff unter die Gürtellinie nicht aus.
Kaum ein Gastspiel dieses Theater' treffens war frei von Entblößungen und Obszönitäten in Wort und Geste,, und Publikum wie Kritiker haben sich fast ausnahmslos an diese dominierenden, dreist-absichtsvollen Effekte gewöhnt, denn das Auditorium protestiert stets nur gegen den einsamen Protestierer, der es wagt, seinen Unwillen angesichts massierter unnötiger „nackter Tatsachen“ zu bekunden. Das Maß des Erträglichen überstiegen in dieser Hinsicht Griffiths' „Komiker“ (Thailia-Theater Hamburg, Regie: Zadek). Armselige Kandidaten, die einen Possenreißer-Kurs absolviert haben, geben Talentproben ab in der Hoffnung, von einem süffisanten Agenten (herrlich: Boy Gobert) ins große Geschäft gebracht zu werden. Die Geschmacklosigkeiten von Porno-Zoten, Juden- und KZ-Witzen, Haßtiraden und Bösartigkeiten sind kaum überbietbar. Großartig allerdings ist das Ensemble, jeder eine Type, differenziert geführt, wie man es Zadek kaum zutraut
Einen versöhnlichen Abschuß bildete Steckeis Frankfurter Inszenierung von Ernst Barlachs „Der arme Vetter“. Jeder einzelne Darsteller ein Solist, ergreifend vor allem Marlen Diekhoffund Peter Franke als Randfiguren der Gesellschaft, die aus der Alltagsnorm auszubrechen versuchen und doch vor der gierigen, brutalen Masse mit Mäulern und Augen schier verschlungen werden. Düstere Szenen zwischen Regen, Deich und Hafenkneipen, Spießer im Dunkeln, die das hereinströmende Licht einer herrlichen Sommerlandschaft überwältigt. Ein gutes Omen vielleicht für die künftige deutsche Theaterszene?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!