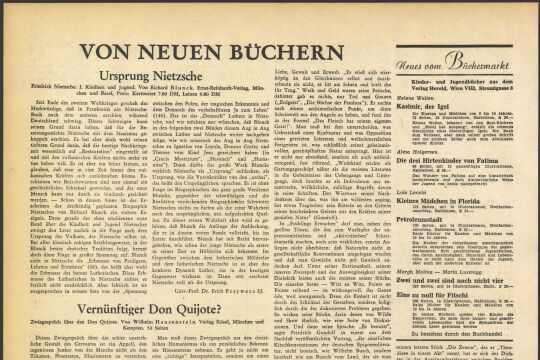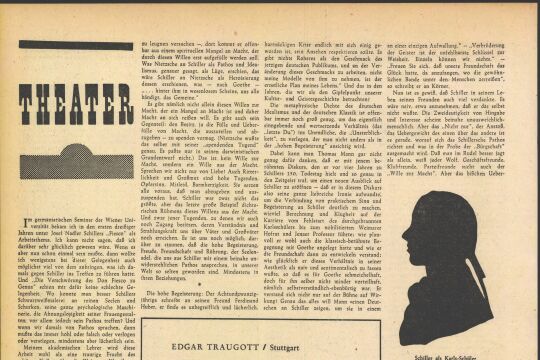Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ungestume Moralisten
„Wäre ich Gott gewesen“, soll sich Fürst *** geäußert haben (Goethe erzählte die Anekdote einmal in heiterer Laune), „im Begriff, die Welt zu erschaffen, und ich hätte in dem Augenblick vorausgesehen, daß Schillers .Räuber' darin würden geschrieben werden, ich hätte die Welt nicht erschaffen.“ Diese Abneigung, setzte Goethe hinzu, ginge freilich etwas zu weit, womit er wohl seine eigenen Vorbehalte verschleiert haben mochte. Schiller selbst stand nach seinen philosophierend und dichtend bewältigten Läuterungsprozessen seinen Jugendwerken später ablehnend gegenüber. Ungeheuerlich ist denn auch, wie die Pubertätsvision eines Genies die beiden großen menschlichen Abenteuer des 18. Jahrhunderts als Hybris im Scheitern vorführt: der Zyniker und gigantische Schurke, der mit intellektueller Wollust ausprobiert, wie weit man es treiben kann bei vorsätzlich ausgeschaltetem Gewissen; der ungebärdige Held, das lodernde Originalgenie, das mit Feuer und Schwert die verletzte Gerechtigkeit an der Menschheit rächen will. „In tyrannos“ steht schattenhaft unter der Titelvignette der zweiten Buchausgabe der „Räuber“. Aber in szenische Schreckenskammern oder (moderner ausgedrückt) in gewaltsame „Grenzsituationen“ versetzt, scheitern sie beide: das übermächtige Herz wie der übermächtige Verstand, besiegt von dem unsichtbaren Gegenspieler, der sittlichen Weltordnung.
Schwer ist der Zugang zu dieser Welt von grandioser Unwirklichkeit mit ihren „bedeutenden und kolossa-lischen Charakteren“, ihrem leidenschaftlichen Pathos und Gefühlsüberschwang, aber auch voll von Schauereffekten in verwirrender Fülle. Thomas Mann sprach seinerzeit in seiner Stuttgarter Schiller-Rede vom „höheren Indianerspiel“, das in Schillers Dramen stattfinde. Keine Regie darf jedoch übersehen, daß das Jugendstück von sich aus seiner scheinbar himmelstürmenden Begeisterung eine unüberhörbare Skepsis entgegensetzt. Also muß die Schillersche Welt in Zweifel gestürzt und auch in die Idealgestalt des Karl der Zweifel gesät werden. Das Ende, die Auflösung, der Verfall eines Zeitalters muß von allem Anfang an angedeutet sein. Dagegen wirkt die Neuinszenierung im Burgtheater unter der Regie von Leopold Lindt-berg konventionell. Die überdimensionierten Schloßinterieurs von Günther Schneider-Siemsens erinnern eher an protzige Hollywood-Manier als an ein Grafenschloß des 18. Jahrhunderts, während die böhmischen Wälder zu armseligen Plastikabstraktionen degeneriert sind, unter denen sich die Libertiner und Räuber heiser schreien. Walter Reyer ist von Anfang an der ungebrochen strahlende Held und idealistische Mordbrenner Karl, dem in Boy Gobert als Franz ein Verklemmerter, kleiner Bösewicht gegenübersteht, eine Art Winkelschreiber der Schurkenhaftigkeit ohne jene bohrende Dämonie eines kaltfeueri-gen Intellekts, die der Rolle not täte. Alexander Trojan ist ein mehr verhaltener Spiegelberg, Michael Janisch ein braver Schweizer, Wolfgang Stendar ein wenig intensiver Roller. Heinz Woester als der alte, gütige Moor wahrt Burgtheatertradition, indes Erika Pluhar die rührende Exaltiertheit der Amalia überraschend echt und ansprechend zu gestalten weiß.
Nur das lebendig Durchpulste kann in einer Aufführung der „Räuber“ überzeugen. Das Stehparterre ausgenommen, klang der Beifall am Ende eher zurückhaltend.
Denkt man sich einen großen Bogen unter dem Begriff „Expressionismus“, so ist Frank Wedekind von Schiller gar nicht so weit entfernt. Wedekind pflegte ähnlich „monströs“ vorzugehen („Lulu“, „Marquis von Keith“, „Der Kammersänger“). Nicht nur, daß er Schiller seinen „Lieblingsschriftsteller“ genannt hat, scheute er sich ebensowenig wie Schiller, die handfesten Möglichkeiten des Theaters rück-haltslps auszubeuten. So gesehen, gibt es eine innere Verwandtschaft zwischen dem „finsteren Treiben“ in einem Grafenschloß des 18. Jahrhunderts und den Pistolenschüssen und Leichen in Wedekinds Makart-Salons des Fin-de-siecle.
Es geht nicht um Lebenswahrheit, sondern um den schonungslosen Befund, um den Zerrspiegel einer schillernden Gesellschaft. Wedekind porträtierte sich in Professor Dühring, der sein Leben lang vergeblich um den Erfolg seiner Oper kämpft, weil er die Kunst so heilig hält, daß er dem Leben nicht gewachsen ist. Und ist doch zugleich auch der Kammersänger selbst, der mit brutaler Intelligenz die Kunst wie das Leben dem Erfolg opfert. Ein großartiges Stück Theater von peitschender Schärfe, dessen Ton jedoch nicht recht in das Theater der Josef Stadt paßt, weshalb die drei Szenen unter der Regie von Dietrich Haugk mehr in eine wirksame Burleske umgebogen wurden. Kurt Heintel als k. k. Kammersänger, Marion Degler als die ihn tödlich bedrängende Frau, Erik Frey als weltfremder Komponist spielen vortrefflich, nur Ingrid Kohr als schwärmerische Verehrerin versagt.
Jean Anouilhs „Orchester“ bestritt die zweite (schwächere) Hälfte des Abends, in der Josefstadt. Ein Einakter seiner „pieces, grincantes“, verbirgt er hinter Sticheleien und Eifersüchteleien unter den Mitgliedern einer drittrangigen Damenkapelle Weltverzweiflung und Menschenverachtung und endet mit dem Revolverschuß der exaltierten Cello-Dame. Mehr Charakterstudie als komödiantische Handlung, läuft das Stück nicht durchwegs kurzweilig ab; auch stört bisweilen bei diesem eminenten Dramatiker eine Art tiefsitzender Brutalität und Primitivität. Durch Hans Weigels Transponierung des Einakters „in das Österreich der zwanziger Jahre“ wird zudem manches verharmlost und vergröbert. Hans Rudolf, Vilma Degischer, Lotte Lang, Nina Sandt bieten unter der Regie von Haugk kabarettistische Kunststücke. Ursula Schult übertreibt ein wenig die tragischen Töne. Das Publikum ließ sich nicht stören und klatschte lebhaft Beifall.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!