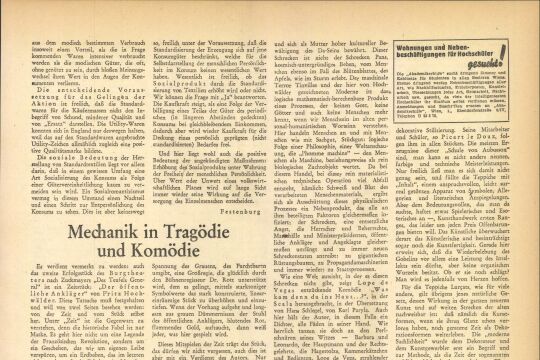Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Moral aus vielerlei Sicht
In der Theodizee „Die Zensur“ sagt Wedekind: „Ich habe mein halbes Leben lang ohne Kunst gelebt. Ohne Religion könnte ich nicht eine Minute leben.“ Bei der Totenfeier zu Wedekinds Gedächtnis in der Neuen Wiener Bühne bezeichnete Felix Salten diese Worte als einen „Schlüssel zur innersten Herzkammer dieses Mannes.“
Selbst in dem Schauspiel „Der Marquis von Keith“, das derzeit im Volkstheater aufgeführt wird, läßt Wedekind die Titelgestalt das Christentum rühmen, es habe „zwei Drittel der Menschheit aus der Sklaverei befreit“. Und dies, obwohl der Marquis ein ausschließlich auf iseinen Vorteil bedachter Abenteurer und Faiseur ist, der ansonsten „über die höchsten Werte des Lebens spottet“ und als letztes Ziel nur den Lebensgenuß kennt. In diesem Stück führt Wedekind alles hedonistische, auf sinnlichen Genuß gerichtete Streben ad absurdum. Denn nicht nur Keith scheitert, sondern auch sein Freund Scholz, der seine Zuflucht im Irrenhaus sucht, da er aus dem Widerstreit zwischen moralischen Bestrebungen und dem Wunsch, ein „Genußmensch“ ziu werden, nicht herausfindet.
Das dauernde Hervorkehren des Lebensgenusses als Ziel wirkt veraltet, in der Wohlstands- und Wohlfahrtsgesellschaft von heute ist das kein Ziel mehr, die materialistisch- egoistische Einstellung und Lebenshaltung ist nur zu allgemein, sie wirkt pur allzu selbstverständlich, reicht vom Straßenbahnschaffner bis zum Großindustriellen. Sie wäre heute nicht als Ziel, sondern als All- gemeinerscheinung anzugreifen.
Doch nimmt Keith — das Stück entstand anno 1900 — im Individualistischen vorweg, was sich im Politischen in unseren Jahrzehnten so ungeheuerlich ausgeweitet hat: die vitale Hemmungslosigkeit des Faiseurs. Außerdem besitzt Keith jene Kälte, die nicht nur bei den Diktatoren ein Kennzeichen unserer
Zeit ist.
Ja, das ganze Stück wirkt kalt; in seiner Intellektualität, in den unentwegten Aussagen der Gestalten über sich selbst und über ihre Neben- und Gegenspieler, in den glitzernden Facetten .der Formulierungen. Das müßte den Regisseur Gustav Man- ker,. dem das Rationale näherliegt als das Emotionale, anziehen, sollte man meinen. Überdies hat er beachtliche Wedekind-Inszenierungen im Volkstheater geschaffen. Aber das Unfaßbare geschieht, er scheint weder die Eigenart noch die Qualität des Stücks zu erkennen, er halt sich an Unwesentliches, das er mit Gewalt alles andere erdrücken laßt, an das Münchnerische. Und so sinkt das Stück auf das Niveau einer Bauernposse, die zum Gaudium eines als primitiv erachteten, unterhaltungssüchtigen Publikums aufgeführt wird. Die Schauspieler dienen diesem Ziel, vorweg Herbert Propst, durch den der Hochstapler Keith zu einem präpotenten Spießer wird. Die Bühnenbilder von Maxi Tschunko — schwarze, reizvoll antiquierte Graphik auf weißen Wänden — seien anerkannt.
Der Lebenstrieb ist der stärkste aller Triebe. Albert Schweitzer hat die Ehrfurcht Vor dem Leben postuliert und sie auf alles Lebende erstreckt. Darf sich, dem entgegen, der Staat das Recht anmaßen, zu töten? Diese Frage ist dauernd aktuell. Das Stück „Das Leben in meiner Hand“. von Peter Ustinov, das im Theater in der Josefstadt zur deutschsprachigen Erstaufführung gelangte, richtete sich gegen die Todesstrafe.
Verneint man die Berechtigung des Staates, über das Leben von Menschen zu verfügen, müßte das gerade am verabscheuungswürdigsten Verbrecher dargetan werden. Ustinov aber wählt, um mit seiner These möglichst leicht durchzudringen, einen Fall, in dem auch mancher Befürworter dieser Strafe die Hinrichtung ablehnen würde. Ein junger Mensch, der in dem Stück nicht auftritt, hat eine Schwachsinnige vergewaltigt, die, herzkrank, auch ohne diese Untat gestorben wäre. Schon die Frage, ob es Vergewaltigung gibt, wird umstritten. Jedenfalls relativiert Ustinov seine Absicht.
Der Minister verweigert die Begnadigung, zu der er das Recht hätte. Den Kampf gegen diese Einstellung führt der Journalist Long, der die Begebnisse als Erzähler darbietet, und vor allem der Sohn des Ministers, wobei sich Ustinov im Einsatz des jungen Menschen für den Verurteilten recht billiger Mittel bedient: Dieser Sohn hat ein gleiches, der Minister ein moralisch analoges Delikt begangen wie der Todeskandidat, nur waren beide vom Gesetz nicht zu fassen. Daß das Leben das Geschenk einer höheren Macht ist, in die wir nicht einzugreifen haben, dieses entscheidende Argument wird kaum berührt. Es führt in religiöse Bereiche, die Ustinov wohl fremd sind. In der Aufführung unter der taktvollen Regie von Heinrich Schnitzler bieten Jochen Brockmann als Journalist, Robert Dietl als Minister und Volker Brandt als dessen Sohn beachtliche Leistungen. Die verschiedenen Schauplätze bringt Gottfried Neu-
mann-Spallart auf dor kleinen Drehbühne unter: Sitzgelegenheiten und Tische genügen dafür.
Es gibt Stücke, die vor allem ein Vorwand für schauspielerische Entfaltung sind. Das trifft weitgehend auf die beiden Einakter „Freunde und Feinde“ von dem in den USA lebenden Ukrainer Arkady Leokum zu, die im Kleinen Theater der Josef stadt auf geführt werden. Im ersten Stück quält der Sohn eines amerikanischen Nabobs seinen armseligen, verkauzten Privatlehrer in raffinierter Weise bis aufs Blut, im zweiten peinigt in einem zweitklassigen Restaurant ein Gast in der niederträchtigsten Weise einen Kellner. In beiden Fällen wird die Ursache dieses sadistischen Verhaltens in verdeckten Minderwertigkeitskomplexen — Sadismus als Macht der Ohnmächtigen — bloßgelegt. Diese ins Szenische umgesetzten psychologischen Studien, denen im Zeitalter erneut aufkommender Grausamkeiten durchaus Zeitnähe zukommt, würden trotz der sorgfältigen Regie Hermann Kutschers aber doch ermüden, böten sie nicht Helmut Qualtinger die Möglichkeit zu schauspielerischen Spitzenleistungen. Er packt als der sadistisch veranlagte Gast, erst recht zeichnet er — in überraschendem Gegensatz zu seinen bisherigen Rollen — als der mißhandelte getretene Lehrer ein tief ergreifendes Menschenbild. Seine Partner waren der junge, hochinteressante Andreas von Sas und der immer wieder in entsprechenden Rollen (hier in der eines alten Kellners) ergreifende Guido Wieland. Karl
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!