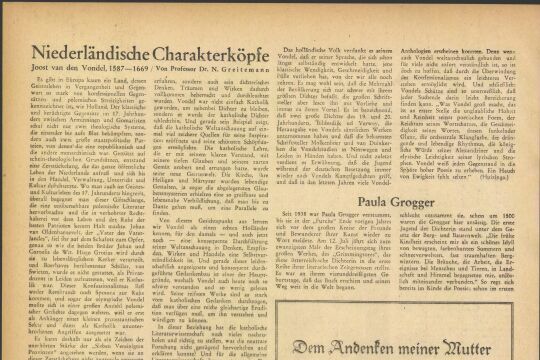SELTEN HAT DIE AUSSAGE über einen Dichter derart ins Schwarze getroffen, selten noch ein Ausspruch seine Gültigkeit über Jahre hinweg bewahrt, wie der als Titel vorangestellte Satz. In ihm hat Goethe am 15. Oktober 1825, also 44 Jahre nach Lessings Tod, ebenso nüchtern wie hart zusammengefaßt, woran es dem Zeitalter mangelte: an großen, unbeugsamen Charakteren, an Persönlichkeiten mit sicherem Urteil und unbeirrbarem Geschmack, sowie an klarsichtigen Köpfen. Zugleich gelingt es ihm aber auch, mit dieser Formulierung die eigentliche Schwachstelle vornehm zu umschweigen, die uns noch heute an Lessing zu schaffen macht, die überzeitliche Geltung seines Werks nämlich.
Ohne Frage steht Lessing als Philosoph Kant an Bedeutung nicht unerheblich nach. Seine kunsttheoretischen Schriften erreichen, vielleicht mit Ausnahme des „Laokoon“, der ja das ganze neunzehnte Jahrhundert über als Steinbruch von Künstlern, Wissenschaftern und Dilettanten ausgebeutet worden ist, nie jene Materialdichte oder auch nur Materialnähe, die Winckelmann in so hohem Maß besessen hat. Sein Ruf als Schöpfer und erster Repräsentant einer deutschen Literatur- und Kunstkritik hingegen ist unbestritten; aber wer liest heute schon die „Briefe antiquarischen Inhalts“ oder jene „Literaturbriefe“, die dem jungen Herder in den livländischen Hinterwäldern einst eine neue Welt erschlossen und ihn zu eigenem Schaffen angeregt haben?
Sie sind bestenfalls noch für den Historiker von Interesse, genau wie der überwiegende Teil der Autoren (oder sollte es zutreffender heißen: jener Autoren wegen), mit denen sie sich auseinandersetzen. Das gleiche gilt für weite Strecken der „Hamburgischen Dramaturgie“, dem Gründungsmanifest des deutschen Nationaltheaters: wo sie französischen Bühnendichtern umständlich Verstöße gegen die aristotelische Poetik nachrechnet oder Richtlinien für das Erscheinen von Geistern auf der Bühne erläßt, wird man sie bald aus der Hand legen.
UND DOCH: wie glänzt es unversehens aus diesen Zeilen! Welch Sturm fährt da durch die Seiten! Wie erfrischend fegt der Witz durch den Mief nicht nur der Zopfzeit! Direkt betroffen macht manches davon noch heute. Vor allem aber: diese verläßliche Sprache! Sie ist epigrammatisch knapp, umschweift, -umstreicht ihr Thema nicht, wie es dem Zeitstil entspräche, sondern packt im Klang, im Bild, im Begriff handfest zu. Und ist doch nicht atemlos und gehetzt; eher ein wenig wortkarg.
Sie erspart sich und uns, was andere auffüllen, ausschmücken würden. Zum ersten Mal im achtzehnten Jahrhundert spielt sie gegen das höfische Getue bürgerliche Tugend, bürgerliche Sachlichkeit aus: lieber weniger zu scheinen als zu viel. Daher zielt sie immer aufs Wesentliche, aufs Ganze. Kaum irgendwo die Beschreibung einer Landschaft. Selbst die Regieanweisungen überlassen die Szenerie weitgehend der Phantasie des Lesers.
Diese äußerste Verzahnung von Aussage und Ausdruck, des Mitteilens und des mit dem Leser sich in die Arbeit Teilens, geben ihr die charakteristische Dynamik, die aber, im Gegensatz zu Schiller, nicht nur mitreißt oder Gefühle aufheizt, sondern zum Mitdenken anreizt, zum Nachprüfen geradezu herausfordert. Wenn überhaupt bei einem deutschen Dichter, dann ist hier, bei Lessing, der Geist Fleisch geworden. Denn alles, was er , geschrieben hat, ob Lyrik, Prosa, Kritik, Dialog, ist von einem starken Drang zum Handeln erfüllt. Auch der Denker Lessing ist Täter.
Dazu will allerdings sein berühmtes und erschütterndes Selbstbekenntnis nicht so recht passen. Hier scheint sich allerhand zu spießen: „Ich fühle“, so schreibt er im Schlußabschnitt der „Hamburgischen Dramaturgie“, „ich fühle die lebendige Quelle nicht in mir, die durch eigene Kraft sich emporarbeitet, durch eigene Kraft in so reichen, so frischen, so reinen Strahlen aufschießt; ich muß alles durch Druckwerk und Röhren aus mir herauspressen.“
Aber nur der, der Lessings Stellung zu seiner Epoche gründlich mißversteht, vielleicht sogar mißverstehen will, kann in solchen Sätzen das Eingeständnis von Schwäche wittern.
IN DEN ZWEI JAHRHUNDERTEN, die bald seit seinem Tod vergangen sein werden, ist Lessing in der Tat oft falsch verstanden und - was noch schlimmer ist - in einer Weise umgedeutet worden, die seinem aufgeklärten Denken direkt zuwiderläuft. Die Geschichtsschreiber des deutschen Imperialismus haben in ihm einen Verherrlicher des alten Fritz gesehen. Nun enthält zwar die „Minna von Barnhelm“ insofern gewisse apologetische Momente, als doch der abgehalfterte Tellheim durch eine Kabinettsordre wieder zu Ehren gelangt.
Allerdings reicht das nicht aus, in diesem Schauspiel so etwas wie eine Glorifizierung der Staatsdoktrin oder eine Lobhudelei vor dem Philosophen auf dem Königsthron zu erblik-ken, der ja über die deutschen Schriftsteller und Dichter bekanntlich recht abfällig geurteilt hat. Das entspricht Lessings Charakter, seiner Direktheit, seinem Mut, seiner Aufrichtigkeit, vor allem aber seinen politischen Ansichten nicht nur nicht, sondern steht in krassem Widerspruch zu Äußerungen über den Preußenstaat sowie zu seiner ganzen Lebenshaltung, zu seinem Lebensschicksal. Auch paßt es schlecht zu seinem Selbstbild.
Sich selbst hat Lessing als Weltbürger gesehen, als freien Geist zwischen den Nationen, den Konfessionen und weltanschaulichen Bekenntnissen.
^.Emilia Galotti“ legt davon Zeugnis ab. Ebenso sehr aber auch davon, wie dieses neue Selbstbewußtsein sich selbst zerstören kann, wenn es die Konsequenzen aus seinen Einsichten nicht zieht. Ein deutlich revolutionäres Flammenzeichen also. I
SOLCHER PERSPEKTIVE entdeckt sich dann allerdings der doppelte Boden, den die Fabel der „Minna von Barnhelm“ zweifelsohne verhüllt. Ein Lustspiel wie nie zuvor und nie hernach, aus den Schrunden und Abgründen der Seele geschaut und zusammengebraut, veranschaulicht sie freilich mehr als lediglich die später in der Dramaturgie festgehaltene Einsicht, daß Lachen Spannungen löse und damit den Charakter bessere.
„Die Komödie will durch Lachen bessern.“ Natürlich auch das. Letztlich ist die Minna aber eine bittere Satire auf den Ungeist der Zeit, eine Camouflage der Ungerechtigkeit und Willkürherrschaft des Souveräns wie der Unzulänglichkeit und Unmenschlichkeit seiner Bürokratie, der ein Soldat nur so lange was gilt, als er gebraucht wird.
Daß die versteckte Absicht herausfordernd auf die Zeitgenossen gewirkt hat, braucht nicht erst umständlich bewiesen zu werden. Die Schwierigkeiten, denen die ersten Aufführungen begegnen, sprechen eine deutliche Sprache. Hamburg, Berlin, Paris halten Rückfrage beim preußischen Minister des Auswärtigen, bevor das Lachen Teilheims über die Bühne gellen darf. Dennoch hat der Nationalismus gerade um dieses Schauspiel seine Legende gewoben, weil es ihm nicht nur den Geist jenes Krieges, ja des preußischen Militarismus schlechthin zu atmen, sondern so etwas wie die Ausgeburt „norddeutschen Nationalgefühls“ (Goethe) zu sein scheint, die Preußens Vormachtstellung begründeten.
Mehr als der Besitz bedeutete für Lessing die Suche nach Wahrheit. Deshalb verzerrt es seine eigentlichen Beweggründe, ihn, der sich an einer einzigen Perspektive allein
nicht beruhigen konnte, zum Vorkämpfer „deutschen Wesens“, „deutscher Eigenart“ zu erklären. An Versuchen von Wilhelm Scherer bis Mathilde Ludendorff hat es nicht gefehlt. Sie mißverstehen allerdings seinen Kampf gegen die Vorherr-
schaft französischer Geschmackskultur gründlich, indem sie ihm nationale Motive unterlegen.
Lessings im Aufspüren von Gegenpositionen ungemein reger Verstand war vom Byzantinismus des aus Frankreich importierten höfischen Stils abgestoßen. Er durchschaute seine Rückständigkeit, vor allem aber, wie sehr Denken und Sein, das auf der Höhe der Zeit stehende aufgeklärte Philosophieren des Bürgertums und die mit dessen Interessen und Bedürfnissen durchaus nicht zu vereinbarende Ausdrucksgebärde des Feudalismus auseinanderklafften.
MODISCH FESTGEFAHRENES Verhalten aufzusprengen und Anschluß an Strömungen, an Bewegungen des Geistes herzustellen und ihnen Möglichkeiten des Ausdrucks zu erschließen, die dem aufgeklärten bürgerlichen Bewußtsein besser entsprachen als der glante Stil eines Voltaire oder ein preziöses Bildungsideal: das war es, wofür Lessi-ng zeit seines Lebens gekämpft hat. Wahrscheinlich zielt die andere Stoßrichtung dieses Kampfes auf die Person des Souveräns selbst, dessen Frankophilie, wie gleichermaßen sein Lippenbekenntnis zur Aufklärung das Aufkommen eines angemessenen bürgerlichen Geisteslebens arg behinderten. Denn dessen Auffassung vom Fürsten als eines ersten Dieners des Staates verfolgte praktisch den Zweck, die Macht der Beamten zu brechen und seine eigene zu verfestigen.
Desgleichen durften zwar die Gazetten nicht genieret werden, aber nur solange sie die Staatsräson ihrerseits nicht genierten oder in den schlüpfrigen Atheismus Friedrichs miteinstimmten. Dafür gibt es keinen besseren Zeugen als Lessing selbst. Er sieht die „Berlinische Freiheit zu denken und zu schreiben“ einzig und allein auf die Freiheit beschränkt, „gegen die Religion soviel Sottisen zu Markte zu bringen, als man will, und dieser Freiheit muß sich der rechtli-
che Mann nun bald zu bedienen schämen“.
Trotz der schneidenden Schärfe von Lessings Intellekt, dem nur saubere Trennungen und Grenzverläufe ganz entsprechen können, deutet sich in dieser Briefstelle eine Eigen-
schaft an, die erst ermöglicht, das Bild dieses säkularen Charakters abzurunden. Sie ist ein Dokument jenes anderen Lessing, der, um geistige Redlichkeit bemüht, bestrebt ist, Ge-
gensätze auszugleichen. Wohlgemerkt: Es geht ihm nicht darum, sie zu verschleifen, sondern um eine Balance zwischen ihnen, um das Gleichgewicht von Kräften, deren Uberhang den Fortschritt des Denkens gefährdet.
Das erklärt auch seine Neigung, für gegensätzliche Positionen sozusagen denkethisch Partei zu ergreifen. Deutlich läßt sich das am Verlauf verfolgen, den der von ihm provozierte Religionsstreit genommen hat. Sein Versuch, wechselweise den Standpunkt der Orthodoxie oder den ihrer Gegner einzunehmen, brachte ihm den Vorwurf der Parteinahme ein und verwickelte ihn in eine Serie von Streitigkeiten, denen er freilich überlegen und voll hintergründiger Ironie entgegentrat. .
Als eine Kabinettsordre Lessing schließlich weitere Publikationen religionstheoretischen Inhalts untersagte, wich er auf die Bühne aus. Sein Versdrama „Nathan der Weise“ gilt ihm als Versuch zu erkunden, „ob man mich auf meiner alten Kanzel, auf dem Theater, wenigstens noch ungestört wird predigen lassen“.
Tatsächlich kleidet die Ringparabel Lessings schon im Religionsstreit praktizierte Auffassung1 der grundsätzlichen Gleichwertigkeit aller Religionen in ein Symbol, das den gegebenen Anlaß übersteigt. Nicht durch theoretische Argumentation erweist demnach eine Religion ihre Größe und Unmittelbarkeit zu Gott, sondern allein durch das Ausmaß an tätiger Humanität, das sie zu vermitteln imstande ist. Mit dieser Wendung in die praktische Philosophie entwirft Lessing die Vision einer zukünftigen Religion, in der alle Menschen übereinstimmen.
DER MANN, der noch am Ende seines relativ kurzen, aber an Kämpfen ungemein reichen Lebens eines solchen Optimismus fähig war, ist das nicht von Beginn an gewesen. Nur schwer und in ständiger Auseinandersetzung mit seiner Zeit, ihrer Kultur, ihren politischen und gessellschaftlichen Gegebenheiten hat er sich von ihren Traditionen zu emanzipieren vermocht. Er hat es mit bedeutendem Aufwand getan, mit Verbissenheit und Versessenheit, mit größter sprachlicher Zucht und doch nicht ohne Freiheit im Denken wie im Schreiben, die ihn an die Grenze seiner Leistungskraft gebracht haben.