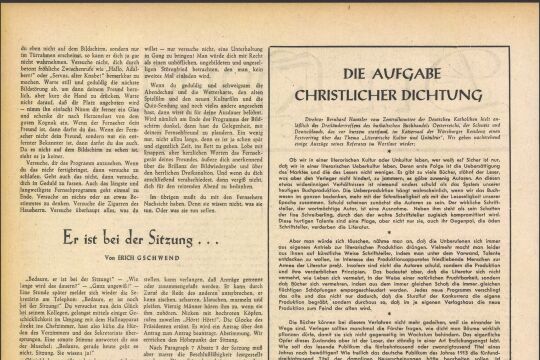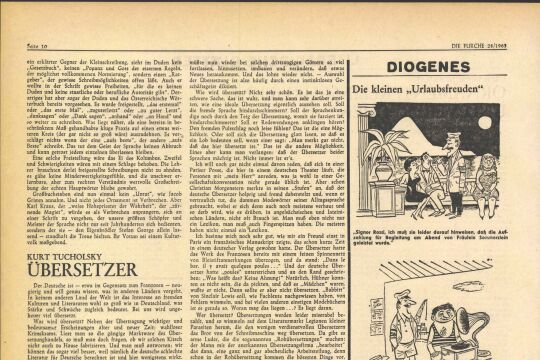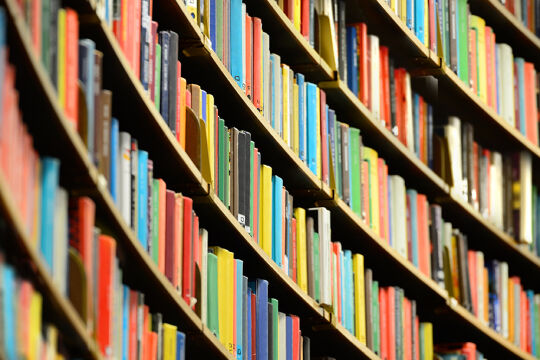Warum wir nicht DAS LETZTE WORT HABEN
Sie schreiben regelmäßig über Literatur, Theater, Musik und Kultur. Wie sie ihre Aufgabe als Kritikerinnen und Kritiker verstehen, erzählen sie hier.
Sie schreiben regelmäßig über Literatur, Theater, Musik und Kultur. Wie sie ihre Aufgabe als Kritikerinnen und Kritiker verstehen, erzählen sie hier.
Im Jahr 1955 versammelte die FURCHE anlässlich ihres 10-Jahr-Jubiläums vier Kritiker (alle männlich), die unter der Federführung von Friedrich Heer auf die Frage "Warum sind wir modern?" Statements für die zeitgenössische Kunst abgaben. Der Gegenwind, in den sie schrieben, lässt sich aus ihren Antworten lesen. 60 Jahre später scheint angesichts der Ausdünnung der Feuilletons allerorten eine andere Frage vonnöten. Kunst- und Kulturkritik waren von Anfang an wichtige Bestandteile der FURCHE. Im Unterschied zu dieser Jubiläumsausgabe, die Sie in Händen halten, macht das Feuilleton Woche für Woche fast ein Drittel der FURCHE aus, mit Literatur-, Musik-, Theater-, Film- und Kunstbesprechungen, mit Philosophie, Geschichte und Architektur. Essays und Kritiken, die Kennzeichen eines Feuilletons, nennt man im journalistischen Fachjargon Meinungselemente, doch sie gehen über bloße Meinung weit hinaus. Zum Thema "Warum wir nicht das letzte Wort haben" bat die FURCHE sieben der regelmäßig schreibenden freien Kritikerinnen und Kritiker, über ihr Selbstverständnis zu schreiben. Herausgekommen ist - so vielstimmig, wie ein Feuilleton ist und sein muss - ein beredtes Zeugnis für die auch gesellschaftspolitische Bedeutung von Kritik, die wir weiterhin pflegen werden.
"Kritiken sind für den Tag bestimmt"
Von Evelyne Polt-Heinzl
Literaturkritik ist eine diskursive Angelegenheit. Damit ist nicht primär die jüngste Gepflogenheit gemeint, dass Autoren Artikel oder Protestbriefe gegen unliebsame Rezensionen schreiben, mitunter auch Rezensionsverbote gegen die verantwortliche Redaktion aussprechen. Eher ginge es um die Debattenkultur im eigenen Feld, doch die wurde mit der Synchronisierung des Erscheinungstermins aller Besprechungen mit dem Erstverkaufstag des Buches stark ausgedünnt.
Geist gegen vorschnelle Worte
Geblieben aber ist der Charakter eines Dialogangebots an Leser und Leserinnen, bei dem die Höflichkeit gebietet, Basisinformationen an die Hand zu geben: über Thema, Inhalt und Verfahrensweisen genauso wie über sprachliche Eigenart und literarische Traditionen. Details dieser Art wirken selten hip und verlangen ein gewisses Maß an Selbstdisziplin. Schließlich sind flotte Sager jedem Text zuträglich und machen den Kritiker/die Kritikerin marktgängiger, also gefragter. Natürlich gilt es, Stellung zu beziehen, aber im Wissen - und im zugehörigen sprachlichen Kleid -, dass die eigene Position kein finales Urteil ist. Die Zeit der Sendschreiben ablassenden Literaturpäpste ist zwar vorbei, aber das aktuelle Diktat der Kurzweiligkeit verführt leicht zu selbstverliebten Bonmots. Vielleicht wäre hier ein gutes Betätigungsfeld für Efac, den Geist gegen vorschnelle Worte, den der Journalist Helge Timmerberg als Flaschengeist erfunden hat.
Kritiken sind für den Tag bestimmt. Das muss nicht heißen, dass sie - trotz des überhitzten Tempos am Buchmarkt - schnell geschrieben sind. Aber sie entstehen aus dem aktuellen Geschehen heraus. Sind ein, zwei, drei Jahrzehnte ins Land gezogen, muss der Blick auf das Buch ein anderer sein. Auch deshalb kann Literaturkritik nie das letzte Wort haben -nicht einmal für den Kritiker/die Kritikerin selbst. Und daher liegt über Sammelbänden eigener Rezensionen oft ein Hauch von Resignation, als würde sich hier jemand die Möglichkeit absprechen, klüger zu werden.
"Trotziges Kind der Aufklärung"
Von Anton Thuswaldner
Im illustrierten Familienblatt Die Gartenlaube gab es in einer Ausgabe gegen Ende des 19. Jahrhunderts einen Überblick über die damals neueste deutsche Literatur. Die dazu gehörige Grafik veranschaulichte die Bedeutung der jeweiligen Literaten. In der Mitte prangte groß ein Porträt Ludwig Ganghofers, um ihn herum, wie Engel um die herrschende Zentralgestalt, waren die kleineren Geister arrangiert, darunter Gerhart Hauptmann. Im Abstand von einem Jahrhundert geraten wir ins Staunen über die eklatante Fehleinschätzung. Das ist ein guter Grund, warum wir als Kritiker nicht beanspruchen, die Deutungshoheit über Texte zu haben.
Warum reden wir über Bücher und kommen auf keinen grünen Zweig? Warum unterhalten sich zwei über ihre Lektüreerfahrungen und gelangen zu verschiedenen Einschätzungen des anscheinend gleichen Sachverhaltes? Über Literatur haben wir das letzte Wort nicht gefunden, deshalb bleibt jedes Gespräch darüber unabgeschlossen und offen. Das betrifft nicht nur die Gegenwartsliteratur, über deren Stellenwert ohnehin Verbindliches nicht gesagt werden kann, das schließt sogar die alten, längst in den Kanon eingegangenen Texte ein. Ist "Nathan der Weise" nicht ein vielleicht ehrenwertes, aber literarisch doch arg misslungenes Theaterstück? Warum aber ist "Engelbert Reineke", ein Roman des vollkommen vergessenen Paul Schallück, derart ins Vergessensloch verschwunden, dass er selbst Kennern der Nachkriegsliteratur kein Begriff ist? Als Kritiker will man Bücher ins Gespräch bringen und bietet eine Lesart an, damit ist das Gespräch eröffnet.
Wer anders denkt, aber über die Kritik zum Denken gekommen ist, hat schon gewonnen. Er hat sein eigenes Denken geschärft. Damit befinden wir uns in der Vorschule der Aufklärung, deren trotziges Kind die Kritik ja ist.
"Sie dient niemandem"
Von Daniela Strigl
"Es glaube doch nicht jeder, der imstande war, seine Meinung von einem Kunstwerk aufzuschreiben, er habe es kritisiert", rät Ebner-Eschenbach. Meinungen kommen aus dem Bauch oder, wie E. W. Marboe gesagt hätte, aus den Hoden, ein Kunstwerk kritisieren bedeutet aber, ihm gerecht werden zu wollen. Dazu muss man es vorher gründlich betrachtet und zerlegt haben. Ästhetisches Gelingen und Misslingen lassen sich, jenseits der unhintergehbaren Ebene des Geschmacks, sehr wohl beschreiben. Meist ist es dabei leichter, die Fehler ausfindig und namhaft zu machen als die Vorzüge. Immer geht es darum, Anspruch und Grad des Gelingens miteinander zu verrechnen.
Auch Kritikerinnen sind schreibende Menschen. Kritik, wie ich sie verstehe, ist kein Akt der Nächstenliebe, sondern eine autoerotische Beschäftigung, ist Lust am Verkehr mit der Sprache. Sie richtet sich nicht nach den Wünschen der Verlage, der Veranstalter, der Autoren, der Leser. Kritik ist nicht demütig. Sie dient niemandem und hat niemandem zu dienen, außer, im Idealfall: der Kunst.
Entmachtung der Kritik
Wir haben nicht das letzte Wort - heute oft auch nicht das erste. Das wird womöglich getwittert, gebloggt oder gepostet. Oder in einem Interview gesprochen, in einer Homestory zitiert. Die Entmachtung der Kritik hat viele Vorteile, aber auch manche Nachteile. Dass die klassische Rezension immer mehr verpönt wird, entwöhnt das Publikum des kritischen Mitdenkens und des Widerspruchs. Entwöhnt die Kritiker der komplexen Argumentation, der sprachlichen Kraftanstrengung, der intellektuellen Langstrecke. Ich behaupte: Hinter der Unterhöhlung des kritischen Bewusstseins steckt politische Absicht.
Wir haben nicht das letzte Wort, weil die Kritik höchstens den Ruhm der Kritisierten begründet, aber nicht den Nachruhm. Das letzte Wort haben im Falle der Literatur auch nicht die Leser, vielmehr: nicht die heutigen, sondern die künftigen. Wie viele einst Berühmte kennt heute keiner mehr! Wie viele einst Unbekannte sind heute berühmt! Manchmal deckt sich das. Dann haben die Kritiker Glück gehabt.
"Etwas ganz anderes für möglich halten"
Von Patric Blaser
Beim Wort genommen, bezeichnet kritike die Kunst des Unterscheidens. Was es zuallererst zu unterscheiden gilt, ist, dass die Kritik nicht das Werk ist. Sie ist lediglich ein sekundäres Sprechen, eine Art Meta-Sprache, der selbst eine kritische Erfahrung vorausgeht, eine andere Erfahrung, die Erfahrung des Anderen. Und obwohl Kritik öffentliche Geltung, Wirkmächtigkeit und eine gewisse Verbindlichkeit beansprucht, ist sie höchst fragil, lässt sie doch über der ersten Sprache des Werkes eine zweite Sprache bloß schweben.
Kritik ist metaphorisches Denken im wörtlichen Sinne: ein Übersetzen, ein Hinübertragen jener Erfahrung in Deutung und Urteil. Dabei gleicht die Arbeit des Kritikers der von Benjamins Übersetzer: wie dieser versucht der Kritiker in einer Art Tiefenlektüre dem nicht aneigenbaren Objekt den geheimen Mechanismus zu entlocken. Das ist aber nur als Paraphrase, als Annäherung möglich, indem Kritik wie die Übersetzung dem Original folgt, ohne ihm je gleichen zu können.
Eröffnung für Neues
Weil Kritik in einem engen Verhältnis mit dem Kritisierten steht, arbeitet sie nicht über, sondern mit dem Kritisierten und erschöpft sich nicht im Vorgang der Erklärung, sondern bedeutet im günstigsten Falle Irritation, Unterbrechung des Gewohnten und agiert als Eröffnung für Neues. Wie die Kunst, deren fernes Echo sie allenfalls ist, beflügelt die Kritik die Fantasie für das Freibleibende und lehrt, wie die Kunst, etwas ganz anderes für möglich zu halten.
Deswegen heißt eine Kritik zu schreiben auch, es den Lesern zu überlassen, dieses Sprechen eindeutig zu machen. Sie ist nur ein Vorschlag, ein Kommentar, dessen Antwort man nie kennt. Wie Roland Barthes sagte: "man kritisiert, um geliebt zu werden, man wird gelesen, ohne dass man gelesen werden kann."
Kritik ist in diesem Sinne Kommentar und Aufforderung zum Kommentar. Denn: comment taire, wie schweigen?
"Worte sind alles"
Von Franz Zoglauer
"Kann man einen Menschen mit Worten retten", fragt der Kaffeehausliterat Treuenhof in Arthur Schnitzlers Fragment "Das Wort", nachdem er einen jungen Mann mit Worten in den Selbstmord getrieben hat. "Worte sind nichts", meint er zynisch und bekommt die Antwort: "Worte sind alles. Wir haben ja nichts anderes."
Wie leichtfertig aber gehen wir heute mit Worten um. Wie deformiert und eindimensional ist unsere Sprache geworden. Wie sehr sind Wortgewalt und Fantasie abhanden gekommen. Im Zeitalter hastigen Dahinschreibens zwingen wir uns mitunter zu sachlichen, mit Fachausdrücken geschmückten Worthülsen. Wo sind die Zeiten, in denen ein Übertreibungskünstler wie Hans Weigel in einem meiner Interviews Richard Strauss in barocken Worten mit perfider leiser Stimme mit Karl May verglich und es wagte, die "Frau ohne Schatten" als Machwerk zu bezeichnen. Eine Entgleisung? Eine Frechheit? Und was für eine! Sogar der Bundespräsident musste damals den aufgebrachten Dirigenten Karl Böhm beruhigen. Einer wie Weigel vermochte es aber auch, das holprige Versmaß so mancher berühmter Klassiker in seinen Kritiken nachzudichten.
Einzigartige Quelle der Kreativität
Sprache fehlt heute Doppelbödigkeit, Ironie und Humor. Urteile werden oft mit vorgetäuschter Objektivität gefällt. Feuilletons mit Eigenart, Stil und Charme sind bereits kostbare Raritäten. Beiläufigkeit wird immer mehr spürbar. Schnörkellos und nackt treten die Worte vor ihre Leser hin. Armselige, vor Kälte klappernde Hungergestelle.
Wer heute Kritiken von Eduard Hanslick liest, erfährt mehr über Menschen und Politik von damals, als Historiker das vermitteln könnten. Der Verehrungs-, Beschreibungs- und mitunter auch Vernichtungstrieb so mancher Kritiker war eine einzigartige Quelle der Kreativität. Sie waren Chronisten ihrer Zeit. Wahrheitssucher, die der Wahrheit oft nahe kamen. Sie sollten es wieder werden. Wie schön wäre es, wenn wir die Sprache wieder verwöhnen und lieben lernten. Worte sind tatsächlich alles, was wir haben. Ein letztes Wort werden wir Kritiker und Journalisten freilich nie haben. Alle Lust will bekanntlich Ewigkeit.
"Weiter nach Antworten suchen"
Von Julia Danielczyk
Bei der 650-Jahr-Feier der Universität Wien saß ich mit einer Rechtsphilosophin, einer Neurologin und einer Bildungswissenschaftlerin am Tisch. Der Festredner, ein Physiker, sprach über die bedeutenden Forschungsergebnisse seiner Fachdisziplin. "Weiter nach Antworten suchen", so lautete sein Statement. Zwischen den Tischnachbarinnen entfachte sich eine rege Diskussion: Sind es wirklich die Ergebnisse, nach denen wir suchen müssen? Oder nicht vielmehr die richtigen Fragen, die wir stellen sollten? Die Dynamik der Diskussion zeigte recht bald, dass das Sprechen darüber unterschiedliche Perspektiven eröffnete und uns am Ende reicher an Ideen nach Hause gehen ließ, auch wenn - oder gerade weil - niemand an diesem Abend das letzte Wort haben sollte.
Entfachen von Diskussionen
In diesem Verständnis sehe ich auch die Rolle der Theaterkritik: geht es doch auch ihr um das Entfachen von Diskussi onen sowie um Geschichten, die nicht nur nacherzählt, sondern weitergedacht und in neue Kontexte gesetzt werden wollen. Schließlich ist das Theater einer der wenigen Orte, an dem sich Menschen zu einem einzigartigen Ereignis - nicht zuletzt ist jede Aufführung einmalig - versammeln und gemeinsam Geschichten verfolgen, die es vermögen, uns zumindest scheinbar der menschlichen Grenzen zu entheben.
Eigentlich sollte es kein "letztes Wort" geben. Allein der Gedanke, jetzt unmittelbar festzusetzen, "was Sache ist", stellt schon eine Hybris dar. Denn offene Denkarten, wie sie auf der Suche nach einer besseren Welt anzustreben sind, können mit einem "finalen Wort" nichts anfangen. Dürfen sie auch gar nicht, denn genau dann würden sie die Offenheit verlieren: Nicht nur in der Kunst ist das Präsentieren von Arbeiten ein Zeigen von work in progress. Immer gibt es noch etwas zu verbessern, immer findet man noch etwas, was weiterentwickelt werden kann. Das ultimativ letzte Wort ist in diesem Sinne also der Weiterentwicklung kontraproduktiv. Das ist hoffentlich nicht mein letztes Wort.
"Erzählen von der eigenen Seele"
Von Walter Dobner
Ist, wie es der amerikanische Kritiker James Gibbons Huneker einmal formuliert hat, der Kritiker tatsächlich "ein Mann, der Wunder erwartet"? Oder doch "jemand, der von den Abenteuern seiner Seele unter den Meisterwerken erzählt", wie es der französische Literat Anatole France sieht? Immerhin pflichtet ihm Oscar Wilde bei, wenn er sagt: "Denn die höchste Kritik ist nichts anderes als ein Erzählen von seiner eigenen Seele." Ein nicht nur poetisches, sondern ein sehr reales Bild von einer Kritik. Schließlich ist sie nichts anderes als eine Erzählung von einem Ereignis, bei dem man dabei war und worüber man seine Eindrücke schildert. Aus durchaus subjektiver Sicht. Was man keineswegs mit Willkür verwechseln darf.
Denn auch für eine Kritik - besser: eine Rezension -gibt es objektive Kriterien. Eine Selbstverständlichkeit ist die genaue Kenntnis der Werke, die und deren Aufführung man bespricht. Natürlich spiegelt eine solche Sicht immer wieder auch die eigene Seele wider. Ohne persönlichen Standort lässt sich kein Urteil fällen. Und das hat nur Gewicht, wenn es auch begründet ist, sonst bleibt es Behauptung. Zu wenig für eine Rezension.
Irrtum nicht ausgeschlossen
So fundiert eine Kritik auch aus eigener Sicht scheinen mag, man darf die Relation nicht vergessen: Sie ist die Meinung eines Einzelnen, wenn auch durch oft jahrzehntelange Erfahrung geprägt. Irrtum schließt solches nicht aus. Auch nicht, dass man Dinge übersehen hat, auf die einen später jemand hinweist, was so manches Urteil relativieren kann. Dennoch, das letzte Wort hat nicht der Kritiker. Letztlich, und das entspricht auch dem Bild einer pluralistischen Gesellschaft, ist es das Publikum, das über Erfolg und Misserfolg eines Stückes, einer Aufführung entscheidet. Kritik kann solches fördern, auch lange verhindern. Aufhalten kann sie ein solches Ergebnis nicht. Ihren Stellenwert ändert das nicht. Aber auch nicht, dass die Kunst und nicht die Kritik das letzte Wort hat. Und damit auch nicht der Kritiker.
DIE FURCHE
10. Dez. 1955 Nr. 50
Warum sind wir modern?
Vier FURCHE-Kritiker haben das Wort
[...] Wir lieben unsere Zeit als die Gegenwart, als die Zeit unserer Zeitgenossen. Irgendwie mit all dem, was uns in ihr zukommt an Spielen, Experimenten, an Versuchen und auch an Versuchungen. [...] Wir wollen uns offen halten für die neuen Spiele, für die neuen Horizonte, für die Erschließung der schöpferischen Möglichkeiten des Menschen, der, soll er nicht zugrunde gehen in neuen Kriegen und Bürgerkriegen, heraus muß aus den Engpässen vergilbter Formen, Töne, Farben, von Häusern und Denksystemen, die dem Menschen den Atem der Freude, der Freiheit und des Friedens nehmen, ihn gar nicht aufkommen lassen. [...]
Friedrich Heer
[...] Warum wir modern sind?
Weil seit etwa sieben Jahrhunderten mindestens einmal in jedem Säkulum (meist aber alle 30 Jahre) die Musik totgesagt oder ihr Ende prophezeit wurde - und weil sie trotzdem weiterlebt und immer neue Blüten treibt.
Weil die Argumente (Melodielosigkeit, Verfall der Form, "Häßlichkeit") mit ermüdender Regelmäßigkeit wiederkehren und weil wir dieser Beweisführung mißtrauen.
Weil wir mit Vergnügen beobachten, daß gewisse Leute, die vor 30 Jahren bei bestimmten Musikstücken schimpfend den Konzertsaal verlassen hätten, sich heute die gleichen Werke mit Wohlgefallen, zumindest mit Respekt anhören und von "Klassikern der modernen Musik" nicht nur sprechen, sondern auch schreiben. [...]
Helmut A. Fiechtner
[...] Gewiß: Kunst wird einem nicht zum Frühstück auf den Tisch gelegt. Auch wir müssen sehen lernen. Wir müssen bereit sein, einen Zugang zur Kunst zu suchen.
Wenn wir die Entwicklung der neuen Malerei überhaupt verstehen wollen, müssen wir davon abgehen, in den Bildern, die sie uns gibt, Abbilder der sichtbaren Welt zu erblicken. [...]
Wieland Schmied
[...] Der Film scheint das Moderne, das moderne Ding an sich zu sein. Er fließt so rasch, daß die meisten Filme nach zehn Jahren nicht mehr zu ertragen sind. Man ist daher, glaube ich, selber dann modern, wenn man dem Phänomen bei aller Liebe nicht kritiklos und süchtig verfällt, sondern es kritisch betrachtet und beurteilt. Das schließt nicht aus, ihm eine große Zukunft vorauszusagen, eine andere freilich, als die meisten von ihm heute erwarten. [...]
Roman Herle