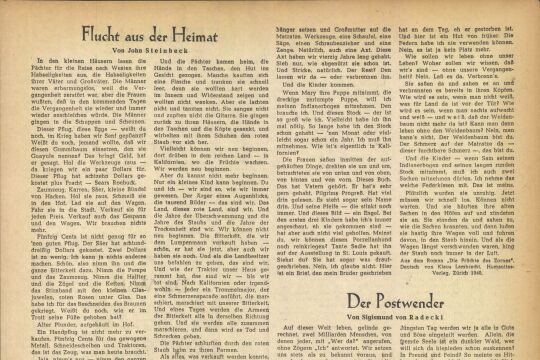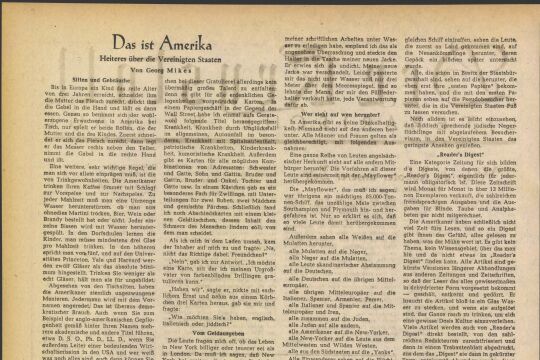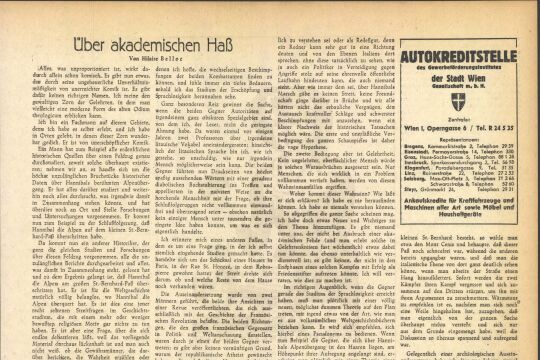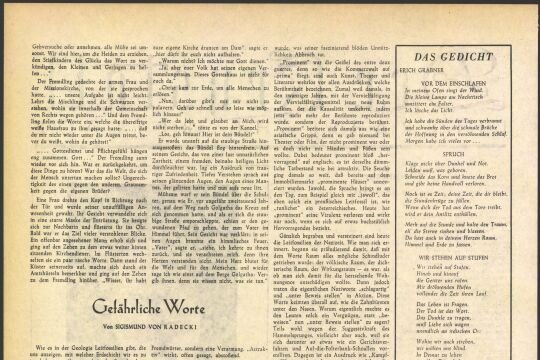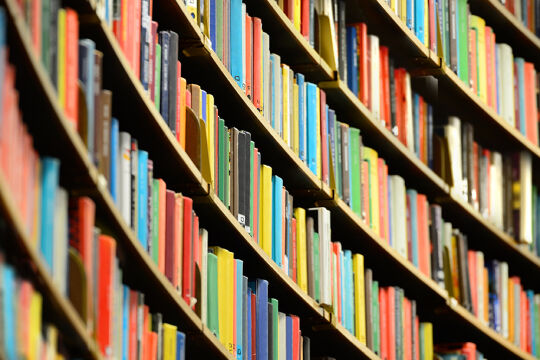Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
MIT DER KORF-BRILLE
Wenn man Zeitungsberichten glauben darf, ist Präsident Kennedy imstande, 1200 Worte in der Minute zu lesen, besser gesagt, ihren Zusammenhang in sich aufzunehmen. In der Praxis besagt das, daß er mit einem Roman durchschnittlicher Länge in einer guten Stunde fertig ist — und mit der ganzen Bibel in nicht einmal elf Stunden. Einer seiner Senatoren soll sogar einen Band Dickens in dreizehn Minuten verschlingen können — allerdings nach Absolvierung eines Kurses iin Schneilesen! In England und Amerika macht man sich anscheinend über das Lesetempo des modernen Menschen ernstlich Sorgen. Überall werden die Geschwindigkeiten gesteigert, warum nicht auch bei einer so alltäglichen Beschäftigung wie der Lektüre? Für unsere Väter und Großväter mögen 250 Worte in der Minute noch ausreichend gewesen sein. Das erstrebenswerte Ziel der Astronautenzeitgenossen sind 600 Worte in der Minute! Langsame Leser in schnelle zu verwandeln — das scheint eine Erziehungsaufgabe zu sein, für die spätere, besser rationalisierte und besser organisierte Generationen einmal dankbar sein werden. Deshalb auf in den Schnellesekurs und — freie Bahn dem Rasenden!
Man wundert sich eigentlich, daß vom Osten noch kein „Lies schneller,. Genosse!“ als Echo kam, keine Erfolgsmeldung, daß der Präsident oder der Senator von einem Lese-Stachanow um Worte oder um Minuten geschlagen wurde. Doch der Weltrekord im Geschwindlesen, schon vor einem halben Jahrhundert made in Germany. dürfte vorerst ohnehin im Lande Christian Morgensterns verbleiben. Der Erfinder Korf diese klassische Gestalt, die gerne schnell und viel liest, hat allerdings die Technik zu Hilfe genommen, um der Langsamkeit zu entrinnen und Lesechampion zu werden:
„Es erfindet drum seis Geist
etwas, was ihm dem entreißt:
Brillen, deren Energien
ihm den Text — zusammenziehen I
Beispielsweise dies Gedicht
läse, so bebrillt, man — nicht!
Dreiunddreißig seinesgleichen
gäben erst — ein Fragezeichen!“ Die Korfsche Wuoderbrille wäre ein ideales Hilfsmittel für
müßte man wieder bei solchen drittrangigen Göttern so viel fortlassen, hinzusetzen, umbauen und verändern, daß etwas Neues herauskommt. Und das lohnt wieder nicht. — Auswahl der Übersetzung ist also häufig durch einen instinktlosen Geschäftsgeist diktiert.
Wie wird übersetzt? Nicht sehr schön. Es ist das ja eine schwere Sache, das ist wahr, und man kann sehr darüber streiten, wie eine ideale Übersetzung eigentlich aussehen soll. Soll die fremde Sprache hindurchschimmern? Soll der Sprachenkundige noch durch den Teig der Übersetzung, womit sie farciert ist, hindurchschimmern? Soll er Redewendungen anklingen hören? Den fremden Pulsschlag noch leise fühlen? Das ist die eine Möglichkeit. Oder soll sich die Übersetzung glatt lesen, so daß es ein Lob bedeuten soll, wenn einer sagt: „Man merkt gar nicht, daß das hier übersetzt ist.“ Das ist die andere Möglichkeit. Eines aber kann man verlangen: daß der Übersetzer beider Sprachen mächtig ist. Nicht immer ist er's.
Ich will noch gar nicht einmal davon reden, daß sich in einer Pariser Posse, die hier in einem deutschen Theater läuft, die Personen mit „mein Herr“ anreden, was ja wohl in einer Gesellschaftskonversation nicht gerade üblich ist. Aber schon Christian Morgenstern merkte in seinen „Stufen“ an, daß der deutsche Übersetzer holprig und fremd daherstelzt und, wenn er vertraulich tut, die dummen Modewörter seiner Alltagssprache gebraucht, wobei er sich denn auch noch meistens verhaut und so derb wird, wie es drüben, in angelsächsischen und lateinischen Ländern, nicht oft Brauch ist. Man muß eben nicht nur ein Lexikon, man muß auch Fingerspitzen haben. Die meisten haben nicht einmal ein Lexikon.
Ich besinne mich noch sehr gut, wie mir ein Freund einst in Paris ein französisches Manuskript zeigte, das schon kurze Zeit in einem deutscher Verlag gewohnt hatte. Der Übersetzer hatte das Werk des Franzosen bereits mit einem feinen Spinnennetz von Bleistiftanmerkungen überzogen, und da stand: „Dans le bar, il y avait quelques poules ...“ Und der deutsche Übersetzer hatte „poules“ unterstrichen und an den Rand geschrieben: „Was heißt das? Keine Ahnung!“ Natürlich, Hühner konnten es nicht sein, die da pickten, und daß es „Mädchen“ waren, wußte er nicht. Dann sollte er aber nicht übersetzen. „Babbirt“ von Sinclair Lewis soll, wie Fachleute nachgewiesen haben, von Fehlern wimmeln, und bei vielen anderen einstigen Modebüchern ist es gerade so. Woran mag das liegen ...? Es liegt daran.
Wer übersetzt? Übersetzungen werden leider miserabel bezahlt, und so wimmeln auf dem Literaturmarkt Legionen kleiner Parasiten herum, die den wenigen verdienstvollen Übersetzern das Brot von der Schreibmaschine weg übersetzen. Da gibt es arme Luder, die die sogenannten „Rohübersetzungen“ machen: der Mann mit der anerkannten Übersetzungsfirma „bearbeitet“ das dann, eine ganz und gar abscheuliche Arbeitsteilung, denn schon in der Rohübersetzung kommen die bösesten Dinge vor, und die sind schwer wieder herauszubekommen. Wenn man einmal mit angesehen hat, mit welcher Unverfrorenheit sich die meisten Übersetzer ans Werk machen, mit welch völligem Mangel an Kenntnis von Land, Grammatik und Lebensgewohnheiten der anderen, dann wird einem himmelangst, und man wundert sich über gar nichts mehr. Zum Übersetzen von guten Sachen ist der Beste gerade gut genug — aber machen tut es irgendein Stückchen Unglück, das sich seinen Lebensunterhalt küm-irerüch damit verdienen muß. Und daher Tempo, Flüchtigkeit und Qualität der Übersetzung. '
Es ist ein Jammer. Das internationale Urheberrecht hat diese so wichtige Sache kaum geregelt, und wenn es sich nicht um einen sehr mächtigen Autor handelt, dann ist der Schöpfer des Werkes ziemlich ohne Einfluß auf die Gestalt, in der sich sein Kind im andern Land präsentiert. Wenn er erst erschrickt, ist es zu spät.
Da es schon ein großer Kerl sein muß, der die Wogen der heimischen Sprache so überragt, daß sein Kopf auch noch von fern her sichtbar ist, so verlohnt es sich, den Übersetzungen mehr kritische Aufmerksamkeit zuzuwenden. Ob Snobs, die so tun, als hätten sie mit der Mistinguett noch gespielt, wie die so klein war, falsch oder richtig über Frankreich unterrichtet werden, ist ziemlich gleichgültig. Wir anderen aber hätten gern Hamsun, Tolstoi, Lewis, Kipling auf Deutsch so gelesen, wie sie v/irklich geschrieben haben.
Copyright h Rou'od/t-Vcr/ag, Hamburg
alle, die im Raketentempo über die Seiten und durch die Bücher eilen — angefangen vom Präsidenten bis hin zu den von Berufs wegen diagonal lesenden Buchhändlern. Bei diesen müßte ohnehin ob der immer schneller lesenden Prominenz und ob der Geschwindigkeitskurse eitel Freude herrschen. Denn hat eine erhöhte Lesegeschwindigkeit nicht einen erhöhten Umsatz im Gefolge? Leute, die schnell fahren, wollen und kommen weiter und brauchen deshalb mehr Benzin. Leute, die schnell lesen, wollen und kommen weiter und brauchen deshalb mehr Lesestoff. Vollkommen logisch.
Vielleicht sollten, wenn dieser Schluß akzeptiert wird, ein paar Autoren in die hinteren Regale verbannt werden, Autoren, die es schlecht vertragen, wenn bei ihnen Lesen nur Orientierung, Übung, Gewohnheit oder gar Rennsport ist. Goethe gehört dazu, denn seine Maxime: „Die guten Leutchen wissen nicht, was es einen für Zeit und Mühe kostet, um lesen zu lernen. Ich habe achtzig Jahre dazu gebraucht und kann noch jetzt nicht sagen, daß ich am Ziel wäre“, paßt in keiner Weise zur Leseraserei derer, die auf Schnellgang geschaltet haben. Darüber hinaus alle seine schreibenden Kollegen, deren Bücher man „urteilend genießt“, bei denen die Lektüre zum Erlebnis wird.
Wahrscheinlich wird in unserer Zeit auch einmal so etwas wie ein Schnellesewettbewerb kreiert werden. Als Preise bieten sich dann Wortfolgen an, die in die Millionen oder Milliarden gehen und zu Büchern zusammengefaßt sind. Sollte man den Preisträgern nicht noch 79 Worte Hofmiller mitgeben (beim Kennedy-Tempo also Lesestoff für vier Sekunden), die ganz unzeitgemäß auf die Fragwürdigkeit des schnellen und die Notwendigkeit des richtigen Lesens hinweisen.
„Wir können nicht mehr stillsitzen und dem Erzählen folgen, können keine Entwicklung mehr erleben, kein Ende abwarten. Wir haben keinen Sinn mehr für die Anmut der sich schlängelnden, die Lockungen der im weichen Grase sich mählich verlierenden, gelegentlich kreuzenden und verwirrenden Pfade; wir rennen atemlos der Nase nach ans Ziel, um es zu empfinden, daß es sich nicht lohnte, es zu erreichen. Sollte es sich wirklich nicht lohnen, wieder den Genuß des Lesens zu üben, wieder lesen zu lernen?“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!