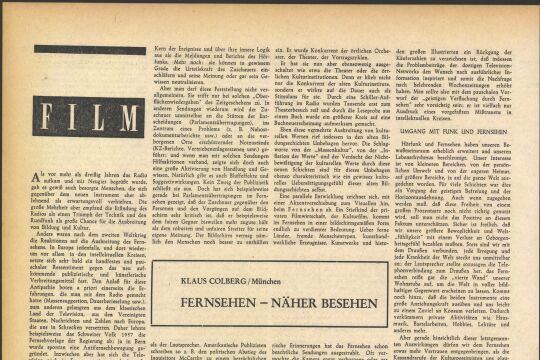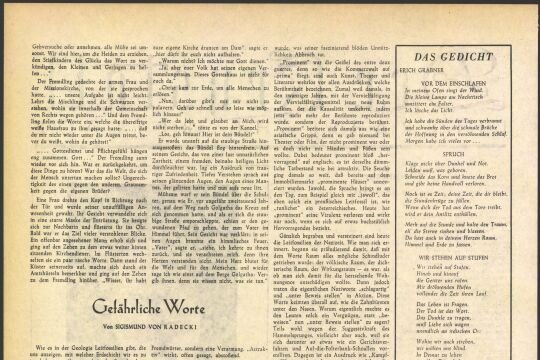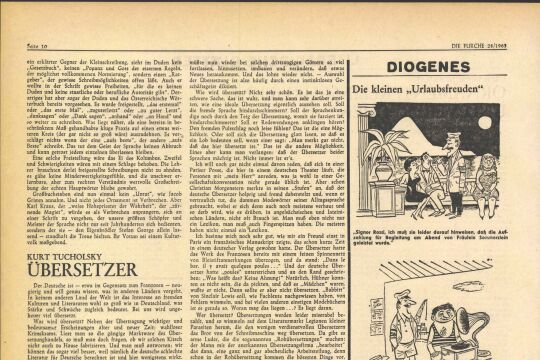Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Programmatisches zum Rundfunkprogramm
„Bewundert viel und viel gescholten“, wie Helena, steht die anziehende und gelästerte Erscheinung des Rundfunks vor uns, immer noch Begeisterung und Abwehr erregend, trotz den 30 Jahren, die seit der Popularisierung dieses modernen geistigen Mediums verflossen sind. Publikumskritik ist natürlich meistens allzu subjektiv; darin und nicht etwa in sachlicher Unrichtigkeit liegt die Gefahr kritischen Dilettierens. Aber daraus ergibt sich in Hinsicht auf die grenzenlose Spannweite des heutigen Radioprogramms die Frage: Wie ist dieses Programm überhaupt zu beurteilen und wer wäre zu solcher Kritik berufen, könnte eine umfassende Rundfunkkritik von einer einzelnen Person geleistet werden? Nun, in einem guten, alten Fremdwörterbuch wird „Kritik“ definiert als „Urteil über etwas, sofern dadurch das Echte vom Falschen gesondert, Wert und Wesen von etwas bestimmt wird“. Ja, darauf hin sollte man auch das Radioprogramm betrachten. Ganz falsch wäre es nämlich, Spezialisten über Spezialisten referieren zu lassen. Denn z. B. der rasende, vierzehn Minuten dauernde Monolog eines völlig in sich gekehrten Völkerrechtlers, der in wahrscheinlich höchst raffinierter Weise den Inhalt einer Semestralvorlesung in die kleine Zeitspanne pfercht, dieses öffentlich gehaltene wissenschaftliche Privatissimum darf gerade von dem Fachkollegen dieses Gelehrten nicht beurteilt werden, welcher vielleicht im weiten Aether der einzige war, der da mitkam, weil er das alles sowieso wußte, während alle andern dastehn und nicht’ wissen, wie ihnen geschieht. Es kommt also bei der Vielschichtigkeit der Hörerschaft im Rundfunk nicht allein darauf an, ob eine Sendung inhaltlich gut oder schlecht ist, sondern vor allem darauf, was sie dem mehr oder minder guten Durchschnittshörer zu geben vermag. Mit dieser Bedingung sollen durchaus nicht unerfüllbare Hörerwünsche und ungerechtfertigte Meinungen vertreten werden, denn mag auch — nach einem überdemokratischen On-dit — Volkes- stimme Gottesstimme sein, sie ist jedenfalls zu vielstimmig, als daß sie programmtechnisch völlig in Einklang zu bringen wäre.
Darum dürften auch Sendungen, wie „Ihre Meinung, lieber Hörer“ zwar psychohygienisch bedeutsam sein, weil sie den Hörern Gelegenheit geben, ihre Aggressionen auf harmlose Weise abzureagieren, aber der Ideenfundus einer Programmdirektion wird sich durch diese Gallupmethode nicht bereichern lassen.
Anderseits gibt es doch Hinweise, die bedacht werden sollten, kleine Entgleisungen zum Beispiel, die nur darum von Bedeutung sind, weil sie regelmäßig vorkommen, also eine falsche Regel schaffen. Die Herren Ansager etwa mögen sagen, was sie wollen, aber weder eine Symphonie noch ein Hörspiel kann „zur Sendung kommen“, es „wird gesendet“. Ebensowenig wird ein Aufsatz vor dem Mikrophon „zur Verlesung gebracht“. Wohl aber muß der Musiker seine Noten, der Sprecher seinen Text zur Sendung bringen, das heißt m i t bringen, andernfalls müßten sie ja nachher auswendig musizieren oder deklamieren. .Wenn hingegen ein Nachrichtensprecher einmal ein wenig stottert, so ist das zwar nicht in Ordnung, aber doch kein Malheur von bemerkenswertem Ausmaß: Nachrichten sollen neu, verständlich und — womöglich — wahr sein. Anders steht es mit dem Buchstabieren von fachlichen Erläuterungen, beispielsweise einführenden Worten vor Konzerten und Opern. Da wirkt es recht unbehaglich, wenn der — manchmal sowieso verständnisarme — Text ohne Verständnis gelesen, um nicht zu sagen gestottert wird, so daß man sich rot-weiß-rot ärgert, wenn sich aus jeder kommunen „Fermate“ eine seltsam stockende „Ferm - - ate“ ergibt.
Was die sogenannte Radiobühne betrifft, so ist es eine Frage, ob sie eine Art Heimkino bilden oder Theater ins Haus bringen soll, besonders für die vielen, die aus pekuniären oder anderen Gründen selten oder niemals ins Theater gehen. Im ersten Fall dient sie nur der Bequemlichkeit; der körperlichen, weil sich der Hörer den Weg ins Kino ersparen kann, und der geistigen, weil sich alles Filmische gewöhnlich in einem mehr oder minder gescheiten Handlungsschema erschöpft. Echtes Theater aber ist und bleibt ein Wortgefecht, entstanden aus dem ordnungsschaffenden Weltgefühl eines schöpferischen Menschen. Der „Hörfilm“ wird sich daher so lange, bis das Fernsehen Allgemeingut geworden ist gerne auf aparte Geräuschkulissen verlegen, er wird Romane in sogenannte Hörspiele umschneiden, die unter Umständen aufregend ausfallen können, aber nicht spannend im Sinne des epischen oder des dramatischen Kunstwerks. Die wesentliche Leistung der Kunst dürfte ja immer dann erreicht sein, wenn etwas Vergängliches, also ein Erinnerungswert, so durch sie wiedergegeben wird, daß der Empfangende den Eindruck eines Ewigkeitswertes gewinnt. Damit ist alles über die kunstgewerblichen Erzeugnisse von Situationsfabrikanten gesagt, ob solche Fertigwaren nun offen als das angeboten werden, was sie sind, oder verschwenderisch mit Beethovenscher Musik als Tonkulisse verbrämt wurden. Da Radio nichts als eine technische Neuerung vorstellt, die sich an den Gehörsinn wendet, kann es nur über zwei Elemente der künstlerischen Gestaltung verfügen: Wort und Musik. Geräuschkopien, also akustische Täuschungen, haben mit Kunst nicht das mindeste zu schaffen. Sparsam dosiert sind sie ein Hilfsmittel, welches das platte Kapieren des szenischen Zusammenhanges erleichtert, ohne das tiefere Verständnis zu berühren, für den primitiveren Hörer allenfalls ein peripheres Reizmittel, das ihn ersatzweise von außen her in Stimmung bringen will, anstatt von innen durch den geistigen Vorgang des Begreifens. Der Regisseur ist, ganz allgemein, heute eine der überheblichsten Figuren des Kunstbetriebes.’ Und wenn man hört, daß er ja nichts als ein „Diener am Wort“ sein wolle, so sagt man sich: Schön; dann dienert er eben-zu viel herum.
Auch die obligaten Kürzungen ergeben ein heikles Problem. Der Stundenplan des Rund-’ funks ist beinahe unantastbar, sehr im Unterschied zu einem Bühnenklassiker. Nur selten entschließt man sich, einem Theaterstück so viel Zeit zu widmen, als dem Original entspräche. Was der Hörer auf diese Weise kennenlernt, ist in vielen Fällen der Leichnam eines Kunstwerkes. So bekamen wir einmal im Verlaufe einer Faust-Aufführung mit dezimiertem Text auf die Worte Gretchens, „Sag niemand, daß du schon bei Gretchen warst!“, die unwirsch wirkenden Worte zu hören: „Oh, wär’ ich nie geboren!“ Eine recht lieblose Entgegnung aus Anlaß der Erinnerung an ein Liebeserlebnis. Es scheint, als hätte Faust den Verstand verloren. Aber nein, verloren gingen nur die dazwischen liegenden 13 Verse, in denen ihm Gretchen das blutige Ende vor Augen hält, das ihr bevorsteht, so daß er sie schließlich, von Entsetzen gepeinigt, mit den Worten unterbricht: „Oh, wär’ ich nie geboren!“
Und weil jetzt vom Theater die Rede war: Es scheint auch recht zweifelhaft, ob es ein gutes Beispiel gibt, wenn Angehörige des Burgtheaters über den Aether Reklamesendungen für Schnapsfirmen durchführen oder ‘ wirtschaftspolitische Schnapsideen verzapfen. Man könnte ihnen zu bedenken geben, daß - sie sich einer Bühne verschrieben haben, die sogar auf das Heben des Vorhanges auch bei stärkstem Applaus verzichtet, und daß es nicht Sache des Rundfunks sein kann, die traditionsstrenge Ehre des Nationaltheaters zu schmälern, indem er es zuläßt, daß sich bedenkenlosere Mitglieder desselben zu Ausruferdiensten vor dem Mikrophon verdingen.
Heilige Zeiten verlangen vom Rundfunk entsprechende Stücke. Wir haben aber Festtage erlebt, deren Bräuche die dann übergermanisch als „Brauchtum“ bezeichnet werden acht Tage hindurch in Dur und Moll, in weltanschaulichen Gesprächen, wissenschaftlich betrachtet also „brauchtums“- mäßig, sprachgeschichtlich, aus dem Barock und von der in solchen Fällen noch immer aktuellen Commedia dell’arte her, brettlhaft aufgelockert und zum Hörspiel verarbeitet — „zu Gehör gebracht" wurden, so daß uns Hören und Sehen und vor allem der Sinn zum richtigen Feiern vergangen war, als die Festtage anheben wollten. Notwendig ist, daß das Programm an einem Festtag zu diesem paßt, daß einem beim Zuhören festtäglich zumute wird, nicht aber, daß das spezielle Fest andauernd genannt, beredet und besungen wird.
Interviews mit Fußballergattinnen und anderen Prominenten gehören zu den ärgsten Strapazen des empfindlicheren Hörers. Ob Dichter, Olympionike, Politiker, Operntenor, Filmstar oder Weltreisender, er muß zu der Suggestivfrage Stellung nehmen, wie ihm Wien gefalle und ob er sich freue, daß er da ist. Weder Cocteau noch Eugen Roth und auch keiij anderer brachte bisher die Zivilcourage auf, auf diese lokalpatriotische Fragerei die richtige Antwort zu geben. Das alles ist nicht „echt österreichisch“, denn so provinziell ist der Oesterreicher gar nicht. Es liegt am Personal. Junge Leute sollen Möglichkeiten haben, gewiß, aber nicht allzu freie Hand, dazu gehört Erfahrung.
Es gäbe noch vieles zu wünschen, was manchmal zu wünschen übrig laßt: daß auch Sportreportagen Niveau haben können; daß ein staubtrockener Vortrag eines Dozenten um keinen Tropfen saftiger wird, wenn eine Damenstimme geistlose Zwischenfragen stellen muß, auf die kein normaler Mensch von selbst käme; daß solidarische Sendungen des „Oesterreichischen Rundfunks" womöglich solidarisch gesendet werden sollten, weil sonst der Geist der Solidarität nicht zustande- kommt; daß die große Beliebtheit der verschiedenen Tageskommentare einen Beweis für die innere Unsicherheit der Gegenwartswelt liefert und den Verantwortlichen die Verpflichtung auferlegt, derlei Sendungen sachlich und gedanklich so seriös wie möglich zu gestalten — denn auch da plaudert so mancher unbefangen aus der Schule, in der er wenig gelernt zu haben scheint; und daß die vielberufene Unterbewertung der geistigen Arbeit nicht nur den Auftraggebern angelastet werden darf, sondern auch denen, die sich ihrer unterfangen, ohne sie leisten zu können. Daher stellt es eine wichtige, wenn auch undankbare Aufgabe jeder Programmleitung vor, solche Leute mit freundlicher Bestimmtheit vom Mikrophon zum Lautsprecher zurückzuweisen. Vielleicht auch, daß ein Zyklus von 40 bis 50 Franz-Schmidt- und Bela-Bartok-Konzerten innerhalb weniger Monate keinen Sinn hat, weil man einen Komponisten dieser und jener Art nicht mit Gewalt populär machen kann. Jeder Höhenflug ohne Hörer wird zur Verstiegenheit. Damit wird nicht der Heurigensendung das Wort geredet, aber der Kunst, jedes Thema mit der unbedingten Ambition anzugehen, es möglichst vielen Hörern begreiflich zu machen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!