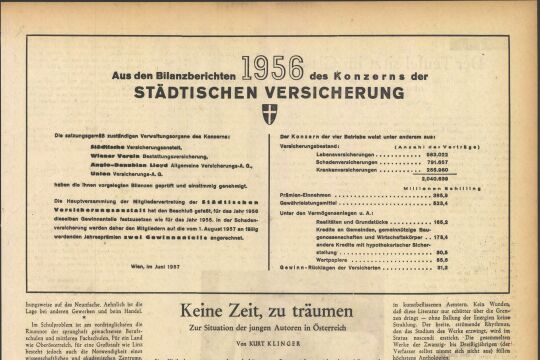„Katzenmusik“ - unvollendet
„Jetzt (wenn’s stimmt) bin ich endlich in der richtigen Richtung mit dem Manus“, heißt es in einem Brief, den mir Gerhard Fritsch am 10. November 1968 schrieb. Bei dem „Manus“ handelte es sich um den Roman „Katzenmusik“, an dem er buchstäblich bis zuletzt, bis zu seinem Selbstmord am 22. März 1969, arbeitete. Dieser Roman und zwei kürzere Erzählungen aus dem Nachlaß, „Ihre Kreuzigung betreffend" und „Die Vorstellung“, werden demnächst, fünfzig Jahre nach Fritschs Geburt und fünf Jahre nach seinem Tod, veröffentlicht.
„Jetzt (wenn’s stimmt) bin ich endlich in der richtigen Richtung mit dem Manus“, heißt es in einem Brief, den mir Gerhard Fritsch am 10. November 1968 schrieb. Bei dem „Manus“ handelte es sich um den Roman „Katzenmusik“, an dem er buchstäblich bis zuletzt, bis zu seinem Selbstmord am 22. März 1969, arbeitete. Dieser Roman und zwei kürzere Erzählungen aus dem Nachlaß, „Ihre Kreuzigung betreffend" und „Die Vorstellung“, werden demnächst, fünfzig Jahre nach Fritschs Geburt und fünf Jahre nach seinem Tod, veröffentlicht.
„Katzenmusik“ ist ein Fragment. Das ist eine Feststellung, die vor edlem den Umfang des Ganzen betrifft, sie betrifft nicht die Qualität der einzelnen Kapitel, die als ausgearbeitet und in sich fertiggestellt anzusehen sind. Bloße Notizen und Skizzen wurden weggelassen. Fritsch schrieb nicht fortlaufend, sondern begann offensichtlich an verschiedenen Stellen zu arbeiten, förderte diese Kapitel bis zu einem gewissen Punkt, um sich dann wiederum neuen Abschnitten oder der Vervollständigung und Verbesserung früherer zuzuwenden. Da keine Willens-, äußerungen über die Reihenfolge der Abschnitte und auch keine Angaben über Anfang, Verlauf und Ende einer Handlimg vorhanden sind, war ich bei der Ordnung des vorliegenden Materials auf inhaltliche Kriterien, aber auch auf Mutmaßungen angewiesen. Dabei hatte ich natürlich keinen „historisch-kritischen“ Ehrgeiz. Die vorhandenen Teile lassen im übrigen erkennen, daß Fritsch in „Katzenmusik“, über den letzten vollständigen Roman „Fasching“ hinaus, im sogenannten „diskursiven“ Erzählen weitergehen wollte. So sind die einzelnen Kapitel zwar in sich ausgefeilt und auch thematisch und formal emheitlich, aber untereinander sehr verschieden. Es wechseln Erzählhaltung und Erzählstandpunkt, episodenhaft durcherzählte „Geschichten“ („Swedek kniet vor der Dame“, „Die Hunde“) mit Arrangements und Montagen von Sätzen aus Fremdenverkehrsprospekten („Besuchen Sie Frauenberg“) und konventionellen Gesprächs- phrasen (,JCüß die Hand, Baronin“) usw. Auch das häufig .adressierte „Du“ ist nicht identisch, einmal wird der Leser, ein anderes Mal eine Gestalt der Erzählung, schließlich sogar in einer Figur, die die Poetik „Subjectio“ nennt, der Autor selbst angesprochen. Neben verschiedenen formalen, grammatikalischen und stilistischen Unterschieden, die einen Eindruck großer Heterogenität machen (die sieh je nach literarischem Geschmack als reizvolle Vielfalt preisen oder als Brüchigkeit und Disparatheit denimzieren läßt), gibt es aber auch ausgesprochen einheits- stiftende Merkmale, vor allem im Inhaltlichen. Auch Atmosphäre und Stimmung halten die Kapitel zusammen und lassen sie als Teile eines übergeordneten Ganzen, eines „Romans“ eben, erscheinen. Der Ton macht die „Katzenmusik“. Ich möchte diese Einheitlichkeit und Homogenität als elegisch-ironisch, erotisch und schwermütig charakterisieren.
In den beiden angefügten Erzählungen „Ihre Kreuzigung betreffend“ und „Die Vorstellung“ handelt es sich um Brutalität als Brauchtum und um das Heimatmuseum als Kriminalmuseum. Sie erinnern an ähnliche Passagen in „Fasching“, haben aber ihrerseits die Substanz ganzer Romane und geboren für mich zum Besten, was die österreichische Literatur seit dem Krieg hervorgebracht hat.
Es wäre schade, wenn gerade die letzten schriftstellerischen .\rbeiten Gerhard Fritschs weniger mit lite- ratischem Interesse als vielleicht mehr mit einer Art vorwitziger Neugier am Schicksal ihres Verfassers (,3purensuche“) gelesen würden. Ich wünschte ihnen vielmehr Leser, die von der Situation und der Biographie Fritschs, soweit das möglich ist, ab- imd auf den Text hinsehen. Die Texte aber bedürfen nicht der Nachsicht und des Mitleids, sie brauchen auch nicht die Sensation und den Skandal des Todes. Die Richtung war wirklich richtig, und wie groß auch die Verzweiflimg gewesen sein mag, und wie groß auch der Anteil der
Sorgen mit der „Katzenmusik“ an dieser Verzweiflung gewesen sein mag — Gerhard Fritsch ist nicht gescheitert. Alle unmittelbaren Gleichungen zwischen Leben und Kunst, die ein vorschneller Psychologismus mit den Vokabeln „Scheitern“ imd „Bewältigen“ herstellt, sind ein wenig kurzschlüssig tmd problematisch. Was soll man in diesem Leben, das in jedem Pali tödlich endet, auf dem Wege des Papiers schon „bewältigen“ …
Gerhard Fritsch hat nicht nur von den Büchern anderer gewußt, was sie wert sind, er hat auch von der Qualität seiner eigenen eine genaue VorsteUimg gehabt. Vom „Fasching“ schreibt er etwa in dem erwähnten Brief: „Ich bilde mir nämlich ein, daß mehr drin steckt, als die meisten Rezensenten angemerkt haben.“ Gerade weil er wußte, was Literatur ist und sein kann (Otto Breicha: „Er muß ganze Bibliotheken ausgeleseri haben“), konnte er immer wieder in selbstquälerische Zweifel verfallen. Dann geschah es eben, daß er einmal, als man von ihm etwas Eigenes erwartete, einfach aus den eben erschienenen „Rändern“ von Jürgen Beoker vorlas, weil er davon begeistert und der Meinung war, das müßte jetzt unbedingt zur Kenntnis genommen werden. Über den Herausgeber und Förderer Fritsch braucht man wohl sowieso kein Wort zu verlieren. Er sprach von Emst Jandl, Peter Handke, Thomas Bernhard, Michael Seharang u. a. bereits lange bevor ihre Namen ln aller Munde waren.
Wenn Fritsch „gescheiten“ ist, dann nicht am Schreiben, sondern an unserer allgemeinen Unachtsamkeit (Ignoranz). Die Literaturpreise, die er bekommen hat, zeugen kaum gegen diese Behauptung, die Auflagenzahlen seiner Bücher aber leider dafür.
„Katzenmusik“, „Ihre Kreuzigung betreffend“ und „Die Vorstellung“ lassen sich schwer als „Botschaft“ oder „Vermächtnis“ lesen, sie sind im herkömmlichen Sinn sicher kein „Testament“ und keine „letzten Worte“. Dazu fehlt ihnen Gott sei Dank jede begräbnismäßige Feier- Uohkeit. Sie sind wortwörtlich: im- heimlich lebendig. Freilich dreht es sich bei der Vitalität, die sie auszeichnet, nicht um etwas Quicklebendiges oder Putzmunteres. Sie vergleicht sich eher mit der gärenden Kraft, die in eiternden und stark arbeitenden Wunden und Geschwüren steckt. (Franz Hiesel: „Rosa ist inmier die Farbe des Untergangs.“) Die dargestellte Leidenschaft ist ohne Pathos, sie ist eher Passion. Die beiden Geschichten und das Fragment handeln von allerlei Abartigkeiten. Und indem sie vom Rand handeln, sind sie „mitten aus dem Leben gegriffen“. In den Kurorten und Sanatorien vor allem zeigt sich, daß die Welt keine „Heilstätte“ ist.
Wie dem „Fasching“ fehlt auch diesem Buch alles Dezente, beide sind sie zu ihrem Vorteil atisgespro- chen indezent, die hohe Literatur war für Fritsch keine schöne Literatur. Ähnlich wie Bernhard schrieb Fritsch in seiner Art durchaus „peiniiche“ Bücher und ungebühr- liohe Geschichten — bei aller Kunstfertigkeit. Von dem Roman „Moos auf den Steinen“ vielleicht abgesehen, mit dem er als Epiker anfing (und später nicht mehr allzuviel anfangen konnte), hat er seine große literarische Meisterschaft nämlich nicht benützt, um zu stilisieren oder zu idealisieren — gerade zum Gegenteil. Deshalb haben seine Bücher den moralischen Vor2Mg der Ehrlichkeit und schonungslosen Offenheit, Tugenden, die ihn auch persönlich in einem Land konventioneller Freundlichkeiten und oberflächlicher Verbindlichkeiten zu vielen in Opposition brachten. Auch in der Kommunistischen Partei, der er angahörte, wurde er nicht heimisch. Als er sich durch die politische Entwicklung des Jahres 1950 und die Versuche der Kommunisten, aus Österreich eine Volksdemokratie zu machen, praktisch vor die Wahl zwischen Kommunismus und Patriotismus gestellt sah, entschied er sich für Österreich. Das änderte nichts daran, daß er einigen Hurrapatrioten auch weiterhin sehr verdächtig war. Opportunismus war seine Sache nicht. Und wenn auch sein ausgeprägter Sinn für Freun’dschaft und seine große Bereitschaft zu Solidarität verhinderten, daß er zum Außenseiter und Sonderling geworden wäre, so halte ich es doch für etwas mehr als einen geographischen Zufall, daß er zuletzt am äußersten Rand der Stadt Wien wohnte.
★
Seinen Umgang mit Tabus nenne ich mutig. Er war kein berufsmäßiger Zertrümimerer von Tabus, er war kein Abbruchunternehmer. Weil nim seine Darstellimgen von Lüge und Heuchelei nicht literarischer Zeitvertreib und unverantwortlicher Übermut sind, vielmehr aus Betroffenheit und Empörung kommen, treffen sie den Nerv, und zwar empfindlich. Seine Ironie ;md sein Sphtt haben nichts zu tun mit intellektueller Hybris aus Übersättigung, sie waren ihm ein Schutz imd eine Hilfe, um zwischen so viel Dummheit und Bosheit zu überleben …
Mut… nur Mut! Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an ein Gespräch, das wir anläßlich einer Tagung der österreichischen Studienstiftung PRO SCIENTIA in Brixen, Italien, führten, wo wir einander auch das einzige Mal persönlich trafen. Es war in imserer Gruppe von Psychopharmaka und Tranquilizern die Rede. Wir hatten einen starken Esser unter uns, und auch ich konnte über eigene Erfahrungen berichten. Fritsch sagte zwischendurch „Schlecht!“ und „Sehr schlecht!“, und dann: „Das wäre das letzte, was ich tun würde!“ Heute kommt mir dieser Ausspruch und die Haltung, die er anzeigt, für G. F. typisch tmd symptomatisch vor. Er wollte sich nicht betäuben und beruhigen und beschwichtigen lassen. Das deckt sich auch mit Erfahrungen, die mir andere mitteilten, die ihn besser kannten: Er wollte alles genau sehen, nicht wegschauen. Bei aller Hilfsbereitschaft anderen gegenüber, war er hart und ohne Mitleid gegen sich selbst. Die an ihm sichtbare Melancholie (Edwin Hartl: „Melancholie saß Gerhard Fritsch unterschwellig in seinem Gemüt und verriet sich oft genug in seiner Mimik: Seine Gesichtszüge konnten an ein Weinen erinnern, während er laut herauslachte“), diese Melancholie widerspricht der Härte und Mitleidslosigkeit keineswegs. Ja, sie war wohl mit der Preis für den Mangel an Selbstmitleid, der sich zuletzt bis zur völligen Gnadenlosigkeit in der Selbstzerstörung steigerte.