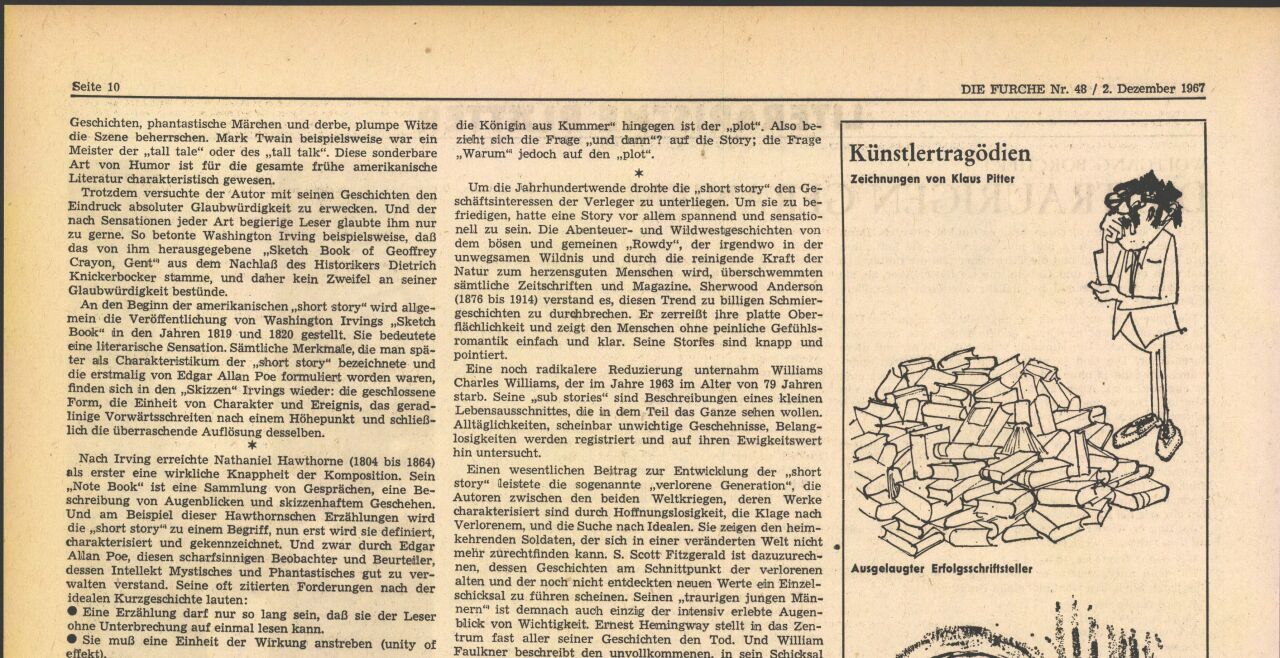
Geschichten, phantastische Märchen und derbe, plumpe Witze die Szene beherrschen. Mark Twain beispielsweise war ein Meister der „tall tale“ oder des „tall talk“. Diese sonderbare Art von Humor ist für die gesamte frühe amerikanische Literatur charakteristisch gewesen.
Trotzdem versuchte der Autor mit seinen Geschichten den Eindruck absoluter Glaubwürdigkeit zu erwecken. Und der nach Sensationen jeder Art begierige Leser glaubte ihm nur zu gerne. So betonte Washington Irving beispielsweise, daß das von ihm herausgegebene „Sketch Book of Geoffrey Crayon, Genit'“ aus dem Nachlaß des Historikers Dietrich Knickerbocker stamme, und daher kein Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit bestünde.
An den Beginn der amerikanischen „short story“ wird allgemein die Veröffentlichung von Washington Irvings „Sketch Book“ in den Jahren 1819 und 1820 gestellt. Sie bedeutete eine literarische Sensation. Sämtliche Merkmale, die man später als Charakteristikum der „Short story“ bezeichnete und die erstmalig von Edgar Allan Poe formuliert worden waren, finden sich in den „Skizzen“ Irvings wieder: die geschlossene Form, die Einheit von Charakter und Ereignis, das geradlinige Vorwärtsschreiten nach einem Höhepunkt und schließlich die überraschende Auflösung desselben.
*
Nach Irving erreichte Nathaniel Hawthorne (1804 bis 1864) als erster eine wirkliche Knappheit der Komposition. Sein „Note Book“ ist eine Sammlung von Gesprächen, eine Beschreibung von Augenblicken und skizzenhaftem Geschehen. Und am Beispiel dieser Hawthornschen Erzählungen wird die „short story“' zu einem Begriff, nun erst wird sie definiert, charakterisiert und gekennzeichnet. Und zwar durch Edgar Allan Poe, diesen scharfsinnigen Beobachter und Beurteiler, dessen Intellekt Mystisches und Phantastisches gut zu verwalten verstand. Seine oft zitierten Forderungen nach der idealen Kurzgeschichte lauten:
• Eine Erzählung darf nur so lang sein, daß sie der Leser ohne Unterbrechung auf einmal lesen kann.
• Sie muß eine Einheit der Wirkung anstreben (unity of effekt).
• Sie darf kein Wort enthalten, das nicht zur Erreichung dieser beabsichtigten Wirkung notwendig ist.
• Sie hat den Eindruck der Endgültigkeit zu erzeugen.
Noch ein — sehr wesentliches — Merkmal macht die „short story“ zu dem, was sie ist: der sogenannte „plot“1. Die „story“ der „short story“ beschränkt sich auf die Schilderung von Ereignissen in ihrer zeitlichen Reihenfolge; der „plot“ hingegen berücksichtigt bei dieser Schilderung die Kausalität. Er birgt Überraschung, Geheimnis, Effekt. Als klassisches Beispiel sei der Ausspruch E. M. Forsters zitiert:
Nach ihm ist der Satz „Der König starb und dann starb die Königin“ eine Story. „Der König starb und dann starb
die Königin aus Kummer“ hingegen ist der „plot“. Also bezieht sich die Frage „und dann“? auf die Story; die Frage „Warum“1 jedoch auf den „plot“.
*
Um die Jahrhundertwende drohte die „short story“ den Geschäftsinteressen der Verleger zu unterliegen. Um sie zu befriedigen, hatte eine Story vor allem spannend und sensationell zu sein. Die Abenteuer- und Wildwestgeschichten von dem bösen und gemeinen „Rowdy“, der irgendwo in der unwegsamen Wildnis und durch die reinigende Kraft der Natur zum herzensguten Menschen wird, überschwemmten sämtliche Zeitschriften und Magazine. Sherwood Anderson (1876 bis 1914) verstand es, diesen Trend zu billigen Schmiergeschichten zu durchbrechen. Er zerreißt ihre platte Oberflächlichkeit und zeigt den Menschen ohne peinliche Gefühlsromantik einfach und klar. Seine Stories sind knapp und pointiert.
Eine noch radikalere Reduzierung unternahm Williams Charles Williams, der im Jahre 1963 im Alter von 79 Jahren starb. Seine „sub stories“ sind Beschreibungen eines kleinen Lebensausschnittes, die in dem Teil das Ganze sehen wollen. Alltäglichkeiten, scheinbar unwichtige Geschehnisse, Belanglosigkeiten werden registriert und auf ihren Ewigkeitswert hin untersucht.
Einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der „short story“ leistete die sogenannte „verlorene Generation“, die Autoren zwischen den beiden Weltkriegen, deren Werke charakterisiert sind durch Hoffnungslosigkeit, die Klage nach Verlorenem, und die Suche nach Idealen. Sie zeigen den heimkehrenden Soldaten, der sich in einer veränderten Welt nicht mehr zurechtfinden kann. S. Scott Fitzgerald ist dazuzurech-nen, dessen Geschichten am Schnittpunkt der verlorenen alten und der noch nicht entdeckten neuen Werte ein Einzelschicksal zu führen scheinen. Seinen „traurigen jungen Männern'“ ist demnach auch einzig der intensiv erlebte Augenblick von Wichtigkeit. Ernest Hemingway stellt in das Zentrum fast aller seiner Geschichten den Tod. Und William Faulkner beschreibt den unvollkommenen, in sein Schicksal verstrickten Menschen, der schon von vornherein zum Scheitern verurteilt ist.
Die „neue Generation“ nach dem zweiten Weltkrieg hat bereits ebenfalls ihren eigenen Stil gefunden, noch verhaltener, schmuckloser, kühler. Der im Jahre 1924 geborene Tru-man Capote ist in diesem Zusammenhang zu nennen, Jerome D. Salinger mit „Ein herrlicher Tag für Bananen-Asch“, Shirley Ann Grau und einer der jüngsten Autoren, der 1932 geborene John Updike mit „Zähne und Zweifel“.
Fünfzig Jahre jünger, bekennen sie sich zu Sherwood Andersons Wort: „Die wirkliche Geschichte unseres Lebens ist eine Geschichte von Augenblicken.“
Von den vielen Sünden, die Österreich zu begehen pflegt, begeht Österreich die meisten Sünden gegen Österreich. Und von diesen meisten Sünden leiden viele darunter, daß sie notorisch sind, daß jede? Österreicher sie stets geläufig im Munde führt, so daß sie fatalistisch als chronisch'hingenom-men ^rden'und daß ihre Wiederholung weniger ein erbostes „Pfui Teufel!“ als ein fast befriedigtes „Hab' ich's nicht g'sagt?!“ auslöst.
Österreichs Sünden gegen Österreich sind institutionalisiert, kanonisiert, traditionalisiert. Österreich ist von ihnen und gegen sie imprägniert.
Eine Sünde besonderer Art scheint mir jedoch von dieser Gesetzlichkeit ausgenommen. Und wenn ich als typischer Städter hier einem typisch nichtstädtischen Kollegen meine Reverenz erweise, kann ich, wie mir scheint, dieser Ehrenpflicht sehr passend obliegen, indem ich an meine städtische Brust schlage und meinem nichtstädtischen Kollegen eine sehr landesübliche und bisher noch nicht recht einbekannte und wahrgenommene und dargestellte Sünde der österreichischen Stadt gegenüber der österreichischen Nichtstadt einbekenne.
Ich sage „Nichtstadt“ statt „Land“. Denn „Land“ ist ja sowohl das Ganze wie der Teil... und wenn es gar um Salzburg geht, wird das besonders verwirrend, da das Land namens Salzburg aus einer Stadt und dem dazugehörigen Land besteht, die sowohl einzeln (die Stadt) wie gemeinsam (die Stadt und das Land) Salzburg heißen.
Wenn ich das Land gegen die Stadt ausspiele, meine ich nicht das Ganze, sondern den Teil, das sogenannte flache Land, welches aber durchaus nicht flach ist, weder geographisch noch literarisch. Und wenn ich „Stadt“ sage, meine ich weniger Salzburg als Wien.
Das — sit venia verbo — literarische Wien blickt etwas naserümpfend und stark überheblich auf alles österreichische in der Literatur hinunter, welches nicht wienerisch beziehungsweise nicht mit Wien verbunden, nicht mit Wien identifizierbar ist. Man läßt äußerstenfalls noch Prag als literarischen Vorort von Wien mit an der städtischen Exklusivität teilhaben. Man unterscheidet, ohne es ausdrücklich zu sagen, eine Literatur erster und eine Literatur zweiter Klasse: die mit Wien verbundene und die andere.
Dumme Tröpfe haben kürzlich vor etwas mehr als tausend Jahren den Begriff der „Asphaltliteratur“ geprägt, und damit auch insofern Unheil angerichtet, als sie allen jenen, die betroffen wurden, ein gewisses Selbstgefühl vermittelt haben. Weil jene Feinde des „Alphalts'“ dumm waren, muß aber der Asphalt darum ebensowenig eine edle Substanz wie alles, was die Asphaltfeinde verdammt haben, zum Wertobjekt werden.
Dieselben Tröpfe haben gleichzeitig den „Boden“ aufgewertet. Darum muß aber keinesfalls alles, was des Asphalts entbehrt, automatisch verwerflich sein. Die Institution der Erde, und die Institution der Scholle und sogar die Institution namens „Blut“ und „Boden“' sind schon vor Adolf Hitler und
Aus der literarischen Welt
• Das nahezu völlig vergriffene Werk des österreichischen Philosophen Rudolf Kassner (geb. 1873) wird als Gesamtausgabe in sechs Bänden von Prof. Ernst Zinn im Verlag Günther Neske (Pfullingen bei Tübingen) innerhalb der nächsten zwölf Jahre ediert werden. Geplant ist außerdem ein Vorausband mit Beiträgen namhafter Gelehrter und den Ergebnissen des Kassner-Symposions 1963.
• Den Büchner-Preis 1967, der als bedeutendster deutscher Literaturpreis gilt und mit 10.000 DM dotiert ist, wurde Heinrich Boll zuerkannt. Die Laudatio hielt der Lyriker Rudolf Hagelstange.
Joseph Goebbels dagewesen. Man soll das Blut nicht mit dem Nationalsozialismus ausgießen.
Wir sind empfindlich gegen den Kitsch, und das mit Recht Aber Kitsch, findet nicht nur dort statt, wo gepflügt, gesät und geerntet wird. Und nicht jeder Pflug, jede Furche und jeder “Bauer sind konstitutionell kitschig. Seit wann entscheidet denn, bitte schön, der Stoff über die Qualität eines Kunstwerks? Nicht nur Defregger und Egger-Lienz haben Landschaften gemalt.
Wir Deutschschreibenden und Deutschlesenden in der Stadt sind von grandioser und lamentabler Inkonsequenz. Wir fressen das Land gierig in uns hinein, wenn es von Knut Hamsun gestaltet wird oder von Jean Giono oder von John Steinbeck oder von C. F. Ramuz (von diesem letztgenannten allerdings leider nicht ganz so gierig, wie es seiner Größe entspräche). Wir akzeptieren auf unseren Bühnen freudig das spanische Dorf Frederico Garcia Lorcas und das provencaiische Dorf Marcel Pagnols. Wehe aber, wenn ein Dorf, das wir auf der Bühne sehen oder von dem wir lesen, uns näher liegt! Die Erde, die wir meinen, darf eihe chinesische „Gute Erde“ sein, auch ein norwegischer „Segen der Erde“ schmeckt uns; wehe aber, wenn sie als Karl Schönherrs „Erde“ in Tirol gelegen ist! Heimat — das freut uns nur, wenn es aus der Ferne in unsere Gegend importiert wird. Wir nehmen mit Genuß den „Bitteren Reis“ zu uns; gibt man uns aber Hafer, dann werden wir störrisch!
Der größte österreichische Dichter ist im Vorland des Böhmerwaldes geboren worden und in Linz gestorben. Er hat uns den Hochwald und das Heidedorf verewigt und wurde vermutlich darum erst viele Jahrzehnte nach seinem Tod allmählich von den Nachgeborenen einigermaßen gebührend wahrgenommen. Er allein sollte durch sein gesegnetes Wirken über alle Zeiten und Welten veranlassen, daß wir Städter uns in Demut beugen vor dem, was außerhalb der Stadt geschrieben und beschrieben wird.
In der Stadt wird gutes und schlechtes Deutsch geschrieben. Außerhalb der Stadt wird gutes und schlechtes Deutsch geschrieben. Die Prosa von Franz Nabl, von Herbert Eisenreich und Marlen Haushofer, außerhalb Wiens geschrieben, ist besser als die in Wien geschriebene Prosa Jakob Wassermanns und Franz Werfeis. Die Prosa Heimito von Doderers, die Lyrik Josef Weinhebers und die Dramen ödön von Hor-väths, in Wien geschrieben, sind besser als die Innviertier Prosa, Lyrik und Dramatik Richard Billingers. All dies spricht nicht für und nicht gegen die Scholle und den Asphalt, sondern für die Größe der Großen und die mangelnde Größe der anderen. Es ist auch unerheblich, ob einer im „Dritten Reich“ schreiben und publizieren durfte oder nicht, beides war sehr unangenehm. Das menschlich tragische Schicksal innerhalb und außerhalb der tausend Jahre ist Gegenstand der Biographie, aber unerheblich für den Rang innerhalb der Literaturgeschichte.
Zu Beginn des dritten literarischen Jahrzehnts unserer neuen Zeitrechnung hat Österreich gewisse Fortschritte in der Selbsterkenntnis zu verzeichnen. Die Frage, ob es „eine österreichische Literatur“ gebe, sollte darum im literarischen Österreich allmählich von der berechtigten, wichtigeren und weniger kindischen Frage abgelöst werden, worin die österreichische Literatur besteht. Eine entscheidender Aspekt dieser Frage wäre die Abgrenzung der wesentlichen österreichischen Literatur gegen den Kitsch und gegen den Provinzialismus. Hierbei würde es sich alsbald herausstellen, daß Kitsch und Provinzialismus auch in Wien und bedeutende Autoren auch außerhalb Wiens nachweisbar sind.
In diesem Sinn verneigt sich hiermit der Asphalt mit kollegialen Grüßen vor dem „Brot“.
Aus: „K. H. Waggerl, Genauer betrachtet“. Residenz-Verlag, Salzburg, 1967.




































































































