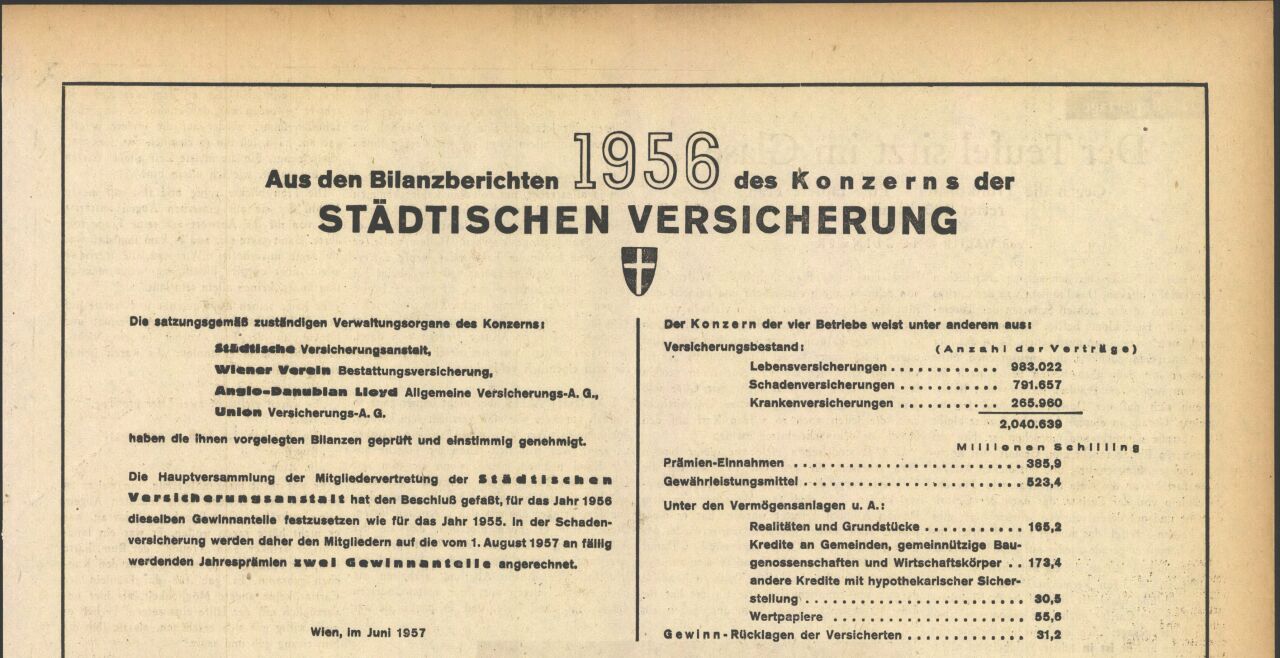
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Keine Zeit, zu träumen
Eine Weile hat es so ausgesehen, als könnte Wien zwischen 1950 und 1960 ein Zentrum deutschsprachiger Avantgardeliteratur werden, ähnlich dem Berlin der zwanziger Jahre. In keiner anderen Stadt kam es nach dem Krieg zu einer ebenso spontanen und üppigen Kreation einer jungen Literatur, genährt durch steten Zustrom an Kräften und Talenten aus den Rändern. Eine erste Welle war von jenen Autoren getragen, die den Krieg schon mit Bewußtsein und einiger Reife durchlebt "hatten, eine zweite von jenen, deren Entwicklung sthon in den Frieden fiel, wiewohl in ihnen noch Erschütterungen nachschwangen. Diese Jüngeren der Jungen entschieden sich bezeichnenderweise nicht mehr für einen realistischen Stil, sondern folgten surrealen, oder abstrakten Kunsttendenzen. Eine dritte Welle deutet sich bisher nur zaghaft an — sie scheint (wenn Voraussagen erlaubt sind) neben einem ziemlich substanzlosen modernen Eklektizismus wieder eine provinzielle Wald- und Flurbelletristik zu Ehren zu bringen. Das konservative Temperament des Oesterreichers schlägt in Kunst und Kunstpflege wieder stärker durch.
Inzwischen haben die jungen Autoren ein Alter erreicht, in dem das schützende Wort „jung“ effektive Mängel nicht mehr entschuldigen würde. Sie haben sich so lange im literarischen Gespräch erhalten, daß ihnen auch von den übelwollendsten Auguren die „Großjährigkeit" zugestanden werden muß. Die eigentliche Herz- und Nierenprobe steht ihnen jetzt erst bevor. Die Kritik hatte sich ihnen gegenüber (von einigen ressentimentgeladenen Entgleisungen abgesehen) bisher meist zurückhaltend bis milde gezeigt. Nun sind diese Autoren (wohl zu ihrem eigenen Nutzen) genötigt, dem vollen Gewicht kritischer Argumente standzuhalten — sie sind aus dem Stadium der Ansätze ins Stadium des Werks, ins Stadium des Beweises getreten.
Und da ereignet sich der seltsame Fall, daß die Erwartungen auf Schweigen treffen. Um manche, um die hoffnungsvollsten Namen liegt jetzt eine seltsame Stille, als befänden sich diese Dichter im Exil, seien irgendwann heimlich nach unbekannten Zielen abgereist und sendeten nur widerstrebend kurze Botschaften in die Heimat. Ist es nur ein vorübergehendes Zögern, ein vielleicht ängstliches Verharren auf der Schwelle zwischen den Stadien? Ein Atemholen und Kräftesammeln? Oder zeigt sich schon Erschöpfung an? Ein leiser, schweigendei Rückzug? Eine wortlose Rückgabe des voreilig von manchen Förderern gespendeten Lorbeers,
Stellen wir unumwunden die Frage, ob die junge Literatur versagt hat. Ein Ueberblick zeigt, daß die Kurzformen der Prosa mit wirklicher Kunstfertigkeit, mit Phantasie unc Eigenart gemeistert werden, zeigt eine Blüte dei Lyrik, dagegen ein Stagnieren aller umfassenderen Disziplinen. Der Roman, so er überhaupt gepflegt wird, erreicht bestenfalls mittlere Güte. Die Dramatik liegt beinahe völlig brach. (Am Massenangebot unveröffentlichter Dramen, das über die Dramaturgien hereinbricht, sind die jungen Autoren unschuldig — die Bühdel stammen von älteren bis ältesten Semestern.) Gerade im Roman und im Drama aber müßte sich das Stadium des Werks niederschlagen — dies Jj) eĮt jJdvermįęflę eęi !gęng .j3e d ;
den Nebensatz, bis ins unscheinbarste Bindewort. Sie erfordern „Bildung“, verstanden als Gesamtheit der dem Autor verfügbaren geistigen und sinnenhaften Erfahrungen, den Einsatz der gesammelten Persönlichkeit am Objekt, die Vereinigung aller in ihm möglichen Energien zu einem kontinuierlichen Ansturm.
Wir wollen nicht untersuchen, ob die jungen Autoren dieses strengeren Aufschwungs fähig wären. Die Frage nach der Potenz, nach der Gestaltungskraft, ist hinfällig, solange zu ihrer Entfaltung die Arbeitsbedingungen nicht gegeben sind.
Nichts vermöchte die Lage besser zu charakterisieren als eine Eintragung Julien Greens in der Emigration, datiert vom 4. September 1943 r „Neulich fragte mich jemand, ob ich Muße habe, ,für mich' zu schreiben. Ich gab zur Antwort, die meiste Zeit gehöre dem Office of War Information, daher sei für mich selber schreiben beinahe unmöglich. Das ist richtig, sagte da der Betreffende, den ich bis dahin nicht eben für einen besinnlichen Menschen gehalten hatte, man kann nicht schreiben, wenn man nicht Zeit zu träumen hat. Woher kommen sie denn, die Bücher, wenn nicht aus Mußestunden, da man seine Zeit zu vertrödeln scheint?“
Zeit, zu träumen — die jungen Autoren hatten sie vielleicht, während sie die Universitäten besuchten, während der ersten luft- und geistschnappenden Entwicklungsjahre, in denen es sinnwidrig gewesen wäre, sich für den nächsten Augenblick festzulegen. Sie hatten sie, solange ihrem Lebensrhythmus die Skizze, der Entwurf, das Fragment entsprach. Und sie helfen sich immer noch damit, daß sie in die Anfänge zurücktasten, sich mit Entwürfen begnügen, lyrisch-allzulyrischen Stimmungen sich hingeben, freiwillig das Gedankenfeld begrenzen, die Ansprüche an sich selbst auf das gerade noch Erreichbare reduzieren, um nicht in unlösbare Gewissenskonflikte zu geraten. Sie allesamt sind genötigt, ihre Kräfte zu zersplittern, wenn sie, im Bewußtsein des eigenen Wertes, ablehnen, sich gesellschaftlich aufs Niveau der Hausierer oder, wie Gorki sagte, der „Barfüßler“ zu begeben. Die junge österreichische Literatur ist engagiert, allerdings von keinem Weltbild, von keinem Kunstbekenntnis, sondern vom klein bemessenen Honorar, vom durchschnittlichen Lebensstandard, vom Betrieb in der Wirtschaft oder in kunstbeflissenen Aemtern. Kein Wunder, daß diese Literatur nur schütter über die Grenzen dringt — ohne Ballung der Energien keine Strahlung. Der breite, strömende Rhythmus, den das Stadium des Werks erzwingt, wird im Status nascendi erstickt. Die gesammelten Werke der Zwanzig- bis Dreißigjährigen (der1 Verfasser selbst nimmt sich nicht aus) füllen höchstens Anthologien.
Da der freie Künstler bin aussterbendes Insekt ist (von der Gesellschaft, die seinen; Stich fürchtet, zum Tode verurteilt), bleibt nur die Flucht in den „Hauptberuf“ oder die Flucht ins Literaturgeschäft, und wie weit das Geschäft von der inneren Route abzutreiben vew mag, dokumentierte jüngst ein junger Roman cier, der erklärte, seine Technik sei, nur erste sdfo wcSfii'en.y4’vifltä1 ¥,:lRöihan (Wft de Serfb©ääg der Autor zunächst keine Ahnung hat) hinzukonstruiert. Ein Beispiel für viele — ebenso bezeichnend für die Moral der Verleger wie für die Anfälligkeit der Autoren. Wahrscheinlich aber hat Brecht recht: „Nicht der Armen Schlechtigkeit habt ihr mir gezeigt, sondern der Armen Armut" — nicht gezeigt wurde, daß die Künstler gern die Kunst verraten, nur, daß der Verrat oft als einziger Ausweg bleibt.
Die meisten Autoren sind im Exil — als Bankangestellte, Bibliothekare, Lektoren, Reporter, Vertreter, Verkäufer —, doch werden sich bei uns die amerikanischen Glücksfälle „Vom Autowäscher zum Nobelpreisträger“ kaum ereignen. Wir sind zuwenig unbefangen.
Fragen wir aber weiter, was geschehen müßte, daß die junge österreichische Literatur aus der Stagnation findet und die Hürde nimmt, die sie zu lange schon hindert, die repräsentative Literatur Oesterreichs zu werden. Aeußere Hilfen sind wohl dazu nötig. Wichtiger und dringlicher aber ist die innere Befeuerung, ein Wiedererwachen des Solidaritätsgefühls, das noch um 1950 die jungen Autoren verbunden hatte. Es gibt nur ein Mittel gegen die schleichende Agonie — Agon, der geistige, der; schöpferische Wettkampf, der Wett-Eifer, der vom befreundeten Gegner das Beste verlangt, weil er selbst sein Bestes aufwendet.
Der Wille zur Auseinandersetzung schläft. Es wäre interessant, zu erfahren, ob irgendeiner der jungen Autoren ein intimes Tagebuch führt, in dem er seine geistigen Erlebnisse aufzeichnet. Ich möchte das ebenso bezweifeln, wie ich für unwahrscheinlich halte, daß ein ergiebiger, künstlerisch ernster Briefwechsel existiert. Welche Gespräche kreisen noch um Probleme der Gestaltung? Briefe und Gespräche freilich sind Poren der lebendigen Kunst — durch sie atmet sie, durch sie bleibt sie straff und geschmeidig, durch sie findet und wandelt sie sich. Sind diese Poren verschlossen, bleiben Trägheit und Eitelkeit (als Korrelate) nicht aus. Wir möchten nicht so pessimistisch sein wie eine Interpretin junger Literatur, die der Begeisterung der ersten Nachkriegsjahre nachtrauerte und fand, „wohin man griffe, mach man sich jetzt schmutzig" — aber eine Reinigung stünde uns nicht schlecht an und „geistige Leidenschaft“ — die wahre Mutter aller Dinge.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!



































































































