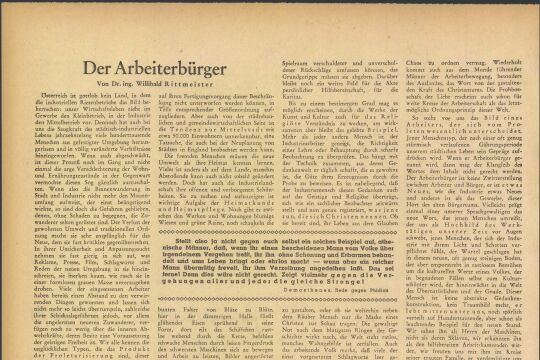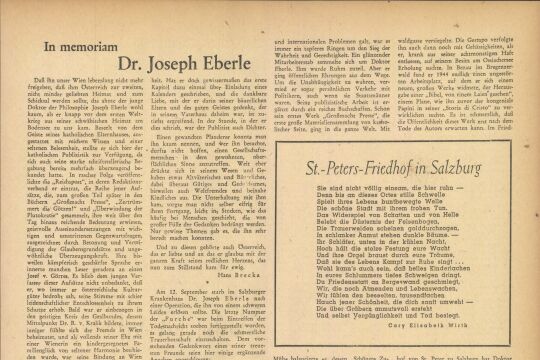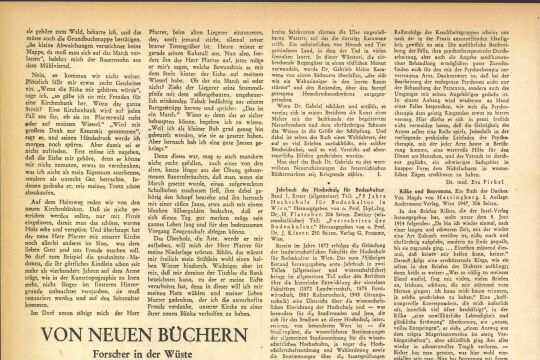Kurt Absolon, der Zeichner, ging zuerst. Leise lächelnd stand er noch da, mit dem Rücken zum Kachelofen, in der schiefen, erleichterten Körperhaltung all der Menschen, die sich während der Kriegsjahre angewöhnt haben, im Winter ständig die Nähe eines Ofens au suchen. Er hatte an jenem Tag, Jänner 1957, eine neue Hose an, die er bei einem Herrn Hawed gekauft hatte, in der Plankengasse in Wien; die erste neue Hose seiit dem Krieg, und dabei waren seither bereits zwölf Jahre vergangen. Er zeichnete dünn, seherisch, krause Realitäten auf das Strukturelle reduzierend, man könnte auch sagen, er zeichnete todesbewußt. In der Vorahnung des Todes. Die Abbildungen, die er mit dem Bleistift zu Papier brachte, waren stark in der Komposition, aber zart im Strich: das waren Zeichnungen eines Menschen, der nicht lange verweilte. War es mysteriös? Nein, es gibt eine innere Uhr. Noch 1958 starb Absolon durch einen Autounfall, an einer bösen Wegkreuzung im Burgenland, die es nicht mehr gibt.
Der Ofen, vor dem er damals, 1957, gestanden war, hatte gelbe Kacheln. Er wärmte. Flaubert hat Maupassant geraten, sich einen Ofen anzusehen und zu beschreiben, denn es gibt weder einen Hafner noch einen Wohnungsinhaber, der so einen Ofen länger betrachtet, zweckfrei, als Gegenstand, als Ding an sich. Darüber sprachen wir mit Absolons
Freund, mit Herbert Eisenreich. Ihm gehören Wohnung und Ofen. Drei kleine Zimmer. Er war gerade dabei, semen großen Roman zu konzipieren und einzelne Abschnitte sogar zu Papier zu bringen, „Sieger und Besiegte“, das Werk, das, fragmentarisch oder vollendet, aber in jedem Fall auftauchen wird aus der Verborgenheit, um durch seine bloße Existenz manche schiefen Maße einer lediglich erfolgsorientierten Literatur zurechtzurücken. Eisenreich trug eine braune Weste, gestrickt, mit weißen Arabesken, ließ den Rauch dickköpfiger Pfeifen steigen, tippte Roman, Erzählungen, Artikel auf einer alten schwarzen Schreibmaschine. Nachmittags waren wir manchmal im Cafe Raimund am Tisch von Hans Weigel. Abends gingen wir ab und zu in die Marietta-Bar.
Dort spielten oder sangen damals Bronn er, Kreisler, Qualtinger, Wehle und die Martini. Konnte man den Krieg noch spüren? Nein und ja. Es ging ja lustig zu, und roter Plüsch widerspiegelte gedämpftes Licht; man watete im golddurchwirkten Nebel. Aber Bronner antwortete auf den Krieg: durch die Härte eines Satirikers, der aggressiv sein muß, um nicht sentimental zu sein. Und Kreisler sang verhalten und nachdenklich und freilich mit einem Anflug von Selbstspott über seine verschämten oder unverschämten Melancholien. Auch hier ging es um
Verletzungen, die nicht recht heilen wollten. Und Qualtinger?
Damals versuchte er noch, den Schmerz zu überwinden durch jugendliche Lust an der Parodie, durch kabarettistisches Talent, durch das Vergnügen, immer neue Rollen zu spielen, dann aber wurden die Folgen jener psychologischen Verwundung übermächtig, und wie können wir gegen diese Übermacht bestehen? Mit der Hilfe von Alkohol, von monomanischen Verbohrtheiten, van neuen Frauen und »von neuen Visionen? Qualtinger hatte damals seih körperliches Volumei schon erreicht — dabei war er eigentlich ein schlanker Mensch, geistig und auch in der Physis! Und was da entstanden war, für die Umwelt sichtbar, war aus dem Leiden entstanden und als Selbstschutz. Wenn wir es durchaus mit kulturhistorischer Genauigkeit sagen wollen: hier ließ die Irritation durch Krieg, Nazismus, Nachkriegsgeldgier, die Maske eines tragikomischen Clowns entstehen. Mit dem „Herrn Karl“ hat er etwas später einen Höhepunkt erreicht. Der Geniestreich wurde in Österreich wie eine treffliche Attraktion einer immerwährenden Sprachzirkusakrobatik empfangen. Gspassig, fürwahr.
Einige retteten sich in eine Welt der feinen, verfeinerten, in ihrer kauzigen Subtilität kaum mehr überbietbaren Zeichen und Zeichnungen. Wie Paul Flora. Andere flohen in die emsige Aktivität, in die fiebrige Tätigkeit, in die Welt des Konkreten, wie Reinhard Federmann, der seine „Pestsäule“ herausgibt, als Generalsekretär den PEN- Club führt, im Beirat des ORF mittut, usw. Und manche haben die kühlen Amtsräume einer korrekt verwalteten Macht bezogen, wie der Feuergeist von einst, streitbare Katholik und rauschhafte Publizist, Kurt Skailndk.
Aber auch Flora ist ein Verwundeter, auch Fedenmann, auch Skalnik, und das individuelle Glück (wenn überhaupt) entsteht nur durch die Sublimierung jener Schmerzen, die all diese etwa fünfzigjährigen österreichischen Schriftsteller, Künstler, Publizisten miteinander verbinden. Eine einzigartige Generation! Sie war zu jung, um den Nazismus verursachen zu können. Und sie ist zu alt, um an der heutigen naiven Erfolgsgesinnung teilzuhaben. Sie hat weder die kühle passende Monomanie des Thomas Bernhard, noch die warmherzige Leidenschaftlichkeit des Peter Turrini. Sie ist in den Kriegs- und Nachkriegsjahren, sagen wir zwischen 1940 und 1950, verletzt worden. Tief. Und für ein ganzes Leben. Diese tiefe Verletzung ist es, die immun macht gegenüber den Verlockungen der tröstlichen Utopien. Und also könnte man diese ohnehin bereits durch den Krieg dezimierte Generation der Verwundeten freilich auffordern, die Arena zu verlassen, allein: die bit tere Erfahrung muß gestaltet, beschrieben, weitergegeben werden! In diesem Sinne sind auch das Flüchten zu Macht, Rang und Ansehen äußerst lehrreich: als eine Möglich keit, dem eigenen Schicksal auszuweichen, dem Zwang, alles zu beobachten und zu beschreiben.
Die Maler hatten es offenbar leichter, vielleicht durch die handwerkliche Komponente ihrer Kunst, durch die Möglichkeit, das sinnlich Erfaßte direkt ins sinnlich Wahrnehmbare umzusetzen. Der groß artige Zeichner Kurt Moldovan hat als Faun des Cafe Hawelka die Kurve genommen; Anton Lehmden hat das Todesbewußtsein in Schichtungen des Erdreichs umgesetzt; Mikl tobt sich aus; Wolfgang Hutter hat den Surrealismus von A. P. Gütersloh weiterentwickelt, hat eine völlig hoffnungslose, ganz und gar unwirkliche Welt erschaffen, die schön und galant sein muß, um nicht gleich aufzuplatzen und zu verbluten. Die große Hoffnungslosigkeit schwebt über Moldovans Vitalität, Lehmdens analytischer Verve, Mlkls unversöhnlichen Abstraktionen, Hutters scheinbar dekorativen Veduten •— und von Fuchs soll hier nicht die Rede sein, er war bei Kriegsende erst fünfzehn. Ein Kind also. Merkwürdig und mit feinen Strichen gezeichnet sind die Grenzen.
Es könnte sein, daß der Umgang mit Farbe, Terpentin, Leinwand, Modell und Vorbild durch die Dles- seitigkeit all dieser Phänomene tröstlich wirkt. Schreibende finden in ihrem Handwerk einen weniger sinnlichen Reiz. Es ist doch merkwürdig, und wie aus einem Schauerdrama, wenn einer berichten muß: Ingeborg Baohmann ist im Bett durch Zigarettenrauchen verbrannt, Paul Celan hat sich in die Seine geworfen, Gerhard Fritsch hat sich aufgehängt, Herbert Zand ist bei klarem Bewußtsein über all die Folgen seiner Krankheit gestorben. Sind Schriftsteller verletzbarer? Sterblicher?
Ich glaube es. Die Baohmann hat in der Literatur und im Leben die ihr adäquate Pose gefunden und diese führte zum Tod, denn die Bachmann wollte zwar nicht sterben, hatte aber eine beachtliche Anzahl von Dämonen versammelt um das Bett in Rom; Celan aber und Zand waren Opfer des Krieges, als verfolgter Jude aus Czernowitz der eine, als verletzter Österreicher der andere; und Fritsch, unser lieber Gerhard Fritsch hat letztlich durch seinen Selbstmord die Formulierung einer Frage auf sich genommen, die ungefähr so lauten könnte; Kann in Österreich ein bedeutender Schriftsteller schreiben, was ihm paßt, ohne dabei zu verhungern, oder muß er sich, um sich ernähren zu können, den staatlichen, den offiziösen oder den journalistisch sensationsbewußten Stallen unterordnen? Fritsch, der Mutlose, zwang sich zur Aktivität, zauderte, kehrte zur Literatur zurück und fand letztlich die radikale Antwort
Die meisten sind ihren Verwundungen nicht entronnen. Milo Dor wappnet sich mit der sprichwörtlichen Vitalität seines Heimatlandes, doch wird seine Lage durch die Problematik der Assimiliation noch erschwert österreichischer Schriftsteller serbischer Herkunft zu sein ist, und nicht nur für die germano- philen Rassenfanatiker, ein Kuriosum; auch anderswo regt sich klein staatliches, kleinstädtisches Denken, verdichtet sich zur Intoleranz. Dor ist als Zwangsarbeiter nach Wien verschleppt worden. Er leidet heute noch an den Folgen jener Verletzungen, die ihm damals zugefügt worden sind. Zudem sieht er sich gezwungen, aus dem Beispiel des Gerhard Fritsch zu lernen. Er ist die treibende Kraft all der Bewegungen, die die Einführung eines Biblio- theksgroschens fordern, damit alte und kranke Schriftsteller nicht verhungern müssen. Oder immer wieder von der Straßenbahn stürzen, da niemand da ist, der ihnen hilft. Wie Franz Theodor Osokor. Oder als Kostgänger ihr Leben fristen. Wie Felix Braun.
All dies bloß als Panorama der Kriegsauswirkungen zu schildern, wäre falsch. Zu ihnen gesellt sich in geringerer und später Mitschuld die Kulturpolitik dieser Republik, die nicht daran denkt, Wunden oder Verwundete zu heilen, da und dort geistige und finanzielle Vorbedingungen für gute Arbeit zu schaffen, sondern sich oft mit dem Prinzip begnügt: das ohnehin Berühmte sei zu rühmen und außerdem verpflichte man sich die noch gänzlich Unbekannten. Mäzenatentum? Gemeinsamkeit? Anteilnahme? Wenn die Verwundeten verrecken, dann werden sie durch Interventionen durchaus nicht daran gehindert.
Und doch stehen manche da. Immer noch. Erstaunlich. Herbert Eisenreich ist das wundersame Beispiel einer solchen Kraft: verletzt im Krieg, gedemütigt durch materielle Not, von sogenannten Kulturpolitikern verkannt, Bisenreich, der wichtigste Erzähler Österreichs seit Doderer, mit dem Meister innig verbunden; durch A. P. Gütersloh auch an manche tiefer liegenden Quellen der Inspiration herangeführt.
Für Österreich sind solche Männer unscheinbare Existenzen. Doderer lebte in einer bescheidenen, nicht sehr hellen Wohnung in einem Haus an der Währingerstraße in Wien, Gütersloh verbrachte die letzte Zeit seines Lebens in Baden, in einem hübschen Haus, das vorher ein Ziegenstall gewesen ist; Eisenreich haust in Tamsweg. Er hat immer wieder vieles aufgebaut und vieles verloren; er schrieb, wenn es durchaus sein mußte, auch über Autos, auch über Modelleisenbahnen, um zwischendurch zu seiner eigentlichen Aufgabe zurückzukehren: zur erzählenden Prosa. Es ist, wie gesagt, erstaunlich, daß er überhaupt noch in der Lage ist, sein’ episches Werk weiterzuführen.
Der fünfzigjährige Herbert Eisen- reich ist, ohne es zu wollen, zum Symptom der großen Krankheit geworden und zum Symbol der möglichen Überwindung. Eisenreich ist es, der die Kontinuität der österreichischen Epik im Sinne einer Erneuerung aufrechterhält. Die Meinung des Snobs fröhlich verachtend, hat sich Eisenreich mit den wenig überlebenden Gefährten in jenes bergende Zwielicht der ewigen europäischen Tavernen zurückgezogen. Hier erfüllt die Generation der Verwundeten ihre Pflicht: die Verletzung durch sprachliche Gestaltung bewußt zu machen, vielleicht zu überwinden.