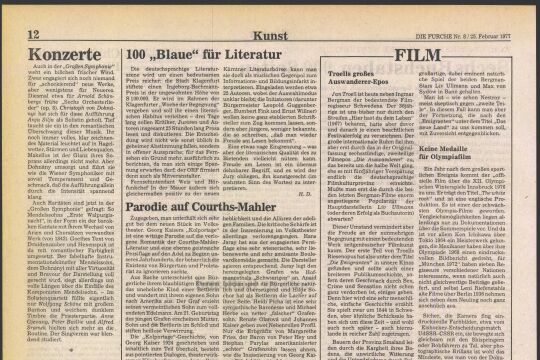Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Filme aus dem Osten
An der Spitze des Filmangebots dieser Woche steht — natürlich, möchte man langsam sagen — eine Wiederaufführung; anscheinend ist das Sammerwetter doch noch zu schön für einen Kinobesuch (wo ist es angenehmer kühl als in einem — selbstverständlich modernen — Kino?), so glauben zumindest die Verleiher und ziehen den voreiligen Sadsonbeginm der Vorwoche wieder zaghaft zurück...
Wer vor 16 Jahren den wirklich grandiosen russischen „ersten Tauwetterfilm“ versäumt hat, soll ihn sich jetzt unbedingt ansehen: „Wenn die Kraniche ziehen“, 1957, vier Jahre nach Stalins Tod gedreht, atmet den Rausch einer hoffnungsvollen Freiheit, die aber dann nicht lange gewährt hat. Der Film wirkt, als hätten zwei freudetrunkene Künstler, der Regisseur Kalatosow und der große Kameramann Urwsseioski (beide heute bereits verstorben), alle Zwänge von unzähligen unterdrückten künstlerischen Visionen (die unter Stalin als „Formalismus“ verboten waren und gefährliche Folgen hatten) auf einmal abgeworfen und eine Bildorgie unübersehbarer Detailschönheiten wie ein Vulkan ausgeworfen: da tobt, fährt, rast, kreist und schwenkt die Kamera, hebt sich in die Höhe, die Bilder verschwimmen, überblenden und stilisieren neue — ein optisches Bewegungskunstwerk wie es in der Filmge-schiohte selten erlebbar ist (nicht einmal Welles in „Citizen Kane“ wagte dergleichen — allerdings ist sein Stil auch ein anderer). Und dann die Schauspieler: die Tochter von Dowschenkos Hauptdarsteller in „Stschors“ Tatjana Samoilowa, schön, herb und unwahrscheinlich ausdrucksvoll, und der Neffe des großen Batalov aus „Aelita“ und
„Der Weg ins Leben“, Alexej — zwei Künstler, mit denen es eine Freude sein muß, als Regisseur schaffen zu können. Wenn Sie diesen wahrhaft zeitlos-großen Film noch nicht gesehen haben, versäumen Sie ihn nicht — und wenn Sie ihn schon kennen, werden Sie sich ohnedies noch einmal das Erlebnis bereiten...
Wir tun hier den fernöstlichen Abenteuerfilm, die Karate- oder Kung Fu-Filime aus Hongkong und den anderen noch freien fernöstlichen Staaten verächtlich als Abenteuermist ab — weil wir uns für andere als die österreichische Mentalität nicht interessieren und an-dernteils die von dort kommenden Filme nach deutscher Synchronisation ohnedies nur mehr brutal zusammengeschnittenes Stückwerk sind, in dem alles bis auf Grausamkeiten und Action entfernt wurde. Wer sich aber die Mühe macht und über das häßlich-sadistische Äußere hinweg diesen fernöstlichen Fümstil zu studieren versucht, wird unter dem allwöchentlichen Klischeegeschehen interesante Dinge entdecken; so vor allem, wie unerhört geschickt man den westlichen Filmstil zu kopieren, ja ihn zu übertrumpfen versteht. „Der Mann von Hongkong“, eine Australien-Hongkong-Gemeinschaftsproduktion, übertrifft an Perfektion jeden bisherigen James-Bond-Film und Nachfolger an Können, handwerklicher Routine und artistischer Actionsbeherrschung (des Hauptdarstellers Wang Yu, eines fernöstlichen Stars und Schauspieler-Millionärs) alles, was Hollywood bisher zu fabrizieren verstand. Allerdings auch an Grausamkeit — und das bewirkt hier garantiert nicht der chinesische, sondern der weiße (Ge-schäfts-)Einfluß. Leider ...
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!