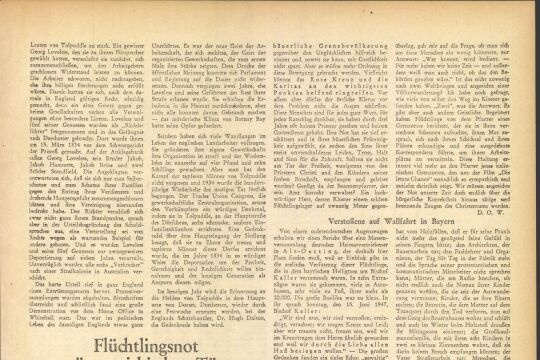Eigentlich hatte Elias Bierdel genug. Nach mehr zehn Jahren, in denen er als Journalist und Menschenrechtsaktivist auf die Menschenrechtsverletzungen an Europas Außengrenzen aufmerksam machte, wollte er sich anderen Themen widmen. Doch dann sank am 3. Oktober 2013 ein Schiff mit 545 afrikanischen Flüchtlingen vor der italienischen Insel Lampedusa. Für Bierdel ein Signal, dass sein Einsatz als Aufzeiger noch einmal gebraucht wird. Mit einer jungen Filmcrew arbeitet er derzeit an einer Dokumentation, die gewollt subjektiv zeigt, was sich an Europas Grenzen abspielt.
Die Furche: Europa feiert heuer, dass vor 25 Jahren der Eiserne Vorhang fiel. Hat Europa Grenzen überwunden oder sie nur verschoben?
Elias Bierdel: Über den Zeitraum, in dem die inneren Grenzen gefallen sind, errichtet dasselbe Europa an seinen Außengrenzen Sperranlagen, die den damaligen in ihrer Logik, in Aufbau und Technik gleichen. Es gibt Mauern, Stacheldraht, Schießbefehl und Minen. In meiner Kindheit sprachen wir von einer "Schandmauer", und Menschen, die andere bei der Flucht in den Westen unterstützten, waren als "Fluchthelfer" positiv konnotiert. Heute wird, wer anderen hilft, ihr Recht auf Schutz und Asyl geltend zu machen, kriminalisiert. Wir haben uns angewöhnt, das Sterben und die Menschenrechtsverletzungen als Normalfall zu akzeptieren.
Die Furche: Wieso hat sich mit der Grenze auch deren Wahrnehmung verschoben?
Bierdel: Das liegt sicher auch daran, dass es heute, anders als damals, nur unzulängliche Informationen gibt. Während in Westdeutschland jeder Tote an der Grenze dokumentiert wurde, hat die Politik heute wenig Interesse daran, dass genauer hingeschaut wird. Unter 10.000 EU-Beamten, die mit der Abschottung befasst sind, gibt es keinen einzigen, der sich mit den Opfern beschäftigt. Das Opferzählen bleibt den NGOs.
Die Furche: Für Ihren Film reisen Sie nach Italien, Spanien oder Griechenland, und auch in die ehemalige Grenzregion Burgenland. Nehmen Menschen, die an der Grenze leben, sie anders wahr als Menschen in der Mitte Europas?
Bierdel: Abolut. Oft sind oder waren das selbst Auswandererregionen. Dort gibt es ein Wissen darüber, was es heißt, wenn man weg muss, auch weil man für sich eine bessere Zukunft sucht. An den Seegrenzen, wo ja besonders viele Menschen sterben, hat fast jede Familie Erinnerungen daran, wie einer von ihnen es nicht mehr rechtzeitig zurück an die Küste geschafft hat. Das schafft Verbundenheit. Fischer erzählen uns, wie ihnen die Behörden verbieten, Menschen zu retten. Die Bewohner der Grenzregionen müssen die Last des europäischen Versagens auf ihren Schultern tragen.
Die Furche: Seit der nuklearen Katastrophe von Fukushima hat in Europa beim Thema Atomkraft ein Umdenkprozess begonnen. Die humanitären Katastrophen im Mittelmeer hingegen wiederholen sich, ohne eine politische Wende nach sich zu ziehen ...
Bierdel: Als Sohn eines Historikers muss ich daran erinnern, dass es 25 Jahre vor Fukushima das Unglück von Tschernobyl gab. Es wird also noch dauern, gesellschaftliche Prozesse sind langsam. Wir befinden uns in einer Phase des Übergangs: Die meisten alten Konzepte, die wir kennen, erweisen sich als nicht tauglich für die Zukunft. Gleichzeitig sehen wir noch nicht, wo es hingehen soll. Das verunsichert. Ich zitiere gerne Paul Tillich: "Die Grenze ist der eigentlich fruchtbare Ort der Erkenntnis." Am Umgang mit den Menschen vor der Grenze Europas zeigen sich die unauflöslichen Widersprüche, in die wir uns im Namen von Freiheit und Menschenrechten hineinmanövriert haben. Es wäre schön, wenn wir mit unserem Film dazu beitragen können, dass mehr Menschen verstehen, dass es so nicht weiter gehen kann. Denn je später wir uns bestimmten Wahrheiten stellen, desto höher ist das Risiko, dass der Wandel mit starken Brüchen und Gewalt verbunden ist.