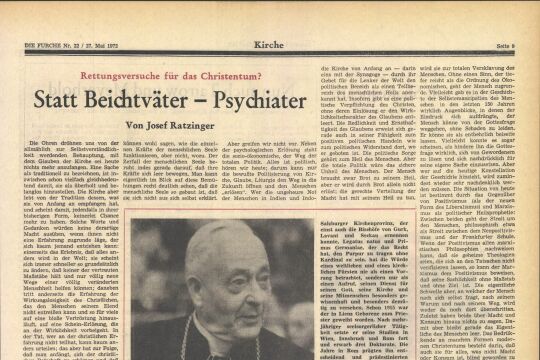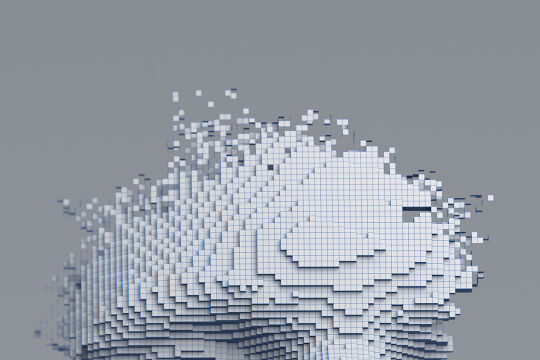Marianne Gronemeyer: "Hermetische Grenzen sind Selbstberaubung"
In ihrem neuen Buch umkreist Marianne Gronemeyer "Die Grenze". Ein Gespräch über Andersheit, Grenzwerte und die Sorge um Hummeln.
In ihrem neuen Buch umkreist Marianne Gronemeyer "Die Grenze". Ein Gespräch über Andersheit, Grenzwerte und die Sorge um Hummeln.
Sie schien obsolet zu werden, doch nun ist die Grenze mit aller Macht zurückgekehrt. Was bedeutet sie? Wo ist sie sinnvoll -und wo nicht? Die deutsche Erziehungs-und Sozialwissenschafterin Marianne Gronemeyer beschäftigt sich in ihrem neuen Buch mit diesen Fragen. DIE FURCHE hat sie zum Interview gebeten.
DIE FURCHE: Der Philosoph Konrad Paul Liessmann bezeichnet die Grenze im Buch "Lob der Grenze"(2012) als "eine wirkliche oder gedachte Linie, durch die sich zwei Dinge voneinander unterscheiden: Wer immer einen Unterschied wahrnimmt, nimmt auch eine Grenze wahr". Sie sehen das kritisch.
Marianne Gronemeyer: Ich glaube, dass uns Liessmanns weite Definition nicht sehr viel weiterhilft. Und ich wage auch nur mit äußerster Vorsicht eine Definition der Grenze, weil sie einen so schillernden Charakter hat. Aber wenn ich eine Besonderheit von ihr beschreiben müsste, dann würde ich sagen: Sie ist die Hüterin der Verschiedenheit. Die
DIE FURCHE: In Ihrem Buch bezeichnen Sie "die Grenze" jedenfalls als "Paradox der Moderne". Was meinen Sie damit?
Gronemeyer: Zunächst bezeichnet die Grenze Dinge, die scheinbar nicht zusammenpassen. Das wirkliche Paradox zeigt sich aber darin, dass man nicht weiß, ob sie trennt und etwas auseinanderhält, oder ob sie das, was diesseits und jenseits von ihr angesiedelt ist, verbindet. Ich denke, sie tut beides -und muss beides tun: Sie muss durchlässig sein und darf zugleich nicht so durchlässig sein, dass keine Trennung mehr möglich ist. Die Frage ist also, wie wir mit Grenzen umgehen, und hier sehen wir gerade zwei Tendenzen: Zum einen werden fieberhaft neue Mauern errichtet, weil das, was jenseits der Grenze vermutet wird, als so bedrohlich empfunden wird, dass man sich davor schützen will. Donald Trump will eine Mauer gegenüber Mexiko aufrichten, und auf der Balkanroute werden in großem Stil Stacheldrahtverhaue aufgerichtet. Die andere Tendenz ist, dass Grenzen verschwinden: Barrierefreiheit ist eine zentrale Ideologie der Moderne, alle Hemmnisse sollen mit ungeheurer Mobilität in größter Geschwindigkeit überwunden werden können. Beide Tendenzen haben ihre Gefahren und sind Quellen des Unfriedens.
DIE FURCHE: Beginnen wir mit der Tendenz, Grenzen aufzurichten bzw. zu "schützen". Der Grazer Soziologe Manfred Prisching hat einmal in der FURCHE geschrieben, die "Utopie der Grenzenlosigkeit mündet in einen durchgängigen Reflex, diffusere politisch-kulturelle Grenzen noch stärker zu ziehen". Braucht der Mensch also Grenzen?
Gronemeyer: Wenn es sich tatsächlich um eine Auseinandersetzung mit dem Fremden handelt, dann bin auch ich zutiefst darüber besorgt, dass Grenzen verschwinden. In den 1960er-Jahren war es etwa noch ein Abenteuer, von Deutschland nach Italien zu fahren und nach den Grenzübertritten in eine fremde, überwältigend andere Welt einzutauchen. Inzwischen ist alles gleich, überall ist Lidl und Aldi, überall der gleiche Fraß, die gleiche Mode, die gleichen Autos. Der Konsumismus hat sich als totalitär erwiesen und damit eigene Kulturen vernichtet. Das andere ist aber die Frage, was eigentlich ein angemessener Umgang mit dem Fremden jenseits der Grenzen wäre. Leider haben wir bislang aber nur zwei Möglichkeiten ins Auge gefasst: offene Grenzen, die gar nicht mehr wahrgenommen werden und damit auch alle Unterschiede tilgen -oder Verbarrikadierung. Alles Fremde draußen zu halten, bedeutet aber auch, dass wir uns selber einsperren. Insofern ist eine hermetische Grenze, die nicht mehr durchlässig ist und keine Überschreitung möglich macht, eine Selbstberaubung.
DIE FURCHE: Ihr Lehrer, Ivan Illich, hat die modernen Lebensverhältnisse als ein "drübenloses Hüben" charakterisiert, das "Jenseits der Grenze" sei verloren gegangen, das Draußen werde zum Feindesland. Kann man diesen Befund aus Ihrer Sicht auch auf die Migrationsdebatte übertragen?
Gronemeyer: Das ist tatsächlich der Kern der Debatte. Der Punkt ist, dass die Hiesigen, etwa die reichen Bewohner Westeuropas , das Diesseits der Grenze als etwas Eigentliches beschreiben -und jenseits nur die Negation dieses Eigentlichen vermuten, also eine Art von Unwesen, Gefahr, Bedrohung und nicht auch das Eigene des Anderen sehen. Es bräuchte die Bereitschaft, sich auf die Fremden einzulassen und sich von ihnen auch angehen zu lassen, wie es Emmanuel Lévinas formuliert hat -dazu waren im Jahr 2015, als die Grenzen geöffnet wurden, auch tausende Menschen bereit. Es bräuchte die Neugier darauf, was uns am Anderen mangelt, was komplementär ist zu dem, was wir darstellen. Die Geflüchteten bringen ja auch Könnerschaften und Bewährungen mit, von denen wir meilenweit entfernt sind.
Die Furche: Dass viele Hiesige das nicht tun, sondern lieber Grenzen ziehen, wird meist auf die Angst vor dem Fremden zurückgeführt. Sie stellen das in Frage.
Gronemeyer: Ich glaube tatsächlich, dass nicht die Andersheit der Menschen, die zu uns kommen, am bedrohlichsten empfunden wird, sondern gerade ihre Gleichheit. Sie sind von den gleichen Bestrebungen getrieben wie wir, nämlich von der Teilhabe am weltweiten Konsumismus und an dem gesellschaftlichen Reichtum, der in den reichen Ländern akkumuliert worden ist. Diese Teilhabewünsche machen sie zu Rivalen, zu Konkurrenten. Nicht die Fremdheit ängstigt also, sondern die Armut.
DIE FURCHE: Viele würden mit Verweis auf den Ökonomen Milton Friedman entgegnen, dass ein Sozialstaat nur mit Grenzen zu haben sei.
Gronemeyer: Friedmans Theorie passt in die allgemeine Fortschrittsgeschichte, in der wir alles auf die Kraft der Sicherheit setzen. Ich würde demgegenüber mit Erich Fromm betonen, dass jede Sicherheit, die wir gewinnen, unweigerlich mit einem Verlust an Freiheit bezahlt wird. Die Balance zwischen Hüben und Drüben, diesseits und jenseits der Grenze, Sicherheit und Freiheit muss ständig neu ausgehandelt werden.
DIE FURCHE: Apropos Balance: Tatsache ist, dass die Ungleichheit auf diesem Planeten wächst -und durch die Klimaveränderungen weiter zugespitzt wird. Womit wir bei den "Grenzen des Wachstums" wären, die Sie seit Langem einmahnen.
Gronemeyer: Hier zeigt sich das zentrale Paradox des Grenzwesens überhaupt: Seit den ersten Berichten des Club of Rome in den 1970er-Jahren wissen wir, dass es in einem begrenzten Lebensraum kein unbegrenztes Wachstum gibt und dass wir uns auf einem Katastrophenkurs befinden, doch seitdem hat sich die Situation noch weiter katastrophal verschlechtert. Jeden Abend in den Nachrichten wird es als frohe Botschaft verkündet, wenn irgendwo ein Prozent mehr Wirtschaftswachstum zu verzeichnen ist, und in denselben Nachrichten warnt man, dass Wachstum unsere Lebensgrundlagen zerstört. Wachsen zu müssen, ohne es zu dürfen: Das ist das Urparadox der kapitalistischen Gesellschaften.
DIE FURCHE: Ob Klimawandel oder andere Herausforderungen: Meist agiert die Politik mit Hilfe von Grenzwerten. Sie bezeichnen sie als "Perversion von Grenze". Warum?
Gronemeyer: Weil sie nicht zu einer Umkehr oder völligen Neuorientierung führen, sondern bestimmen, was gerade noch eben tragbar ist, und damit die Krise weiter in der Schwebe halten. Außerdem haben sie mit Realitäten gar nichts zu tun. In den USA wurde von einem Tag auf den anderen der Grenzwert für Bluthochdruck von 140/80 auf 130/70 gesenkt: 30 Millionen Amerikaner wurden über Nacht zu behandlungsbedürftigen Mängelwesen. Wie es zu diesen Grenzwerten kam, ist für Laien vollkommen undurchschaubar. Grenzwerte sind also willkürliche und variable Konstrukte, die nichts damit zu tun haben, was zuträglich ist. Das einzige, was in diesem Wahnsinn des Wachstums überhaupt eine Kraft sein könnte, ist die Sorge um die Natur, die Sorge um die anderen Menschen und die Trauer um Verlust. Es macht einen Unterschied, ob ich sage, die Hummeln sind um 80 Prozent weniger geworden, oder ob ich auf meiner Fensterbank eine verenden sehe und mit Honig füttere -woraufhin sie wieder davonfliegt. Erst dann habe ich ein Verhältnis zum Insektensterben. Und erst dann bin ich vielleicht bereit, auch auf Dinge zu verzichten und nicht meinen Vorteil an der äußersten Grenze des eben noch Tragbaren zu verteidigen.
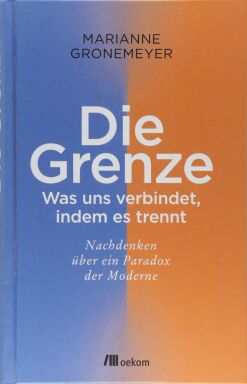
Die Grenze
Was uns verbindet, indem es trennt.
Von Marianne Gronemeyer.
Oekom 2018.
240 S., geb.
€ 22,70