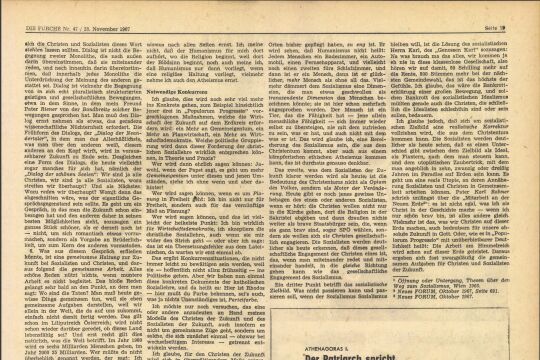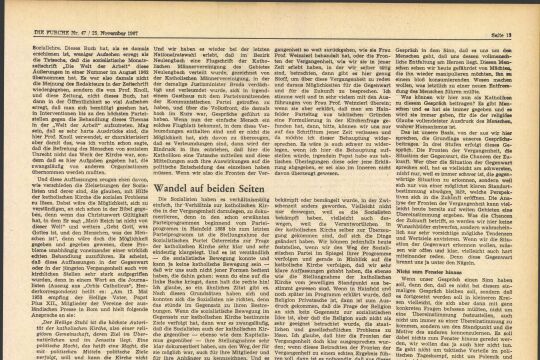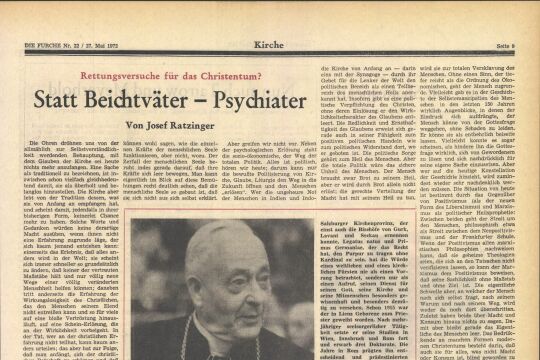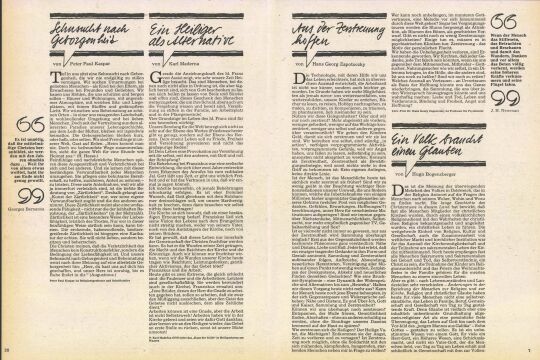Das Neue ist ambivalent
Der katholische Sozialethiker Dietmar Mieth über den Unterschied zwischen biblischer und moderner Optimierung und die Grenzen der Selbstbestimmung. Das Gespräch führte Rudolf Mitlöhner
Der katholische Sozialethiker Dietmar Mieth über den Unterschied zwischen biblischer und moderner Optimierung und die Grenzen der Selbstbestimmung. Das Gespräch führte Rudolf Mitlöhner
Christen sollten sich offensiv in die ethischen Diskurse einbringen, fordert Dietmar Mieth. Und er warnt vor dem "Verbundsystem von Wissenschaft, Technik und Ökonomie".
Die Furche: Im biblischen Kontext ist der Begriff "neuer Mensch" sehr positiv besetzt. In der paulinischen Theologie bedeutet Christsein, ein neuer Mensch zu sein oder zu werden. Heute sind damit aber Befürchtungen verbunden, im Sinne eines Zwangs zur Selbstoptimierung oder -perfektionierung oder gar post-bzw., transhumaner Entwicklungen. Was sagt der Theologe dazu?
Dietmar Mieth: Der Begriff des neuen Menschen im Zweiten Korintherbrief meint, dass der Mensch sich ändern kann. Diese Änderung ist eine bestimmte Art und Weise, wie der Mensch mit sich selbst in seinem begrenzten Leben umgeht. Nicht die ganze Menschheit wird neu gestaltet, sondern es geht um den einzelnen Menschen und um seine persönlich verantwortete Änderungsfähigkeit. Die Tradition, dass der Mensch an sich arbeitet und das auch weitergibt, hat also einen stark religiösen Hintergrund. Jesus selbst sagt ja: "Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist."(vgl. Mt 5). Das heißt aber nicht Optimierung oder Perfektionierung bestimmter Eigenschaften, sondern es geht darum den Sinn des Lebens überhaupt zu erkennen und sich danach zu orientieren. Da geht es um das "Woher" des Menschen und nicht das "Wohin". Die nachchristliche Moderne ist stark teleologisch (griech. telos = Ziel) geprägt. Man fragt nach dem "Wohin": Was wollen wir erreichen? Wir wollen immer vorwärts. Diese Vorstellung des Fortschritts existiert in der christlichen Tradition so nicht. Da war kein Vorwärts sondern ein Besinnen auf Rückwärts. Der Sinn des Lebens ist in dieser Tradition, Gott näher zu kommen und seine eigene Begrenztheit zu begreifen.
Die Furche: In der christlichen Tradition gibt es doch auch diese teleologische Ausrichtung. Paulus spricht vom Wettlauf und vom Siegeskranz (1 Kor 9). Auch in der mittelalterlichen Theologie gibt es diese Komponente
Mieth: Das wird aber oft missverstanden. Es geht dabei nicht um einen Lauf von A nach B, bei dem B das Ziel wäre. Das Entscheidende sowohl in der aristotelischen Tugendlehre als auch in der paulinischen Anweisung zur Lebensführung ist vielmehr: Wie verändere ich mich durch diesen Lauf? Nocheinmal etwas anderes ist die Verwandlung, von der es heißt, "kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört"(1 Kor 2). Das heißt, wir wissen gar nicht, wie wir verwandelt werden, da bleiben wir passiv. Dieses Gelände kennen wir nicht, da überlässt man sich jemandem anderem. Dieses Sich-Überlassen ist das Wesen der christlichen Gelassenheit.
Die Furche: Wenn aber dieser Andere, auf den ich mich verlassen kann, in einer säkularen Gesellschaft gewissermaßen wegfällt, dann ist es doch logisch, dass ich diese Verwandlung selbst in die Hand nehmen muss -im Sinne einer Selbstoptimierung
Mieth: Bei jedem Fortschritt der Wissenschaft haben wir zugleich
einen Fortschritt in Nichtwissen. Wissenschaftler sollen also nicht nur punktuell denken, sondern alles im Zusammenhang betrachten. Meistens aber werden in der öffentlichen Debatte einzelne Punkte isoliert und damit aus dem Zusammenhang gerissen. Vor diesem Hintergrund dürfte man nicht sagen: Der Zweck heiligt die Mittel - sondern: Die Mittel müssen dem Zweck entsprechen. Und es verbietet sich auch zu sagen: Die Folgen bewältigen wir später. Dem würde ich entgegenhalten: Man soll Probleme nicht so lösen, dass die Probleme, die aus der Problemlösung entstehen, größer sind, als die Probleme, die gelöst werden. Beispiel: Atomenergie. In den 1970er Jahren wussten wir bereits um die Probleme, die sich daraus ergeben können - Stichworte Endlagerung, "Größter anzunehmender Unfall"(GAU). Man hat gesagt, diese Probleme lösen wir später. Das aber sollten wir nicht tun. Bei tiefgreifenden Veränderungen wäre immer zuerst darauf zu schauen, welche Probleme daraus entstehen, und ob wir die Folgeprobleme lösen können. Das ist eine realistische Sicht, das hat mit konservativ oder liberal gar nichts zu tun. Man muss die Komplexität sehen. Diese Komplexität können wir aber nur sehen, wenn sich die Wissenschaft an das Transparenzgebot hält. Das heißt, sie muss alles, was sie tut, im Hinblick auf die Implikationen für die Gesellschaft transparent machen.
Die Furche: Aber basiert der gesamte Fortschritt nicht darauf, dass man immer wieder Risiken eingegangen ist, die man im Vorfeld nicht abschätzen konnte?
Mieth: Sicher, das ist partiell so. Aber es gibt eben auch Fälle, in denen man absehbare Probleme nicht ernst genommen hat, weil man eben nicht langfristig denkt. Weil man zum Beispiel in der Politik sagt: Wir regieren ja nur vier, fünf Jahre. Ein bisschen ist das das Problem der westlichen, amerikanisch geprägten Mentalität. Man geht mit Selbstbewusstsein voran, und denkt, alles, was hinterher kommt, lösen wir dann schon. Ich meine aber, man kann beispielsweise nicht im Irak einmarschieren und sagen, die Probleme lösen wir später. Ein ganz wesentlicher Gedanke ist auch, dass, wenn ich etwas Neues mache, dieses Neue auch zweideutig sein kann. Und ich muss diese Zweideutigkeiten auch ernst nehmen.
Die Furche: In der Politik geht es dann aber doch immer um klare Entscheidungen: Was soll wie geregelt werden?
Mieth: Nun, wir haben eine pluralistische Gesellschaft, und jetzt geht es um den Diskurs, was wir gesetzlich verankern wollen. Was soll verboten, was gefördert werden? Wir sitzen da alle mit unterschiedlichen Positionen an einem Tisch und da versuche ich natürlich für meine Überzeugungen mit Argumenten einzutreten. Aber es gehört ebenso dazu, dass es zu Lösungen kommt, die der eigenen Position widersprechen. Dass Dinge ermöglicht werden, die man nicht für richtig hält - wobei einem dann immer noch die Freiheit des eigenen Handelns und der Verweigerung bleibt: ich muss nicht alles tun, was erlaubt ist.
Die Furche: Wie lassen sich in einer säkularen Gesellschaft bioethische Positionen, die letztlich theologisch begründet sind, vermitteln?
Mieth: Zunächst würde ich sagen, dass die Säkularisierungsthese sehr differenziert betrachtet werden muss. Auch der ungebrochene Fortschrittsglaube der Optimierer ist eine Religion. Man sieht, dass Religion nicht einfach verschwindet, sondern sich höchstens säkular umformt. Ich setze also Religion gegen Religion. Der zweite Punkt wäre etwas, das ich kritische Theorie nennen würde. Die liberale Sicht sagt, die Menschen können und sollen selbst bestimmen. Da gibt es einmal den Einwand, dass es nicht nur um Selbstbestimmung geht, sondern auch um Fremdbestimmung - nämlich der folgenden Generationen, z.B. in der Fortpflanzungsmedizin. Und dann ist es so, dass in der derzeitigen wirtschaftspolitischen Landschaft oft Probleme in die Selbstbestimmung verschoben werden, die eigentlich solidarisch gelöst werden sollten. Beispielsweise wird gesagt, jeder Mensch kann bestimmen, wann und wie er stirbt. Aber das ist die Kehrseite dessen, dass wir ein Defizit in der Betreuungs- und Pflegesituation haben. Wir bringen die Menschen objektiv in Situationen, in denen wir ihnen die Selbstbestimmung der Vorverlegung ihres Endes zumuten. Es geht also um die Verschiebung eines sozialen Problems in die persönliche Unerträglichkeit. Deswegen spreche ich auch von den "Grenzen der Selbstbestimmung".
Die Furche: Wer aber setzt diese Grenzen?
Mieth: Der Aufruf zur Selbstbestimmung ist ein ideologischer: Dahinter steht das Verbundsystem von Wissenschaft, Technik und Ökonomie, welches die Politik beherrscht. Die oben erwähnte kritische Theorie lautet: Wir haben den Primat der Politik aufgegeben, die Politik fährt quasi immer hinterher und sponsert das Verbundsystem, welches den Vorsprung hat. Es gibt keine freie Entwicklung des Wissens, sondern es gibt Entwicklung dort, wo man etwas herstellen kann, was sich auch verkaufen lässt. Im Prinzip ist es so, dass wir durch dieses Verbundsystem die Ordnung zugewiesen bekommen, in der wir uns selbst bestimmen können.
Die Furche: War es nicht immer so, dass sich Erkenntnisdrang und die Suche nach auch ökonomischem Gewinn verbunden haben? Ist die Vorstellung vom reinen Streben nach Wissen nicht eine romantische?
Mieth: Das wäre eine romantische Vorstellung - aber das meine ich nicht. Was sich sagen will, ist, dass wir uns früher politisch mehr zugetraut haben. Ich will aber auch nicht der Politik generell einen Persilschein ausstellen, die hat natürlich auch viel zu verantworten, wenn man in die Geschichte blickt.
DIE FURCHE: Wenn man die bioethischen Debatten der letzten Jahre betrachtet, hat man doch stark den Eindruck, dass die Positionen der katholischen Kirche stark in der Defensive sind und dass es sich bei deren Verteidigung nur noch um Rückzugsgefechte handelt - während jene der evangelischen Kirchen kompatibler mit dem diesbezüglichen Zeitgeist zu sein scheinen.
Mieth: Aber die Anpassungsfähigkeit ist nicht unbedingt ein Vorteil: Aus der katholischen Kirche in Deutschland sind 2014 200.000 Menschen ausgetreten, aus der evangelischen 430.000. Direkt zu Ihrer Frage kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen, dass die einschlägigen katholischen Diskurse von einem Teil der Bundestagsabgeordneten, und zwar quer durch alle Parteien, sehr wohl mit Interessen rezipiert werden. Das sind zwar keine zehn Prozent, aber immerhin.