"Das Dilemma, in dem wir ALLE STECKEN"
Regisseur Wolfgang Fischer über sein Flüchtlingsdrama "Styx" und die Herausforderungen an Europa in Hinblick auf die Migration.
Regisseur Wolfgang Fischer über sein Flüchtlingsdrama "Styx" und die Herausforderungen an Europa in Hinblick auf die Migration.
Wolfgang Fischer drehte sein Flüchtlingsdrama "Styx" 2016 auf dem offenen Meer bei Malta, als ringsherum bereits echte Flüchtlinge an Land gerettet wurden. Eine bizarre Situation für den österreichischen Regisseur, der die Geschichte bereits 2009 zu Papier brachte, als von der großen Flüchtlingskrise noch keine Rede war. "Styx" rückt eine Notfallmedizinerin (Susanne Wolff) ins Zentrum, die bei einem Segeltörn auf ein Flüchtlingsboot trifft und vor dem moralischen Dilemma steht, ob sie retten soll oder nicht.
DIE FURCHE: Ihr Film ist ein Kammerspiel auf hoher See, mit nur einer Dreh-Location. Was ist da nötig, um Dramaturgie und Spannungsbogen im Auge zu behalten?
Wolfgang Fischer: In unserem Fall war dies eine besonders große Herausforderung, weil wir uns vorgenommen hatten, den Film ausschließlich auf dem offenen Meer zu drehen. Dafür gibt es kaum Erfahrungswerte anderer Regisseure. Denn die meisten Filme, die im offenen Meer spielen, entstehen in großen Becken und Tanks, benutzen viele Computertricks und dergleichen. Bei uns ist es eine reale Meereswelt. Das war eine große Herausforderung, auf einem elf Meter langen Boot 42 Tage lang zu drehen, mit einer maximalen Crew von zehn Personen. Da gibt es weder Privatsphäre noch Rückzugsmöglichkeit, man sitzt da Schulter an Schulter zusammen. Wenn man meine Hauptdarstellerin Susanne Wolff sieht, wie sie da an Bord agiert, fragt man sich: Wo steckt denn die ganze Crew? Die war teils auf der anderen Seite der Reling festgezurrt oder unter Deck. Das ist vor allem bei stürmischer See sehr unangenehm, und so gab es fast täglich jemanden, der seekrank wurde -außer mir ...
DIE FURCHE: Die Geschichte zu "Styx" haben Sie lange vor der Flüchtlingskrise von 2015 geschrieben. Wie ist das Gefühl, wenn man von der Geschichte sozusagen überholt wird? Fischer: Ich begann vor neun Jahren, das Drehbuch zu schreiben, und es gab auch damals schon Flüchtlingsboote, aber natürlich
nicht in diesem Ausmaß. Mein Ziel war es jedoch, einen Film über uns zu machen und uns die Frage zu stellen: Wer sind wir, wer wollen wir sein in dieser Welt, in der wir leben? Das ist das Grundthema des Films, und es wird uns auch die nächsten Jahrzehnte beschäftigen. Als wir 2016 den Film in den Gewässern um Malta gedreht haben, da lagen in der Nachbarbucht bereits die NGOs und Rettungskräfte vor Anker. Wir sind jeden Tag rausgefahren, um unseren Film zu drehen, und die sind rausgefahren, um Flüchtlinge aus dem Meer zu retten. Das war eine heftige Situation.
DIE FURCHE: Das moralische Dilemma ihrer Hauptfigur, einer deutschen Notärztin, wiegt doppelt schwer, weil sie als Ärztin verpflichtet wäre, Menschen zu retten. Aber die Umstände erlauben es ihr nur bedingt.
Fischer: Man sieht zu Beginn des Films, wie perfekt die Rettungskette in Europa eigentlich funktioniert, sobald ein Unfall passiert und alles ineinandergreift. An den Außengrenzen der EU versagt dieses System aber häufig. Genau diesen Kontrast wollten wir aufzeigen. Es ist nicht umsonst eine Notfallmedizinerin, die wir in diese Situation bringen, denn sie kennt solche Situationen und kann kontrolliert reagieren. Sie kennt alle Abläufe, aber selbst für einen Profi wie sie ist es unmöglich, diese Situation zu meistern. Das soll symbolisch auch andeuten, dass wir das Migrationsproblem nur gemeinsam lösen können, da ist die internationale Staatengemeinschaft gefordert, Konzepte vorzulegen, die das Sterben beenden.
DIE FURCHE: Sind die Menschen, die vor den Toren Europas aufgegriffen werden, so etwas wie Menschen zweiter Klasse? Kann man das so radikal benennen?
Fischer: Ja, ich denke schon. Es gibt das Beispiel, wo eine britische Kreuzfahrttouristin von einem Schiff gefallen war, und gleich eine unglaubliche Armada von Rettungskräften losgeschickt wurde, um sie zu retten. Auf der anderen Seite flüchten Menschen aus Afrika auf den schlechtesten Booten und werden nie auf diese Art der Rettung hoffen können. Diesen krassen Kontrast galt es aufzuzeigen. DIE FURCHE: Susanne Wolff spielt die meiste Zeit über mit sich selbst, hat also keinen Anspielpartner auf hoher See, weil sie ja allein ist. Wie erarbeitet man das? Fischer: Das ist gefinkelt: Man hat als Regisseur nur das Gesicht dieser Schauspielerin, und ihre unglaubliche Leinwandpräsenz, und daher ist es schwierig zu zeigen, was in ihr vorgeht. Man hat keinen klassischen Antagonisten. Wir bleiben immer in ihrer Perspektive und wollten der Figur beim Denken zusehen. Aber wie macht man so was visuell? Eine schwierige Aufgabe. Und zugleich soll uns als Zuschauer das natürlich in ihre Rolle drängen und uns die Frage stellen lassen: Was würde ich denn in dieser Situation tun? Was mich interessiert und schockiert hat, das ist das Dilemma, in dem wir alle stecken. "Styx" soll ein allegorisches Drama über unseren Umgang mit Flüchtlingen sein. Im Kleinen erzählt, aber mit der Hoffnung, dass das etwas Größeres über uns ausdrückt. DIE FURCHE: Wie weit von der Küste entfernt haben Sie gedreht? Fischer: Wir waren zwischen zehn und 15 Seemeilen von der Küste weg, ganz einfach, um die Möglichkeit zu haben, einen 360-Grad-Dreh machen zu können, bei dem man rundherum kein Land sieht. Normalerweise bereitet man bei einem Film ja alles schön vor und man hat einen durchstrukturierten Drehplan. Das ist auf dem Meer nicht möglich. Da muss man permanent reagieren. Die Aufnahmen dauerten sehr lange. Wir waren von September bis Mitte Dezember auf Malta und dann noch mal im März zehn Tage in der Gegend von Gibraltar.
DIE FURCHE: Weil Sie sagten, es gäbe keinen Antagonisten in Ihrem Film: Ich würde schon sagen, dass es den gibt: das Meer. Fischer: Das stimmt, und das Meer ist wie eine eigene Figur im Film. Es muss bezwungen werden, sowohl von unserer Protagonistin
als auch von den Flüchtlingen, die leider ganz schlechte Voraussetzungen dafür haben. DIE FURCHE: Wohin geht diese Entwicklung? Fischer: Die meiste Migration in Afrika, nämlich 85 Prozent, findet innerhalb des Kontinents statt. Dazu gibt es viele Probleme und Krisenherde, es gibt Regierungen, die ihre Menschen quälen, und wir schauen alle weg. Wir wollen das nicht mehr sehen, auch die Menschen im Meer nicht. Die Zahlen gehen derzeit zurück, aber mittlerweile sterben die Menschen dort, wo die Kameras nicht mehr hinschauen, daheim in der Wüste. Man sollte schon weiter denken und sehen, dass die Lösung nicht sein kann, die Meeresrouten einfach dichtzumachen. Das verlagert die Probleme nur. Aber dafür gibt es seitens der Politik überhaupt keinerlei Konzepte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!










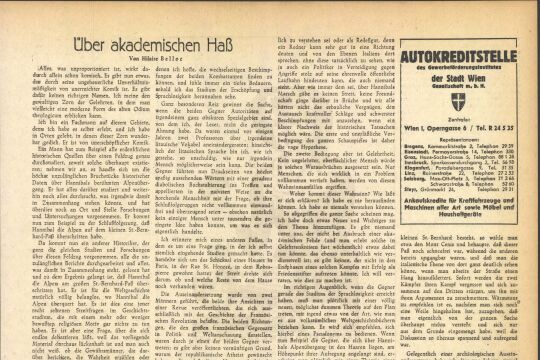




































.png)
.jpg)



















































