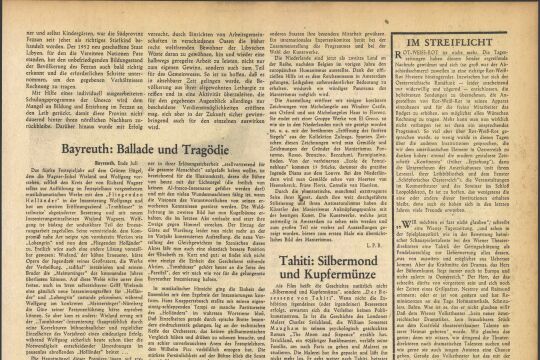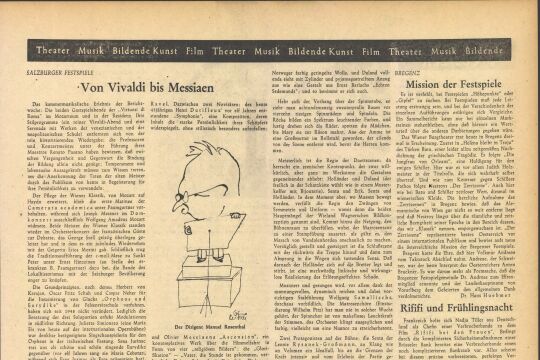"Parsifal"-Premiere an der Wiener Staatsoper: Starke Bilder, aber auch der Hang zur Überfrachtung kennzeichnen die Regie von Christine Mielitz.
Erlösung findet nicht statt: wie schon beim "Fliegenden Holländer" (im Dezember) verzichtet Regisseurin Christine Mielitz auch bei der Neuproduktion von Richard Wagners "Parsifal" an der Wiener Staatsoper (trotz gen Luster bzw. Himmel schwenkender Scheinwerfer) auf apotheotische Verklärung - und nicht nur darauf: sie lässt auch weitgehend die christlichen Symbole des Bühnenweihfestspiels beiseite.
Die Gralsritter ihrer Deutung sind eine heruntergekommene Männergesellschaft, die in ihren Riten erstarrt ist. Parsifal findet - nach seinen hier einmal nicht keuschen Irrwegen - zu dieser keineswegs von moralischer Autorität geprägten Runde zwar zurück, das Heil bringt er aber nicht: Der Gral zerbricht, Parsifal geht in der Masse unter. Man versteht die Aussage: Zum einen liegt Glück nur in der Gemeinschaft begründet, zum andern muss sich die Gesellschaft öffnen, um nicht unterzugehen.
Sieht man von solchen Umdeutungen ab, bleibt die Regisseurin sonst nahe bei Wagner; ihre Inszenierung ist weder kühn noch außergewöhnlich - findet aber immer wieder zu starken Bildern: das stärkste darunter, wenn Thomas Quasthoff als Amfortas bei seinem Rollen- und Hausdebüt mit einer riesigen Krone während der Verwandlungsmusik des dritten Aufzugs einsam über die Bühne wandelt - der Hoffnung beraubt, den Tod herbeisehnend. Die kluge Selbstverständlichkeit, mit der er agiert, Text und Musik plastisch zum Ausdruck bringt, lässt seine Behinderung hinter einer Rollenstudie von enormer Kraft zur Nebensache werden.
Wie beim "Fliegenden Holländer" scheut die Regisseurin zwar auch in ihrer "Parsifal"-Gestaltung banale Mittel nicht und gibt wieder gemeinsam mit Ausstatter Stefan Mayer ihrem Hang nach, Abläufe mit Bühnenaktionen zu überfrachten, ihr Sinn für kleine Details, Gesten und zwischenmenschliche Reaktionen ist aber stets spürbar.
Insbesondere Johan Botha als Parsifal dürfte von der Zusammenarbeit profitiert haben, denn selten hat man den sonst nicht gerade durch seine Darstellungskunst auffallenden Tenor so differenziert agieren gesehen. Gesanglich ist er sein strahlendes Selbst: imposant in den Ausbrüchen, makellos in den Kantilenen, in jedem Moment souverän und unerschütterlich. Diese Selbstverständlichkeit ist Angela Denoke als Kundry nicht zu eigen: Sie besitzt zwar die Präsenz, versteht es, die Vielschichtigkeit der Rolle umzusetzen und scheint in ihrem darstellerischen Engagement fast keine Grenzen zu kennen, gerade im Furioso zum Finale des zweiten Aufzugs kommt ihre sonst sehr sicher geführte Stimme aber an merkliche Grenzen. Robert Holls Gurnemanz besticht durch die Wortdeutlichkeit und den sonoren Klang seines Materials, Wolfgang Bankl singt den Klingsor mit Impulsivität, klangschön muten die Blumenmädchen an, nicht ganz so einheitlich die diversen Knappen und Ritter.
Konzentriert und sicher wird das Orchester von Donald Runnicles geleitet, mit Sinn für Klangfarben und dramatische Steigerungen, immer wieder aber auch mit großem Hang, sich für die lyrischen Passagen (zu) viel Zeit zu nehmen. Einige Buhs mischten sich so auch in den Jubel für den Dirigenten, Ablehnung und Zustimmung hielten sich bei der Regisseurin die Waage, das Sängerensemble wurde gefeiert.