Musiktheater bunt wie ein Mosaik
Diskursiv und vielfältig. Eine entfesselte Bartoli bei den Pfingstfestspielen in Salzburg, eine neue Vivaldi-Oper von Christian Kolonovits in der Wiener Volksoper und Jonathan Meeses ebenfalls neue Parsifal-Reflexionen bei den Wiener Festwochen.
Diskursiv und vielfältig. Eine entfesselte Bartoli bei den Pfingstfestspielen in Salzburg, eine neue Vivaldi-Oper von Christian Kolonovits in der Wiener Volksoper und Jonathan Meeses ebenfalls neue Parsifal-Reflexionen bei den Wiener Festwochen.
Nach dem wenig glücklichen Bernstein-Sidestep im Vorjahr, als Maria in dessen "West Side Story", hat Salzburgs Pfingsfestspiele-Intendantin Cecilia Bartoli mit Georg Friedrich Händels dreiaktigem Dramma per musica "Ariodante" wieder zu ihrem eigentlichen Metier gefunden. Was immer Regisseur Christof Loy in dem zwischen nüchternen, sich nach hinten verjüngenden weißen Paneel-Wänden und der Nachbildung eines Gemäldes aus der Mitte des 17. Jahrhunderts wechselnden Bühnenbild von Johannes Leiacker von ihr verlangte, alles löste sie mit Brillanz.
Egal, ob er sie -ganz im Gegenteil zum Original, das für diese Rolle nach einem Kastraten verlangt -in eine Hosenrolle steckte und ihr dafür von seiner Kostümbildnerin Ursula Renzenbrink ein Kleid verpasste, das gewollt-ungewollt Assoziationen zu Conchita Wurst herbeibeschwörte, sie betrunken taumeln oder in George Sand-Manier mit Zigarette auftreten ließ: in ihrem Element war sie allemal. Und zwar so, dass sie in dieser immer wieder mit dem Genderthema kokettierenden Szenerie vergessen machte, dass das Finale eher auf die sie am Ende als Frau heimführende Königstochter Ginevra denn auf sie, den seine männliche wie weibliche Seite zeigenden Königsvasall Ariodante, zugeschnitten ist.
Vivaldi rockt an der Volksoper
Aber wer kann sich schon mit ihrem wirbelnden Temperament, ihrer angeborenen Bühnenpräsenz messen, selbst wenn man um sie eine insgesamt festspielwürdige Besetzung aufgeboten hatte: mit Nathans Bergs virilem Schot-
tenkönig, Sandrine Piau nach zögerlichem Beginn überzeugender Dalinda, dem brillanten Counter Christian Dumaux als intrigantem, schließlich den Tod findenden Herzog Polinesso. Gesanglich differenzierter hätte man sich Norman Reinhardt als Ariodante-Bruder Lurcanio und Kristofer Lundin als Königs-Günstling Odoardo gewünscht. Mehr Eingehen auf die subtilen Seiten der Partitur und weniger einseitiger Drive wäre bei der Ausführung des Orchesterparts durch das neue Ensemble Les Musiciens du Prince -Monaco unter Gianluca Capuano vonnöten gewesen.
Auch die Volksoper entführte ins Barock, genauer dessen Rockversion: BaRock. Angeregt durch Vivaldis populären Violinkonzerte-Zyklus "Vier Jahreszeiten" macht sich Christian Kolonovits, der diese Uraufführung an der Spitze von Chor und Orchester der Wiener Volksoper auch dirigierte, in "Vivaldi. Die fünfte Jahreszeit" seine von dessen Musik inspirierten Rock-Gedanken, was eine fünfte Vivaldi-Jahreszeit sein könnte. Die Antwort errät man schon zu Beginn: dass seine Musik auch durch eine weibliche Rockformation nie an Aktualität verlieren wird. Auch in einen anderen als dem angestammten Klanggewand erhält sie ihre frische Brillanz, wie es Kolonovits' meist mit hämmernden Rhythmen aufwartende, mit zahlreichen Vivaldi-Ohrwürmern gespickte Musik demonstriert, die ihm zu Angelika Messners Buch eingefallen ist. Diese erinnert an Vivaldis bekanntlich in Wien endendes, nicht nur für einen Geistlichen turbulentes Leben.
Treffender als die dabei abgeschossenen Pointen präsentierten sich Christof Cremers zwischen Barock und Pop-Art changierenden geschmackvollen Bühnenbilder und seine zwischen Barock und Moderne vermittelnden, Übertreibung keineswegs aussparendenden bunten Kostüme. Die von Prinzipal Robert Meyer unaufdringlich geführte Besetzung ist gut gewählt: Andrew Dew als Vivaldi, Boris Pfeifer als Goldoni, Morten Frank Larsen als prägnantem Kardinal Ruffo und Rebecca Nelsen als von Vivaldi enttäuschter Sängerin Annina Girò.
Unkonventioneller "Parsifal"
Kultur ist das Gestern, Kunst ist das Morgen, davon ist Jonathan Meese überzeugt. In Bayreuth hat es mit seiner "Parsifal"-Regie nicht geklappt. Jetzt hat er einen "Mondparsifal" kreiert. Gleichermaßen Wagners Original erzählend, und wie dieses mit sehr freien Assoziationen erweitert, die er, sein eigener Regisseur und Ausstatter, plakativ bebildert. Mit Hinweisen auf Lohengrin, Götterdämmerung, die Nibelungen (eingeblendet in Stummfilmausschnitten) und garniert mit unmissverständlicherGesellschaftskritik.
"Mondparsifal" ist Ausdruck einer überschäumenden Fantasie, damit die Verwirklichung eines erklärten Meese-Dogmas: Kunst muss überspannen, Künstler müssen übers Ziel hinausschießen. Ein bewusst überbordendes Panorama, aber, wie im von Meese selbst gestalteten Begleitheft zu lesen, "More than a feeling". Denn diese in anderer Form auch in Berlin zu sehende Produktion ist nicht irgendwelchen spontane Einfällen geschuldet, sondern versucht die Vielfalt eines im Laufe der Jahrzehnte detailliert untersuchten Stoffs ebenso zu hinterfragen wie ihn aus möglichen weiterführenden Perspektiven zu betrachten. Unkonventionell, mutig, instruktiv.
Dagegen hält sich Bernhard Langs sehr auf Redundanzen setzende, wenig abwechslungsreiche Musik zu sehr am Original. Realisiert wurde sie vom Klangforum Wien, dem Arnold Schoenberg Chor und einem von Wolfgang Bankl (Gurnemantz/Gurnemanz), Daniel Gloger (Parzefool/Parsifal), Martin Winkler (Clingsore/Klinsor) und Magdalena Anna Hofmann (Cundry/Kundry) angeführten, exzellenten Solistenteam unter Simone Young auf hohem Niveau.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!








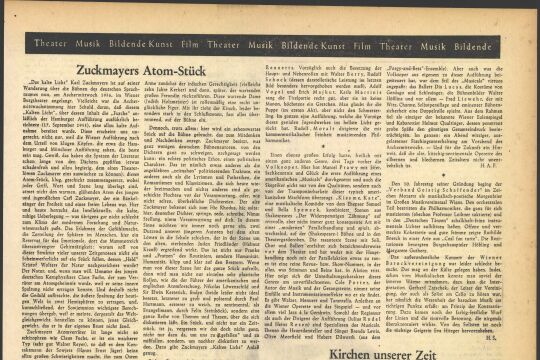





































































%20OFS_Monika%20Rittershaus%20(16).jpg)















_edit.jpg)




