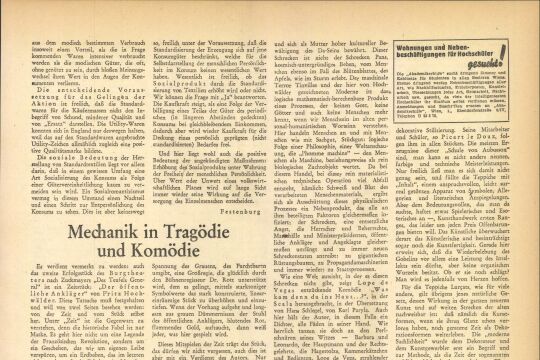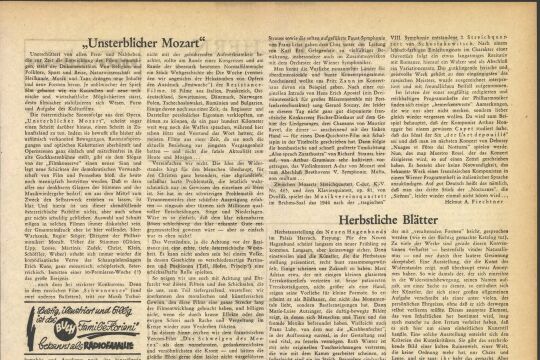Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Kleist unterm Messer
Operation gelungen — Patient noch am Leben, diagnostizierte man überrascht nach dem chirurgischen Eingriff, den Werner Ruzicka mit wenig Respekt, aber viel Intuition und Originalität an Kleists „Penthesilea“ vorgenommen hatte. Mit scharfem Skalpell wurde amputiert, reduziert, persifliert. Und eine Transplantation wesentlicher Teile des Geschehens aus der Effizienz des gesprochenen Wortes in die der optischen Suggestion vorgenommen. Schon einmal, in der Gestaltung der NO-Spiele, hat sich Werner Ruzicka als Regisseur mit einer ausgeprägten choreographischen Begabung erwiesen. Auch in seiner „Penthesilea-Story“ kommt dem Bewegungselement tragende Bedeutung zu.
Fünf Amazonen und vier Griechen — alle jung und wohlgestaltet — agieren in Jeans und mit Schnappmessern bewaffnet auf Heinz Hausers popartiger Schrägbühne, die der Phantasie freie Entfaltung erlaubt: auf zwei Laufstegen rechts und links tummeln, räkeln sich die feindlichen Teams, wenn sie sich nicht gerade auf dem Schlachtfeld balgen. Denn der Krieg, der Vater aller Dinge, ist ja ihr idealer Lebenszweck. So führen sie ihn denn vor aller Augen, katzengewandt und grimmig, anstatt ihn in langatmigen Botenberichten aus zweiter Hand zu liefern. Mitunter sprechen sie auch: Kleist kommt im Originaltext zu Worte. Pro Seite mit mindestens einer Zeile. Aber die hat es in sich. Im übrigen ist, wie gesagt, Aktion Trumpf. Die Mischung präsentiert sich als eine so glänzend gemachte, erfrischend junge Äußerung, daß man über ihrer Bühnenlegitimation die Respektlosigkeit zu verzeihen geneigt ist.
Wohl lassen Ulrike Thiel als hinreißende Amazonenkönigin und Herbert Rhom als prächtiger Achilles ihre Stammesgenossen ein Stück hinter sich, doch sie alle haben erfaßt — und es macht ihnen ganz offensichtlich größten Spaß, das zu demonstrieren —, worum es hier geht: sich so unbekümmert zu distanzieren wie feurig zu engagieren, die Identität mit den Dargestellten zu leugnen und sie doch in jedem Augenblick ihres Spiels erneut zu bekräftigen. In ihrer jugendlichen Intensität, in der perfekten Beherrschung des Vorwurfs mit allen seinen Nuancen sind sie nolens-volens schon wieder „klas-sich“. Und atemlose Spannung liegt über dem Höhepunkt, der zeigt, was Kleist nur indirekt zu schildern wagte: das grausige Ende einer leidenschaftlichen Haßliebe. Gekonnt läßt Angela Berann dazu ihr thronartig aufgebautes Schlagzeug rattern, raunen, zischen. Mitunter wird auch gelacht. Dann vor allem, wenn die Diskrepanz zwischen blumenreichen Metaphern und schauriger Realität schier unerträglich wird. Das ist offensichtlich im Sinne des Neo-Autors, der Kleist im gleichen Atemzug bejaht und leugnet, der seinen Klassiker zugleich hebt und zerfleischt wie Penthesilea ihren Achill, oder auch nur — wer wagt es zu entscheiden — auf die Wirkung spekuliert, die aus der Divergenz zwischen literarischem Establishment und Revoluzzertum resultiert. Für die Dauer eines brisanten Theaterabends war der Erfolg auf der Seite der Jungen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!