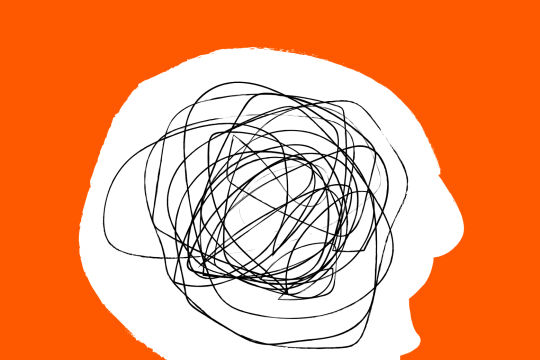Psychische Erkrankungen sind teils tabuisiert, Patienten werden zu Unrecht stigmatisiert. | Die Initiative ganz normal hält mit Aufklärung dagegen und ist für neue Vorsorge.
Soll Menschen mit psychischen Erkrankungen geholfen werden, wäre einiges zu tun: In der Versorgung mit Psychiatern droht ein Engpass, das Wissen über psychische Erkrankungen müsste verbessert, die Vorsorge ausgebaut werden, sagt Johannes Wancata, Psychiater in Wien:
FURCHE: Wie häufig sind psychische Erkrankungen? Stimmen die kolportierten Zahlen?
Johannes Wancata: Psychische Erkrankungen sind häufig, das wissen wir seit den 80er Jahren. Sie wurden lange Zeit nicht ernst genommen, auch im klinischen Alltag übersehen. Das passiert heute seltener, denn Aus- und Fortbildung haben sich stark verbessert. Die Anzahl von 900.000 kommt aus der Verwaltung. In der Fachliteratur ist diese Zahl höher. Unter den erwerbsfähigen Österreichern zwischen dem 18. und dem 65. Lebensjahr sind rund eine Million Menschen mit psychischen Erkrankungen. Nimmt man die Personen von über 65 Jahren und jene mit Demenz dazu, erhöht sich diese Zahl nochmals um 300.000 bis 350.000 Personen.
FURCHE: Um welche Formen psychischer Erkrankungen handelt es sich, Depressionen?
Wancata: Diese Zahlen meinen alle psychischen Erkrankungen zusammen. Die häufigsten sind depressive Störungen und Angststörungen, gefolgt von somatoformen Störungen, bei denen jemand über körperliche Beschwerden klagt, vor allem über Schmerzen, die aber psychisch bedingt sind.
FURCHE: Inwiefern bilden Umstände, die als belastend empfunden werden, wie Arbeit, Stress, Beschleunigung et cetera, eine Ursache für psychische Erkrankungen?
Wancata: Es gibt Phänomene wie Mobbing oder Burnout, aber diese Begriffe sind etwas unklar. Die Anzahl der Erkrankungen liefert keinen Hinweis darauf, dass sich hier Wesentliches geändert hat. Was wir sicher wissen, ist: Ob jemand psychisch Erkrankter schneller gesund wird oder nicht, wird auch von den Rahmenbedingungen mit beeinflusst. Wenn jemand depressiv ist und keine Arbeit hat, wird es länger dauern, bis er sich wieder stabilisiert. Wenn jemand am Arbeitsplatz ständig unter Druck steht und eine leichte Depression hat, wird diese Person dort länger ausfallen. Selbst wenn die Anzahl psychischer Erkrankungen bei Arbeitslosigkeit nicht steigt, so wissen wir doch, dass mit ihr die Anzahl der Suizide steigt. Ein Prozentpunkt mehr an Arbeitslosigkeit bedeutet eine um 1,1 Prozentpunkte höhere Suizidrate - außer in jenen Ländern, in denen mehr als 150 Euro pro Erwerbstätigem und Jahr investiert werden, um Arbeitslose aufzufangen, zu schulen und wieder in die Arbeit zu bringen.
FURCHE: Was ist denn bei Erkrankung zu tun?
Wancata: Ob im Falle einer Erkrankung für den Einzelnen eine Psychotherapie oder Medikamente oder beides notwendig ist, das müssen Fachleute entscheiden, also Ärztinnen und Ärzte. Bei leichten Depressionen haben Psychotherapie und Antidepressiva eine ähnlich gute Wirkung. Bei schweren Depressionen sind Medikamente der Psychotherapie eindeutig überlegen. Wenn Depressionen hingegen chronisch verlaufen, sich also über lange Zeit nicht bessern, dann hat eine Psychotherapie eine bessere Wirkung als Antidepressiva.
FURCHE: Gibt es ausreichend Fachleute?
Wancata: In den letzten Jahren wurde es mit Fachpersonal etwas enger. Die Stadt Wien hat in den 70er und in den 80er Jahren noch über ihren Bedarf hinausgehend Leute ausgebildet. Inzwischen wurde die stationäre Psychiatrie dezentralisiert, einige Bundesländer haben zudem eine psychiatrische Versorgung aufgebaut, die früher fehlte. Daher kam es in den letzten Jahren immer wieder zu Engpässen. Die Kinderpsychiatrie wird schon jetzt als Mangelfach erfasst und ich befürchte, dass auch die Erwachsenenpsychiatrie in absehbarer Zeit ein Mangelfach wird. Die Anzahl der Absolventen des Medizinstudiums verminderte sich - je nach Universität etwas unterschiedlich - in den letzten Jahren deutlich. Wenn ich vor sieben oder acht Jahren eine Stelle ausgeschrieben habe, bewarben sich etwa zwanzig Personen, heute hingegen nur mehr drei oder vier.
FURCHE: Worum geht es der Plattform ganznormal.at, in deren Fachbeirat sie vertreten sind?
Wancata: Ein Hintergrund ist der Mangel an Wissen über psychische Erkrankungen in der Öffentlichkeit. Das gelegentlich anzutreffende Halbwissen schürt wiederum falsche Vorstellungen. Der Punkt ist: Wenn jemand über psychische Erkrankungen etwas Bescheid weiß, dann begibt er sich im Fall der Fälle eher in Behandlung. Die Chance auf Behandlung ist dann höher.
FURCHE: Psychische Erkrankungen sind noch etwas tabuisiert.
Wancata: Es fehlt an Wissen, worin sie bestehen, wie man sie behandeln kann, wo Hilfe erhältlich ist. Die Idee von ganz normal ist, genau darüber zu informieren.
FURCHE: … womit aber noch nicht sicher ist, dass diese Erkrankungen erkannt werden.
Wancata: Psychische Erkrankungen werden heute, wie gesagt, besser erkannt. Dennoch wird ein nicht unwesentlicher Teil psychischer Erkrankungen übersehen, nicht zuletzt in der Hektik des Alltags. Daher sollte man eine Art Screening einführen, wie es etwa zur Krebsfrüherkennung schon in die Vorsorge-Untersuchungen eingebaut wurde. Es wird nicht reichen, seitens der Ärzte ein oder zwei Fragen zu stellen, es ist aufwändiger. Aber mit Fragebögen, die es bereits gibt, mit gut zehn bis fünfzehn Fragen, kann ich anhand der Antworten Hinweise darauf erhalten, ob jemand an einer Depression leidet.