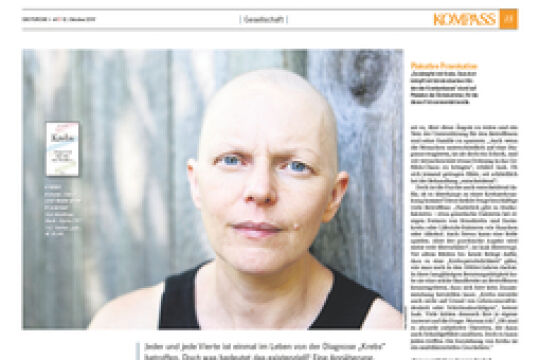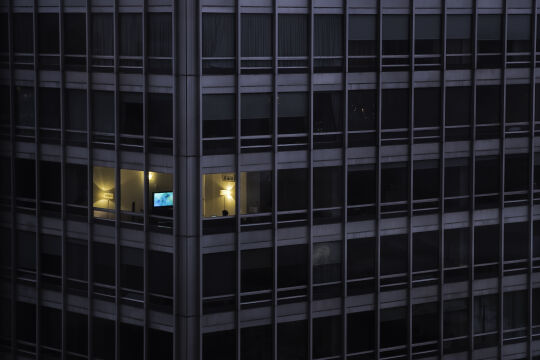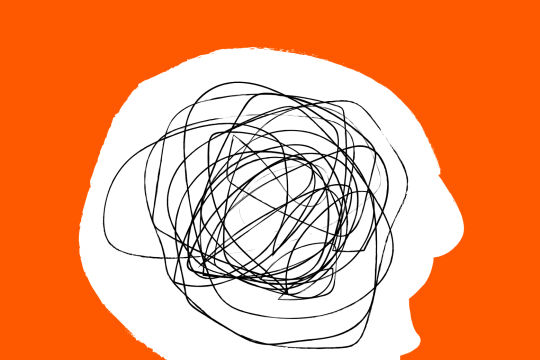Ein Politiker springt in den Tod, einer Ministerin wird öffentlich Suizidgefährdung bescheinigt: Zwei tragische Fälle aus Deutschland werfen die Frage nach der Prognostizierbarkeit und Prävention von Selbstmorden auf.
Es war nur ein kleiner Artikel am unteren Rand der Seite - neben Beiträgen über Gerhard Schröders Agenda 2010 und den aktuellen Ermittlungsstand zum mutmaßlichen Selbstmord von Jürgen Möllemann. So klein sie war, die Meldung ließ aufhorchen: "Sächsische Ministerin suizidgefährdet". Wie zahlreiche andere deutsche Medien berichtete die Süddeutsche Zeitung über die wohl einmalige Erklärung, zu der sich die sächsische Landesregierung Anfang vergangener Woche veranlasst gesehen hatte: Man hatte ein ärztliches Bulletin über den ernsten Gesundheitszustand von Sozialministerin Christine Weber veröffentlicht - mit deren Einverständnis. Weber wäre "akut suizidgefährdet" und durchlitte eine "schwere depressive Episode, die der stationären und längerfristigen Behandlung bedarf". Deshalb würde ihr vorerst jeglicher Kontakt zum Arbeitsumfeld und zu den Medien ärztlich untersagt. Seit Wochen war die CDU-Politikerin unter öffentlichem Beschuss gestanden: Ihr war vorgeworfen worden, illegal Fluthilfegelder bezogen zu haben. Einen Tag nach der Veröffentlichung der ärztlichen Stellungnahme trat Christine Weber schließlich zurück.
Problematisches Outing
Inwieweit auch der Tod von Jürgen Möllemann die Ärzte zu dieser ungewöhnlichen medialen Offensive veranlasst hat, bleibt unklar. Ebenso, wie eine solche Veröffentlichung einer Suizidgefährdung grundsätzlich zu beurteilen ist. "Ich würde mit einer solchen Diagnose nicht in die Öffentlichkeit gehen - es sei denn, es gibt eine klare Stellungnahme von Seiten des Patienten", meint Werner Schöny, ärztlicher Leiter der Landesnervenklinik Wagner-Jauregg in Linz. "Und auch dann würde ich die Suizidalität nie in den Vordergrund stellen." Grundsätzlich müsse beim Suizid immer zwischen Ursache und Motiv unterschieden werden: "Das Motiv ist oft ein äußerer Anlass. Die wirkliche Ursache kann aber ganz wo anders und viel tiefer liegen", weiß Schöny. Natürlich könne durch die Beschuldigung eines Fehlverhaltens eine Depression ausgelöst werden. Den Medien aber die Schuld an einem Selbstmord zuzuschieben, sei nicht legitim. "Außer es findet eine extreme Hetze statt." Ob dies bei Jürgen Möllemann zugetroffen sei? Vielleicht, meint der Psychiater: "Er hat aber auch manches dazu beigetragen."
Gefährdete Männer
Gernot Sonneck, Vorstand am Institut für medizinische Psychologie der Universität Wien, teilt die kritische Haltung seines Kollegen zur Bekanntmachung einer Suizidgefährdung: "Ich würde einem Patienten nicht raten, einen solchen Befund veröffentlichen zu lassen. Gerade bei den psychischen Krankheiten ist die Stigmatisierung noch immer groß."
Sonneck weiß, wovon er spricht. Seit 35 Jahren untersucht er die psychischen Abläufe, die Menschen dazu bringen, ihrem Leben selbst ein Ende zu machen. Erst jüngst hat er im Auftrag des Männerbüros des Sozialministeriums eine Studie über die "Suizidproblematik von Männern in Österreich" erstellt, die demnächst präsentiert wird. Einmal mehr wurde darin laut Sonneck bestätigt, was in der Suizidforschung seit langem als gesichert gilt: dass nämlich die Selbstmordrate bei Männern rund drei Mal so hoch liegt wie bei Frauen - obwohl diese häufiger unter Depressionen leiden und öfter Selbstmordversuche unternehmen. "Männer tun sich eben schwer, Störungen an sich wahrzunehmen oder Hilfe anzunehmen", erklärt Sonneck im Furche-Gespräch.
Eine solche Haltung findet sich auch unter den männlichen Klienten des Wiener Kriseninterventionszentrums, das von Sonneck und dessen Lehrer Erwin Ringel gegründet wurde: "Männer haben weniger und kürzere Kontakte zu uns", erzählt der Experte. "Sie täuschen ihre Helfer, weil sie sich selber täuschen."
Die Folgen sind dramatisch: So nehmen sich in Österreich rund 1.500 Menschen jährlich das Leben - vier pro Tag. Zehn Mal so viele unternehmen einen Selbstmordversuch. Wobei die Intention beim "missglückten" Suizid eine gänzlich andere sei, erklärt Werner Schöny im FurcheGespräch: "Ein Suizidversuch ist ein Hilfeschrei, ein Versuch, den Druck nach außen abzuleiten. Männer hingegen verdrängen oft ihre Probleme. Dann steigt die Aggression nach innen und es kommt tatsächlich zum Suizid."
Ein großes Problem ist nach wie vor die hohe Zahl nicht erkannter Depressionen: Zwar sind österreichweit 400.000 Menschen wegen ihrer Gemütsverfassung in Behandlung, doch werden geschätzte 60 Prozent aller Erkrankungen nicht diagnostiziert. Die Hoffnung ist groß, mit der Methode der Positronen-EmissionsTomografie (PET), wie sie Siegfried Kasper von der Universitätsklinik für Psychiatrie in Wien forciert, die zu Grund liegenden Störungen des Stoffwechsels im Gehirn aufzuspüren. "PET ist eine wichtige Entwicklung", ist auch Werner Schöny überzeugt. "Es ist aber nicht so, dass man einen depressiven Menschen einfach unter dieses Gerät legt und damit sein Suizid-Risiko im Griff hat."
Niedrige Suizidrate
Indes ist der positive Trend bei der heimischen Suizidrate unbestritten: Durch vermehrte mediale Aufklärung und bessere psychiatrische Betreuung von Risikogruppen - etwa Alkohol-, Drogen- und Medikamentenabhängige, psychisch kranke und alte Menschen - konnte die Rate von 26 Fällen auf 100.000 Einwohner Mitte der achtziger Jahre auf derzeit 16 bis 18 Selbstmorde gesenkt werden. "Das ist ein historischer Tiefststand", freut sich Gernot Sonneck: Allein in Wien sei die Rate seit 1986 um über 40 Prozent zurückgegangen. Somit rangiert Österreich heute gemeinsam mit Deutschland, Schweden, Japan, Kanada und den USA im Mittelfeld. Traurige "Spitzenreiter" punkto Suizidhäufigkeit sind Ungarn, Finnland und das Baltikum.
Dennoch warnen die Experten vor einer Zunahme an Selbstmorden unter älteren Menschen: "Bei den über 80-Jährigen liegt die Rate bei 100 Selbstmorden. Auch bei Arbeitslosen und Geschiedenen ist sie stark erhöht", rechnet Werner Schöny vor. Ursachen seien hier wie dort oft der Verlust der sozialen Rolle und vor allem Einsamkeit. Umso wichtiger sei die Einbindung dieser Personen in soziale Netze und die Erhöhung der Lebensqualität. "Viele Menschen sagen, hätte ich nicht meine Familie oder auch meine Religion, ich hätte mir das Leben genommen."
Religion und Selbstmord
Dass sich die religiöse Zugehörigkeit tatsächlich, wenn auch nur minimal auf die Höhe der Suizidrate auswirkt, hat auch Gernot Sonneck in seiner aktuellen Studie festgestellt: So seien Juden und Muslime stark unterrepräsentiert, römisch-katholische Christen leicht unterrepräsentiert sowie evangelische Christen und konfessionslose Menschen leicht überrepräsentiert. "Wichtiger als der Glaube selbst ist aber das Gefühl, zu einer Gemeinschaft dazuzugehören", betont Sonneck.
In Gemeinschaft ist es nicht zuletzt auch möglich, auf etwaige Suizid-Ankündigungen aufmerksam zu werden. In immerhin 80 Prozent aller Selbstmord-Fälle geben die Betroffenen im Vorfeld eine direkte oder indirekte Form der Mitteilung ab. Umso wichtiger seien Aufmerksamkeit und offene Worte. Dennoch hält sich das hartnäckige Vorurteil, dass depressive Menschen durch das Ansprechen eines möglichen Suizid-Risikos erst auf den Gedanken kämen, sich das Leben zu nehmen: "80 Prozent aller Depressiven denken an Suizid. Diese Gedanken müssen im Rahmen eines intensiven Gesprächs erhoben werden", erklärt Werner Schöny. Wenn das präsuizidale Syndrom mit seiner typischen Einengung der Affekte bereits eingetreten sei, sei es zu spät: "In diesem Stadium sind die Menschen völlig unauffällig, weil sie schon alles hinter sich haben. Sie suchen nur noch nach dem geeigneten Zeitpunkt, um ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen."
Nähere Informationen und Hilfe beim Kriseninterventionszentrum Wien unter (01) 406 95 95-0.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!