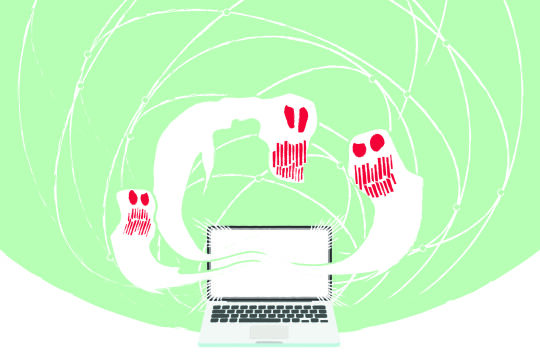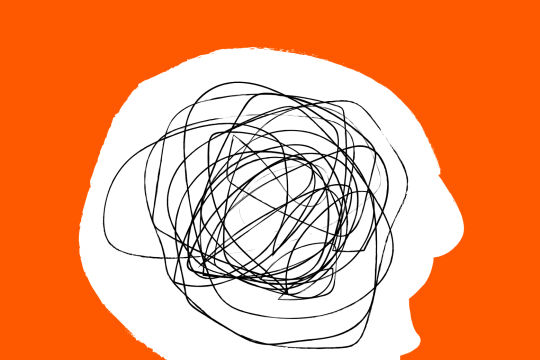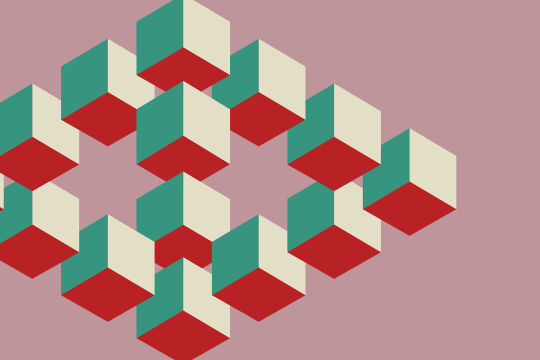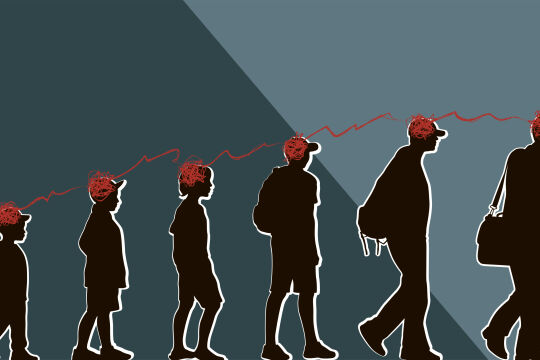Die Zahl schreckte ganz Kärnten auf: 22 Drogentote allein im laufenden Jahr! Die Medien überschlugen sich, der Kärntner Landtag berief im Oktober eine öffentliche Sitzung des Gesundheitsausschusses ein und der Suchtbeirat traf sich im November. Wie waren 22 Drogentote im südlichen Bundesland zu erklären, wo es doch in den beiden Jahren davor nur je zwölf Tote gab und 2014 nur vier? Die Aufregung war groß, doch die Behörden versuchten zu kalmieren. Die Zahl sei ein "statistischer Ausreißer", meinte das Landeskriminalamt. Auch Wolfgang Wladika, Leiter der Kinderund Jugendpsychiatrie am Klinikum Klagenfurt, warnte vor Hysterie. Angesichts der geringen Zahlen seien Schwankungen von bis zu 70 Prozent keine Seltenheit, auch gingen die Zählweisen von "Drogentoten" je nach Bundesland auseinander. Selbst die Zahl der 165 "direkt drogenbezogenen Todesfälle", wie sie der "Epidemiologiebericht Sucht" 2016 für ganz Österreich ausweist, sei unscharf. Denn ab wann gilt eine Droge als direkter Auslöser eines Todes? Und was bedeutet das überhaupt: Sucht?
Wladika weiß um die Komplexität dieser Frage, er kennt nicht nur die Lebensgeschichten fast aller Kärntner Todesopfer dieses Jahres, er hat auch die Krankenakten von 50 Fällen aus den vergangenen Jahren analysiert. Nur bei einem Fünftel waren Heroin oder Kokain tödlich, der Großteil starb an einem Medikamenten-Mix in letaler Dosis: Antidepressiva, Tranquilizer und Benzodiazepine -ein Beruhigungsmittel mit hohem Suchtpotenzial; dazu oft noch Alkohol und Cannabis. Unter dem Druck der Sucht würden "wahllos" Substanzen eingenommen, weiß Wladika. Die allermeisten Betroffenen hatten jedenfalls lange Krankheitsverläufe, sie waren psychisch krank und psychosozial belastet. Dennoch kam ein Großteil von ihnen nie mit dem Drogenhilfesystem in Kontakt. "Sucht ist eine tödliche Erkrankung, vor allem dann, wenn sie unbehandelt bleibt", lautet Wladikas Conclusio. "Bei massiven Belastungen muss man deshalb früh intervenieren." Zugleich müsse man die Folgen illegaler Drogen auch in Relation sehen, meint er: "Es gibt jährlich 8000 Alkoholtote in Österreich, davon 500 in Kärnten. Doch das interessiert keinen."
"Crystal Meth" als bösartigste Droge
Ob illegale oder legale Drogen: Für die Betroffenen ist jede Suchtkrankheit eine Tragödie. Warum manche Menschen vom problematischen Konsum in die Abhängigkeit schlittern und andere nicht, ist dabei von vielen Aspekten abhängig. Genetische Faktoren spielen ebenso eine Rolle wie das soziale Umfeld und die individuelle Persönlichkeit. Manchmal entwickelt sich eine Abhängigkeit über Jahre, manchmal geht sie innerhalb von Tagen, wie etwa bei "Crystal Meth"(Methamphetamin), einer der aktuell bösartigsten Drogen, zu der es in Oberösterreich eine lokale Szene gibt.
Die Angehörigen sind vom Abgleiten in die Sucht existenziell betroffen, erleben sich dabei aber als hilflos. Es sind Dramen, die sich abspielen: Eltern, die helfen wollen, aber es nicht können; Kinder, die sich um ihren alkoholkranken Elternteil und ihre eigenen Geschwister kümmern; Partner, die täglich ihre eigene Ohnmacht erleben und sich dabei zunehmend selbst sozial isolieren.
"Co-Abhängigkeit" heißt der Fachbegriff dafür, und nach Ansicht des deutschen Pädagogen, Suchttherapeuten und Autors Heinz-Peter Röhr ist sie eine schwere Störung, die ebenso behandlungsbedürftig ist wie die Suchtkrankheit selbst. Mehr als 30 Jahre lang hat Röhr in einer Fachklinik für Suchtmittelabhängige gearbeitet."Wenn ich Angehörige frage, wieviele Stunden pro Tag denken Sie an Ihr suchtkrankes Kind oder Ihren suchtkranken Partner, dann sagen viele: Eigentlich immer, solange ich wach bin, und das Problem verfolgt mich bis in den Traum hinein", erzählt er. Die allermeisten versuchen, die immer größer werdende Unsicherheit in der Familie auszugleichen, sie entschuldigen den Suchtkranken in der Arbeit, decken bei Freunden sein Fehlverhalten, verstecken das Suchtmittel, arbeiten mit Liebesentzug und versuchen den anderen mit moralischen Vorhaltungen zu bessern. "Die Co-Abhängigen glauben, damit helfen zu können, doch das ist ein Irrtum", sagt Röhr im FURCHE-Gespräch. Weil Suchtkranke auf emotionalen Druck trotzig reagieren, verschlimmert sich die Lage eher. Ein Teufelskreis beginnt und führt zu Abhängigkeit auf beiden Seiten: "Genau wie der Kontrollverlust das zentrale Merkmal der Suchtkrankheit ist, ist die Unfähigkeit, mit dem Helfen aufzuhören, das zentrale Merkmal der Co-Abhängigkeit. In diesem Sinne wird der Co-Abhängige ebenfalls suchtkrank", schreibt Röhr in seinem Buch "Sucht -Hintergründe und Heilung" (s. Tipp). Die Folgen sind bald zu spüren: Das ständige Wechselbad von Schuldgefühlen, Ohnmacht, (Selbst)Hass und Trauer führt zu Angst, Panikanfällen und Depression; körperliche Symptome wie Migräne, Bandscheibenund Magenbeschwerden sowie Herzerkrankungen sind typische Reaktionen auf diese Dauerüberforderung.
Was helfen könnte? Vor allem Aufklärung - über die Suchtkrankheit und über die Co-Abhängigkeit, meint Röhr: "Auch der Co-Abhängige muss krankheitseinsichtig werden und erkennen, dass er unfähig ist, mit dem Helfen aufzuhören." Wobei diese Behandlung noch schwieriger sei als die des Suchtkranken. An erster Stelle steht nämlich die Herausforderung, den Süchtigen loszulassen. "Das bedeutet nicht, sein eigenes Kind fallenzulassen, aber eine Zeitlang in den Hintergrund zu treten und klar zu machen: Ich will dir nicht mehr helfen bei einem Selbstmord auf Zeit", meint der Therapeut. "Die Botschaft sollte sein: Ich bin immer an deiner Seite und zur Stelle, wenn du aus der Sucht herauskommen willst -aber du selbst musst das wollen, ich kann dich nicht hinausprügeln oder befreien."
Schuld und Scham
Eine solches Loslassen zu schaffen, ist schwer, ja ohne Hilfe meist unmöglich. Es ist ein Trauerprozess, ein Abschiednehmen von der Vorstellung, wie der Angehörige sein Leben gestalten soll. Radikal zugespitzt wird diese Trauer, wenn der Betroffene tatsächlich stirbt - wie die 22 Menschen heuer in Kärnten. Ähnlich wie nach einem Suizid wird der Trauerverlauf hier deutlich erschwert, weiß Karlheinz Six. Seit drei Jahren leitet der in Klagenfurt lebende katholische Theologe, Trauerbegleiter sowie Lebens-und Sozialberater eine Gesprächsgruppe für Suizidhinterbliebene. Weil das Thema "Sucht" immer wieder auftaucht - und weil es in Kärnten offenbar Bedarf gibt - hat er in Zusammenarbeit mit dem Referat für Trauerpastoral der Katholischen Kirche Kärnten und der Plattform "Verwaiste Eltern" die Gründung einer eigenen "Trauergruppe für Betroffene nach dem Tod suchtkranker Menschen" initiiert. Finanziert werden soll sie über Crowdfunding (s. u.).
"Die Trauer ist im Fall von Sucht sehr spezifisch", weiß Six. "Häufig kommt es zu Gefühlen von Schuld und Scham, man glaubt, als Eltern versagt zu haben. Dazu wird einem noch von außen her Schuld zugesprochen." Der Einfluss der Eltern ist freilich von vornherein begrenzt, weiß Six. Eine Mutter, deren Sohn mit 30 Jahren -nach 15 Jahren Abhängigkeit -an einer Überdosis gestorben ist, hat es so formuliert: "Das Bild des suchtkranken Menschen ist ein Mosaik, und die Eltern sind nur ein Stein, ein Teilbereich darin." Vieles hat mit ihnen zu tun, aber "Schuld" ist die falsche Kategorie, schließlich läuft Vieles nicht in böser Absicht ab. Die vorhandenen Schuldgefühle offen gegenüber anderen Betroffenen ausdrücken zu können, sich aus der Co-Abhängigkeit zu befreien und zugleich mit dem Verstorbenen in Beziehung zu kommen oder zu bleiben (sei es am Grab oder einem gemeinsam geliebten Ort), darum soll es in der Klagenfurter Trauergruppe gehen.
"Du genügst immer!"
Doch was können Eltern tun, um das Suchtrisiko ihres Kindes schon von vornherein zu reduzieren? Für Heinz-Peter Röhr liegt der Schlüssel im Selbstwertgefühl. "Meist haben Suchterkrankungen mit schweren Selbstwertstörungen zu tun", weiß der Therapeut. Maßgeblich entwickelt sich das Selbstwertgefühl ihm zufolge vor dem sechsten Lebensjahr: Hat das Kind das Gefühl, nicht willkommen zu sein, angesichts perfektionistischer Eltern niemals zu genügen oder zu kurz gekommen zu sein, steige das Risiko, den "inneren Hunger" später mit einem Suchtmittel zu stillen. Den Selbstwert eines Kindes zu stärken, ist deshalb laut Röhr die beste Prophylaxe, auch jenseits von sechs Jahren. "Wenn ein Kind psychische Auffälligkeiten zeigt, sollte man psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Aber oft kann es auch helfen, wenn es sich in Gruppen bewegt, wo dieses Gefühl des Genügens stabilisiert wird -und wenn man ihm regelmäßig in gewährender Gelassenheit eine Botschaft zuspricht: Du genügst immer!"
Beratung zum Thema (Co-)Abhängigkeit: suchthilfekompass.goeg.at, www.gruenerkreis. at, checkit.wien, www.dialog-on.at. Infos zur Trauergruppe Sucht: www.socialfunding.at