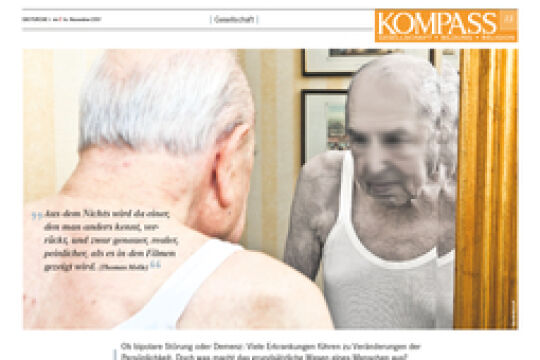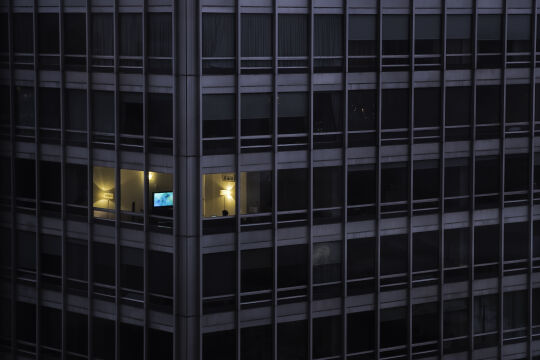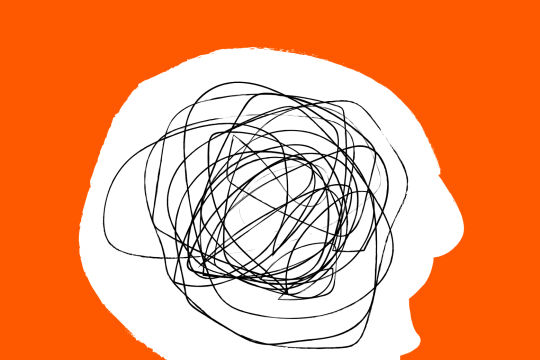Der ganz normale Wahnsinn
Schon jetzt gehören psychische Erkrankungen in Europa zu den am öftesten gestellten Diagnosen. Die Lage wird sich noch massiv verschärfen.
Schon jetzt gehören psychische Erkrankungen in Europa zu den am öftesten gestellten Diagnosen. Die Lage wird sich noch massiv verschärfen.
Der Psychiater Georg Psota kann sich gut an diesen Patienten erinnern: Der junge Mann erkrankte an Schizophrenie und hätte die Unterstützung seiner Familie dringend gebrauchen können. Doch die Angehörigen konnten nicht akzeptieren, dass ihr Liebling plötzlich "verrückt“ geworden war. Dann erkrankte der arme Kerl auch noch an Leukämie - und plötzlich kümmerte sich die Familie liebevoll um ihn. "Das ist wenigstens eine ordentliche Krankheit“, versetzt sich Psota kopfschüttelnd in die Gedanken der Angehörigen.
Psychische Erkrankungen führen nach wie vor zu einer Stigmatisierung des Betroffenen. "Das Stigma macht genauso krank wie die Krankheit selbst“, betont der Chefarzt der Psychosozialen Dienste Wien. Zwar würde heute niemand mehr in der Öffentlichkeit psychisch Kranke als "verrückt“ oder "irr“ titulieren, doch umgekehrt ist man bei Gewaltherrschern, politischen Extremisten oder Menschen, die eine Aktion fernab der gängigen Moralvorstellungen gesetzt haben, schnell mit solchen Worten bei der Hand.
Den nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un als "Irren“ oder "Psychopathen“ zu bezeichnen, gehört fast zum guten Ton - aber für psychisch Kranke ist es kein Vergnügen, in einen Topf mit derartigen Persönlichkeiten geworfen zu werden. Umgekehrt gibt es eine Reihe von Staatenlenkern, die tatsächlich an einer psychischen Erkrankung litten, aber als große Männer in die Geschichte eingegangen sind: George Washington und Abraham Lincoln litten unter Depressionen und Winston Churchill unter einer bipolaren Störung. Das weiß aber leider kaum jemand.
Es kann jeden treffen
Die Stigmatisierung ist auch deshalb fehl am Platz, weil psychische Erkrankungen sehr schnell jeden treffen können. Diese Leiden kommen in allen Altersgruppen und Gesellschaftsschichten vor. "Psychische Erkrankungen gehören in Europa zu den häufigsten Diagnosen, besonders im erwerbsfähigen Alter“, erklärt Bernhard Schwarz, Professor am Zentrum für Public Health der Medizinischen Universität Wien. Je nach Berechnung beträgt die lebenslange "Prävalenz“, also die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens daran zu erkranken, bei Angsterkrankungen zwischen 14 bis 25 Prozent, bei affektiven Erkrankungen wie etwa Depression zwischen zehn bis 20 Prozent, bei Anpassungsstörungen wie Burnout sogar zwischen 20 bis 50 Prozent und beiSuchterkrankungen zwischen 15 bis 27 Prozent. Derzeit gibt es in Österreich etwa 460.000 Invaliditätspensionisten; der jährliche Neuzugang liegt bei etwa 30.000, davon über 9.000 jährlich durch psychische Krankheiten.
"Psychische Erkrankungen haben massive wirtschaftliche Folgen“, betont Schwarz. Demenz verursacht in Österreich jährliche Gesamtkosten von 1,1 Milliarden Euro, Psychosen 1,3 Milliarden Euro und affektive Krankheiten 2,4 Milliarden Euro. Davon entfallen etwas mehr als ein Drittel auf direkte Behandlungskosten und knapp zwei Drittel auf Produktivitätsverluste.
Wobei Arbeitsunfähigkeit ein deutlich kleinerer Faktor ist als der sogenannte "Präsentismus“: Darunter verstehen Experten Anwesenheit am Arbeitsplatz trotz eingeschränkter Gesundheit bzw. Erkrankung. Die Produktivitätsverluste durch Präsentismus betragen laut verschiedener internationaler Studien das Vier- bis Fünffache der durch Krankenstände verursachten.
Dem großen medizinischen Bedarf und der großen wirtschaftlichen Bedeutung steht besonders in Österreich eine niedrige Dichte an Fachspezialisten, besonders an Fachärzten für Psychiatrie gegenüber“, kritisiert Schwarz - ein Umstand, auf den alle Experten seit Jahren hinweisen. Pro 1.000 Einwohner gibt es in Österreich nur 0,14 Fachärzte für Psychiatrie. Damit rangiert Österreich im europäischen Vergleich an hinterer Stelle. Besonders betroffen sind die jungen Patienten: In mehreren Bundesländern gibt es keinen einzigen niedergelassenen Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Depression im Vormarsch
Und es wird nicht besser - im Gegenteil. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass im Jahr 2030 gleich drei psychische Erkrankungen unter den "Top five“ in den Industrieländern rangieren, was Lebensjahre mit krankheitsbedingter Behinderung und durch vorzeitigen Tod verlorene Lebensjahre anbelangt: Alzheimer sowie andere Formen der Demenz, Alkoholsucht und - an erster Stelle - Depression. Bereits jetzt ist Depression die zweitwichtigste Erkrankungsursache. Eine Depression nämlich zieht massive Folgeerkrankungen nach sich, die von weiteren psychischen Erkrankungen wie etwa Alkoholmissbrauch und Demenz bis hin zu Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfall reichen. Einer kürzlich veröffentlichten Studie zufolge haben Depressive ein um 45 Prozent erhöhtes Risiko, einen Hirnschlag zu erleiden, und eine um 55 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, daran zu versterben. Fünf bis acht Prozent aller Erwachsenen erleiden pro Jahr eine depressive Episode mit einer durchschnittlichen Dauer von etwa zwölf Wochen. Das lebenslange Risiko jedes Erwachsenen, an Depression zu erkranken, liegt bei 12 bis 16 Prozent, wobei Frauen doppelt so oft betroffen sind. Zwei bis zehn Prozent der Betroffenen benötigen stationäre Betreuung.
Inzwischen kann die Depression relativ gut medikamentös behandelt werden. "Dass die Zahl der Suizide seit Jahren sinkt, hat mit der steigenden Verbreitung von Psychopharmaka zu tun“, erklärt Sachs. Antidepressiva sorgen dafür, dass sich die Zellfortsätze der Nervenzellen bilden und ausbreiten, und sie regen auch das Wachstum von Synapsen, den Verbindungsstellen zwischen den Nervenzellen, an. Anders als lange vermutet, können sich Nervenzellen auch noch im Gehirn Erwachsener positiv verändern. Das Problem dabei: Psychopharmaka haben einen schlechten Ruf, daher lässt die Therapietreue zu wünschen übrig. "40 bis 60 Prozent der pychiatrischen Patienten nehmen ihre Medikamente nicht. Oder sie setzen diese viel zu schnell ab, sodass es zu Rückfällen kommt.“
Das Stigma bekämpfen
Die Psychiaterin ist daher bestrebt, den Menschen die Angst vor Psychopharmaka zu nehmen. Nur gewisse Psychopharmaka, etwa Benzodiazepine, deren kurzfris-tige Einnahme akute psychische Symptome lindern kann, können abhängig machen: "Kein Abhängigkeitspotential haben etwa Antidepressiva, Antipsychotika und Stimmungsstabilisierer.“
Sie wird nicht müde, zu betonen: "Essenziell ist die Entstigmatisierung psychischer Leiden.“ Neben unentwegter Aufklärung arbeiten die Psychiater mit diversen Tricks, um dieses Ziel zu erreichen. Schwarz, der Workshops über psychische Erkrankungen organisiert, erzählt: "Wenn ‚Psycho-‘ im Titel vorkommt, trauen sich nicht viele hin, gerade am Land. Daher arbeiten wir nun mit dem Begriff, Empowerment‘.“ Etwas Bewegung hin zu mehr Akzeptanz hat Psota zumindest bei Alzheimer-Demenz ausgemacht: "Es scheint, dass Alzheimer immer mehr als etwas gesehen wird, das im Leben nun einmal vorkommen kann.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!