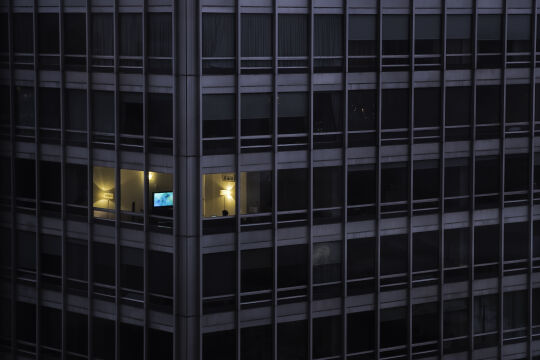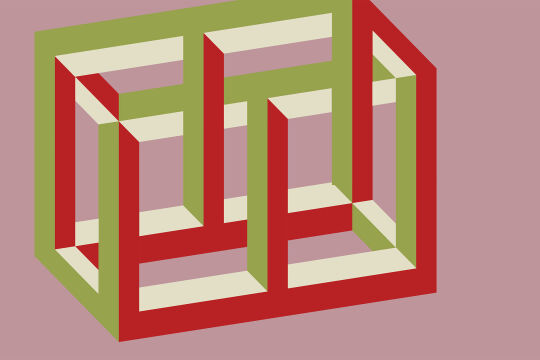Die Barmherzigen Brüder luden den Gesundheitsminister und Experten zur Diskussion "Macht Armut kränker?“. Statistiken und Zahlen lassen nur eine eindeutige Anwort zu: Ja. Gesundheit hat auch mit Einkommen zu tun.
"Kranke Menschen werden ärmer, arme Menschen werden kränker“, bekräftigt Gesundheitsminister Stöger. "Armut zu bekämpfen ist daher auch aus gesundheitspolitischer Perspektive wichtig“, betonte der Minister vorige Woche bei einer Diskussionsveranstaltung im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien. Bei diesen Äußerungen handelt es sich um alles andere als politische Parolen. Dass ein direkter Zusammenhang zwischen Armut und Krankheit besteht, ist längst erwiesen. Dazu gibt es internationale Studien, aber auch die Daten der Statistik Austria sprechen Bände.
Arme erkranken häufiger schwer, erleiden öfter Unfälle und sterben früher. "Armut macht krank“, bringt es Martin Schenk, Sozialexperte der Diakonie Österreich, auf den Punkt. Der Mitinitiator der österreichischen Armutskonferenz leitet seine Ausführungen gerne mit den Worten ein: "Sage mir, wo du wohnst, und ich sage dir, wann du stirbst.“ Damit umschreibt er den Zusammenhang zwischen Immobilienpreisen - als Maß für den relativen Wohlstand - und der durchschnittlichen Lebenserwartung. Dies macht sich sogar im Vergleich zwischen den Bezirken ein- und derselben Stadt bemerkbar. Vier U-Bahn-Stationen trennen den noblen ersten Bezirk in Wien vom armen 15. Bezirk - und vier Jahre Lebenserwartung. Auch das Sterberisiko während sommerlichen Hitzeperioden ist in den billigeren Bezirken deutlich höher als in der Innenstadt.
Doppelt so häufig erkrankt
Die Bevölkerung unter der Armutsgrenze weist einen um das Dreifache schlechteren Gesundheitszustand auf als Leute mit hohem Einkommen und ist doppelt so oft krank wie Menschen mit mittlerem Einkommen. Aus dem aktuellen Armutsbericht der Stadt Graz geht hervor, dass in den armutsgefährdeten Haushalten der Landeshauptstadt jeder zweite Erwachsene an einer chronischen Krankheit oder an Einschränkungen aufgrund eines gesundheitlichen Problems leidet. In einkommensreichen Haushalten betrifft dies nur jeden Fünften. "Das Bild ist überall das gleiche“, erklärt Schenk: "Mit dem sinkenden sozialen Status steigen die Krankheiten an, die untersten sozialen Schichten haben die schwersten Krankheiten und gleichzeitig die geringste Lebenserwartung.“
Gesundheitliche Risikofaktoren wie Rauchen oder extremes Übergewicht sind bei sozial benachteiligten Gruppen häufiger anzutreffen, präventives Verhalten wie zum Beispiel Vorsorgeuntersuchungen seltener. Doch dieses Risikoverhalten wirkt sich weniger stark auf die Gesundheit aus als die Lebensumstände. Armut bringt schlechte Wohnverhältnisse mit sich. Arme wohnen oft an verkehrsreichen, lauten Straßen; Feuchtigkeit und Schimmel gehören bei nicht weniger als einem Zehntel der Österreicher zum Wohnalltag. Wer sein Arbeitsleben lang schwere Arbeit, etwa am Bau, ausführen muss, bekommt früher oder später Rückenprobleme. Aufgrund dieser Verhältnisse ist es sogar so, dass arme Raucher früher sterben als reiche Raucher.
Armut hat jedoch nicht nur körperlichen, sondern auch psychische Auswirkungen, welche die Gesundheit negativ beeinträchtigen. "Armut bedeutet einen bedrückenden Drahtseilakt zwischen, es gerade noch schaffen‘ und Absturz“, schildert Schenk. Zu Abstiegserfahrungen oder der permanenten Angst vor dem sozialen Abstieg kommen Demütigung, Ohnmacht, Beschämung, Stigmatisierung, Isolation. Die frustrierende Erfahrung, trotz Leistung und Engagement nicht aus der Armut herauskommen zu können, zermürbt die Betroffenen. Die Folge ist chronischer Stress, der zu hohem Blutdruck, Gefäßerkrankungen, Infarktrisiko und zu einer Schwächung des Immunsystems führen kann. Die sogenannte Managerkrankheit mit Bluthochdruck und Infarktrisiko tritt bei Armen dreimal so häufig auf wie bei den Managern selbst. Aber nicht weil die Manager weniger Stress haben - sondern weil sie die Möglichkeit haben, dem Stress bei einem schönen Abendessen oder einem Wochenendtrip nach Paris zu entkommen.
Sozialer Ausgleich als Mittel
Was tun? "Die meist verhaltensorientierten Gesundheitskampagnen greifen bei Armen nicht“, weiß Schenk. Der bei Einkommensschwachen verbreiteten ungesunden, fetten und kohlehydratreichen Ernährungsweise ist mit Appellen nicht beizukommen. Armen geht es schlicht und einfach darum, schnell und billig satt zu werden. Nach einer leichten Gemüsemahlzeit meldet sich der Hunger schnell wieder zurück; und für aufwendige Zubereitungen fehlt die Zeit. "Die aktuelle Debatte ist verhaltensversessen und verhältnisvergessen“, kritisiert der Sozialexperte.
Was er damit meint: Die beste Gesundheitsvorsorge ist sozialer Ausgleich. Eine Gesellschaft mit großen sozialen Unterschieden bringt gesundheitliche Nachteile für alle. Soziale Ungleichheit bedeutet mehr Krankheiten, mehr chronischen Stress, geringere Lebenserwartung - und damit höhere volkswirtschaftliche Kosten. Gesellschaften mit relativ ausgewogener Verteilung von Einkommen und Lebenschancen weisen einen besseren Gesundheitszustand auf als Gesellschaften, in denen die soziale Schere weit auseinanderklafft. Die Armutsforschung hat die mangelnde Ausgewogenheit der Einkommensverhältnisse als jenen Faktor identifiziert, der am stärksten die häufigere Erkrankung Ärmerer erklärt. Martin Schenk: "Nicht, wie reich wir insgesamt sind, ist hier die Frage, sondern wie stark die Unterschiede zwischen uns sind.“
Von allen Armen am schlechtesten dran sind jene, die gar keine Krankenversicherung haben. Wer nicht versichert ist, hat nur in Notfällen Anspruch auf medizinische Versorgung. Zur Behandlung gesundheitlicher Probleme, die nicht unmittelbar lebensbedrohend sind, bleibt nur der Weg zu jenen rar gesäten Einrichtungen, die auch Nicht-Versicherte versorgen: das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien, das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Linz und die Marienambulanz in Graz. "Gemäß unserer Ordensphilosophie, Gutes tun und es gut tun‘ kann jeder zu uns kommen“, betont Reinhard Pichler, der Gesamtleiter des Krankenhauses Barmherzige Brüder in Wien. Und er erklärt: "Jeder wird behandelt, auch wenn er nicht versichert ist.“
Nach Angaben des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger leben 1,3 Prozent der Österreicher zumindest zeitweise ohne Krankenversicherung. Dabei handelt es sich keineswegs nur um Obdachlose oder illegale Zuwanderer. Auch geringfügig Beschäftigte oder Selbstständige verdienen oft so wenig, dass sie sich die Versicherungsbeiträge nicht leisten können.
Plötzlich fehlt die Versicherung
Andere wiederum wissen gar nicht, dass sie temporär nicht versichert sind. Das betrifft häufig junge Menschen. Am 18. Geburtstag nämlich endet die Mitversicherung bei den Eltern oft automatisch, ohne dass die Betroffenen darüber informiert werden. Und wer weiß schon, dass nach einer Scheidung oder nach dem Tod des Ehepartners die Mitversicherung erlischt und man sich um eine eigene Versicherung kümmern muss? Auch wer sich selbst versichert, steht eine Zeitlang ohne Schutz da: Mindestens drei Monate, in den meisten Fällen aber ein halbes Jahr muss man warten, bis man als Selbstversicherter medizinische Leistungen in Anspruch nehmen darf.
Dann gibt es noch die Gruppe jener, die zwar in Wahrheit korrekt versichert sind, aber aufgrund von bürokratischen Verzögerungen nicht im E-Card-System aufscheinen. Das Arbeitsmarktservice (AMS) zum Beispiel braucht oft Wochen, um einen Arbeitslosen dem Hauptverband zu melden, so dass er dort als Versicherter registriert wird. Auch wenn junge Leute von der Mitversicherung bei den Eltern zu einer Pflichtversicherung wechseln, kommt es immer wieder vor, dass es heißt: "kein Versicherungsanspruch“.
"Das kann schneller gehen, als man glaubt, und kann jeden treffen“, weiß Reinhard Pichler. Seine Frau nämlich stand eines Tages ohne Krankenversicherung da: Nachdem eine Teilzeitbeschäftigung zu Ende gegangen war und sie sich wieder der Familienarbeit zu Hause widmete, war sie unwissentlich ohne Versicherungsschutz. Bemerkt wurde dies erst bei einem Arztbesuch. Das E-Card-System teilte der verdutzten Patienten mit, dass sie nicht versichert war. "Es war nur ein kleiner Augenarzttermin“, erzählt Pichler: "Aber man stelle sich vor, es wäre ein akuter Zwischenfall gewesen.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!