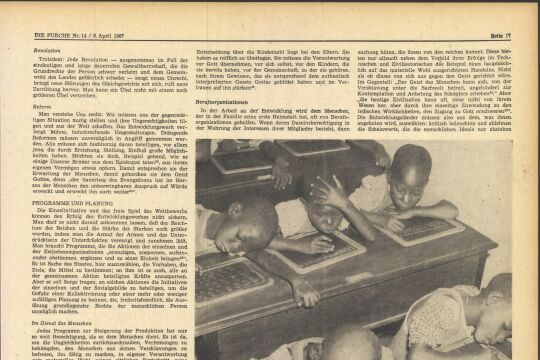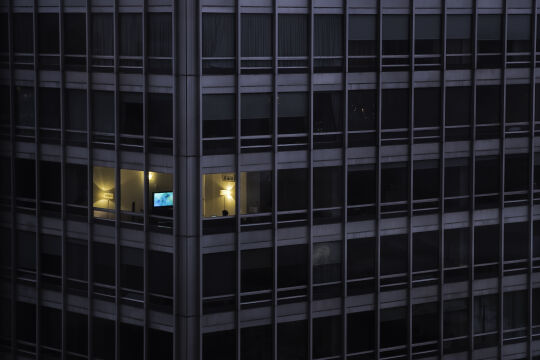Armut ist nicht nur beschämend, Armut macht auch krank und verkürzt das Leben. Ein Plädoyer für neue Regeln in diesem "ungerechten Spiel“ - und für eine bessere Integration des Medizin- und Sozialsystems.
"Wenn der erste Spieler sich sofort alle großen Straßen unter den Nagel reißt und die anderen nur noch abzockt, dann können die das kaum mehr aufholen.“ Marcel Merkle zählt zu den weltweit innovativsten Spiele-Entwicklern - und hat seit dem Klassiker "Monopoly“ noch dazugelernt. Der Startvorteil gehört für ihn zu den größten Herausforderungen: Denn oft führt die Dynamik des Spiels dazu, dass sich ein Vorsprung über die Spieldauer verstärkt und ab einem bestimmten Punkt kaum mehr umkehrbar ist. Es werde als frustrierend und ungerecht erlebt, erklärt Merkle, wenn der Verlauf davon abhängt, wer als erstes beginnt.
Die Spiele-Gestalter haben darauf mit unterschiedlichen Strategien reagiert. Wenn zum Beispiel in jeder Runde neues Kapital ausgegeben werde, dann sinke die Gefahr massiv, dass einzelne Spieler den Anschluss verlieren. "Zentral ist das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Menschen müssen das Gefühl haben, dass ihr Handeln Einfluss auf den Verlauf des Spiels hat.“ Ein Spiel, das als gerecht empfunden wird und dessen Regeln anerkannt werden, verbindet laut Merkle auf ideale Weise Elemente des Zufalls, der Geschicklichkeit und des "sozialen Ausgleichs“. Abgeschlagene Spieler, die die Regeln als ungerecht empfinden, können sich Brettspiel-Macher einfach nicht leisten.
Wohnbezirk bestimmt Lebenserwartung
Doch wie läuft das Spiel zur Zeit? Dreieinhalb Kilometer Luftlinie oder vier Stationen mit der U-Bahn trennen den ersten Wiener Gemeindebezirk vom ärmeren fünfzehnten. Die Patienten der beiden Bezirke trennt vor allen Dingen eines: viereinhalb Jahre Lebenserwartung. Sag mir, wo du wohnst, und ich sage dir, wann du stirbst. Es konnte unter anderem gezeigt werden, dass das gesteigerte Sterberisiko während Hitzeepisoden gerade in jenen ärmeren oder billigeren Bezirken am stärksten erhöht ist: Menschen in diesen Bezirken haben nicht nur von vorne herein eine kürzere Lebenserwartung, sondern sie leiden auch überproportional an den schädlichen Einflüssen von Umweltbelastungen.
Sprung nach London: 17.000 Beschäftigte in Ministerien werden auf Unter-schiede in der Sterberate bei Herzerkrankungen untersucht. Die niederen Dienstränge hatten eine bis zu viermal höhere Sterberate bei Herzerkrankungen als die oberen Dienstränge. Nimmt man ihnen Blut ab, finden sich in den unteren Rängen weit höhere Werte des Stresshormons Kortisol als bei den Top-Diensträngen. Kein Geld zu haben, macht ja nicht direkt krank - sondern die Alltagssituationen, die mit dem sozialen Status und mit allen damit einhergehenden Prozessen verbunden sind.
Die soziale Schere geht unter die Haut. Und sie schneidet ins Herz. So konnte in allen Industrieländern festgestellt werden, dass mit fallendem Durchschnittseinkommen der Bevölkerung die Krankheiten ansteigen, dass die untersten sozialen Schichten die häufigsten und die schwersten Erkrankungen haben und dass mit dem Abfall der Einkommen die Lebenserwartung deutlich sinkt. Es lässt sich eine soziale Stufenleiter nachweisen, ein sozialer Gradient, der mit jeder vorrückenden Einkommensstufe die Gesundheit verbessert und das Sterbedatum anhebt. Die meisten Beschwerden treffen die unteren Einkommensgruppen zwei bis drei Mal häufiger als die oberen. Besonders ausgeprägt sind die gesundheitlichen Ungleichheiten bei Erkrankungen des Bewegungsapparates, des Stoffwechsels und des Herz-Kreislaufsystems. Wer die sozialen Determinanten der Gesundheit beachtet, hat zentrale Bausteine für Präventionsmaßnahmen an der Hand.
Ein weiterer Aspekt, der Gesundheit und Soziales verbindet, sind die Dienstleistungen der sogenannten "Frühen Hilfen“.Aus der Forschung wissen wir, wie wichtig für die Entwicklung des Kindes die Frühphase des Lebens ist. Es ist gut, wenn Eltern so früh wie möglich bei der Aufgabe unterstützt werden, ihre Kinder verlässlich zu versorgen, und eine sichere wie liebevolle Bindung zu ihnen aufzubauen. Wir brauchen den anderen, um zu uns selbst zu kommen. Kinder mit sicherer Bindung sind selbstbewusster, weniger depressiv und haben größeres Einfühlungsvermögen. Das Projekt "Mum Talk“ der Diakonie Spattstraße in Linz setzt in den ersten Monaten und im Babyalter an. Hier geht es darum, dass Eltern bzw. Mütter die Bedürfnisse und Signale ihrer Kinder erkennen und verstehen. Diese Hilfen richten sich stärker an Familien, die es schwer haben. Mittels Filmsequenzen können sich die Frauen selber in den Interaktionen mit ihrem Kind sehen - und daraus selbst Schlüsse ziehen.
Der Geschmack des Vertrauens ist eine wichtige Währung. Investitionen im frühkindlichen Bereich haben den höchsten "return on investment“, sie zahlen sich aus. Nie wieder wird man Zukunftsgeld so sinnvoll einsetzen können wie zu diesem Zeitpunkt. Ein investierter Dollar entspricht einer Rendite von acht Dollar, hat Wirtschaftsnobelpreisträger James Heckmann errechnet; bei benachteiligten Kindern beträgt sie sogar 16 Dollar. Heckmann weist darauf hin, dass es nicht um kognitive Wissensförderung geht, sondern um das Wachhalten des Interesses an der Welt. Der Unterschied bei den Kindern im Perry Preschool Projekt war die Neugier, die Offenheit für Neues.
System-Trennung verhindert Lösungen
Für viele Maßnahmen fehlt die bessere Integration des Medizin- und Sozialsystems. Die Trennung zwischen ärztlichem Cure-Bereich und sozial-pflegerischem Care-Sektor sollte überwunden werden. Diese einander in Finanzierung und Organisation gegenüberstehenden Systeme verhindern gute, integrierte Lösungen für alle. Drei Beispiele:
• Behinderung: Um eine alltagsnahe Pflege zu ermöglichen und die Hospitalisierung von Menschen mit schwersten Behinderungen zu vermeiden, braucht es pflegerische und soziale Kompetenzen in betreutem Wohnen. Das ist jetzt nicht möglich.
• Pflege: Im Krankenhaus wird auf hohem Niveau für uns gesorgt, doch gelten wir als "austherapiert“, sind wir auf uns allein gestellt. Die pflegerische und soziale Betreuung ist unterfinanziert.
• Schwangerschaft und Geburt: Zwar ist die medizinische Betreuung ausreichend finanziert, doch andere Leistungen wie Hebammendienste oder Wochenbettpflege sind nicht abgedeckt. Die Folge ist, dass es diese Hilfen zu wenig gibt oder sie für Betroffene nicht leistbar sind.
Zurück zu den sozialen Determinanten der Gesundheit. Die Frage ist: Lerne ich den Geschmack vom zukünftigen Leben als Konkurrenz, Verlassensein, Gewalt? Oder habe ich die Erfahrung qualitätsvoller Beziehungen, Vertrauen und Empathie gemacht? Werde ich schlecht gemacht und beschämt oder geschätzt und anerkannt? Ist mein Leben von großer Unsicherheit und Stress geprägt, oder von Vertrauen und Planbarkeit? Je ungleicher Gesellschaften sind, desto defizitärer sind die psychosozialen Ressourcen. Es gibt weniger Inklusion, das heißt, häufiger das Gefühl ausgeschlossen zu sein. Es gibt weniger Partizipation, also häufiger das Gefühl, nicht eingreifen zu können. Es gibt weniger Reziprozität, also häufiger das Gefühl, sich nicht auf Gegenseitigkeit verlassen zu können.
Lippenbekenntnisse reichen nicht aus. Die aktuelle Spielaufstellung produziert zu viele abgeschlagene Spieler. Nur dort, wo wir gestalten können, Anerkennung erfahren und sozialen Ausgleich erleben, dort wächst Zukunft.
* Der Autor ist Sozialexperte der Diakonie Österreich mit den Schwerpunkten Gesundheit, Kinder/Jugendliche und Integration
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!