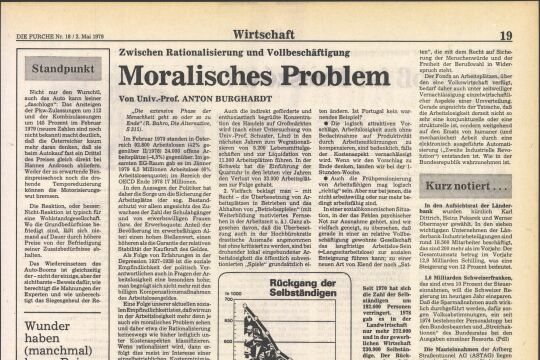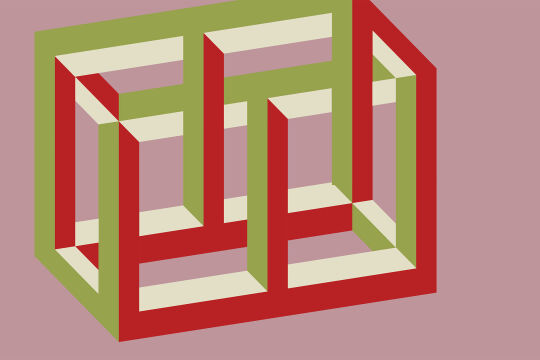Gesundheit ist eine Frage des Lebensstils - und viel mehr noch eine des Geldbeutels: Eine aktuelle Studie beweist, was die Österreichische Armutskonferenz seit langem beklagt.
Während die Regierung Einsparungen im Gesundheitswesen anstrebt und das Thema "Selbstbehalt" seit Wochen für Schlagzeilen sorgt, lenkt jetzt eine Studie des ÖBIG (Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen) die Aufmerksamkeit in eine andere Richtung: "Armut macht krank" lautet das Fazit der Untersuchung, die 1999 vom Sozialministerium in Auftrag gegeben, im Oktober 2002 fertiggestellt wurde - und erst jetzt im Rahmen der Jahrestagung der Armutskonferenz am 20. und 21. März in Salzburg präsentiert wird. Die Studie bestätigt für Österreich, was andernorts in Europa längst erforscht ist: Die soziale Ungleichheit von Menschen bedingt auch Ungleichheiten in ihrem Gesundheitszustand. Und diese Ungleichheiten steigen ständig an.
Kein Geld für Forschung
Nicht das individuelle Verhalten oder das Gesundheitssystem selbst sind für diese Ungleichheiten verantwortlich, sondern die gesellschaftlichen "Verhältnisse" - die Chancen auf Arbeit, Bildung, Wohnung und Einkommen. "Jene Staaten, die geringe Einkommensunterschiede in der Bevölkerung aufweisen, verzeichnen auch geringe Unterschiede in deren Gesundheitszustand", erklärt Martin Schenk von der Österreichischen Armutskonferenz. Die hier zusammengeschlossenen Initiativen weisen vor allem auf die triste Forschungssituation in Österreich hin, auf den Mangel an Zahlen und Fakten, der eine seriöse öffentliche Diskussion des Themas bislang verhindert hat. Willibald Stronegger, Statistiker am sozialmedizinischen Institut der Universität Graz, macht dafür die Konzentration von Fördergeldern auf einige wenige Forschungsschwerpunkte verantwortlich. "Randthemen" wie das der sozial bedingten Ungleichheit im Gesundheitswesen kämen dabei unter die Räder.
In Österreich fehlen nicht nur Daten, sie sind auch, falls vorhanden, nur schwer miteinander zu verknüpfen. So blieb die Untersuchung der Rostocker Forscherin Gabriele Doblhammer-Reiter, die 1981/82 österreichweit das Sterberisiko nach Geschlecht, Alter und Bildungsgrad analysierte, lange ein Einzelfall. Ihr Ergebnis: Männer zwischen 35 und 64 Jahren mit Pflichtschulabschluss haben ein um 109 Prozent höheres Sterberisiko als gleichaltrige Männer mit akademischer Bildung. Frauen haben ein um 50 Prozent höheres Risiko als höhergebildete Geschlechtsgenossinen.
Im Jahr 2001 folgte mit dem Wiener Gesundheitssurvey erstmals ein Gesundheitsbericht eines Bundeslandes, der systematisch Sozialvariablen mit dem Faktor Gesundheit verband. Er weist nach, dass der Gesundheitszustand der untersten Einkommensschicht mit einem Netto-Haushaltseinkommen von bis zu 730 Euro deutlich niedriger liegt als der Gesundheitszustand der darauffolgenden Schicht mit einem Haushaltseinkommen von bis zu 1.300 Euro. Dieser wird wiederum übertroffen vom Befinden der Schicht mit einem noch höheren Einkommen. So besteht beispielsweise im untersten Sechstel der Haushaltseinkommen gegenüber dem obersten Sechstel bei Frauen ein neun Mal höheres Gastritis-Risiko.
Die nun vorliegende ÖBIG-Studie bestätigt die wissenschaftlichen Ergebnisse aus anderen europäischen Ländern. Nur für ein Viertel aller Krankheiten sind demnach frei wählbare Faktoren ausschlaggebend, für die Hälfte sind es die materiellen Bedingungen, unter denen jemand lebt.
Anfällige "working poor"
Der Faktor Einkommen bestimmt dabei gleich einen zweiten Faktor mit: die Entwicklungschancen von Kindern. So ist die Gesundheitsungleichheit im Erwachsenenalter bis zu einem Viertel darauf zurückzuführen, welche Voraussetzungen ein heranwachsender Mensch in seiner Familie angetroffen hat. Dabei wiegen sozioökonomische Bedingungen - definiert über die finanzielle Situation, aber auch über den Beruf des Vaters und den Bildungsgrad der Mutter - noch weit schwerer als etwa psychosoziale Umstände.
Über das Einkommen wirkt auch der Faktor "Arbeit": Arbeitslose und Menschen mit Arbeit, aber ohne existenzsicherndes Einkommen, so genannte "working poor", identifiziert die Studie des ÖBIG als das "Gros der sozial schwachen Personen". Studienautorin Claudia Habl verweist in diesem Zusammenhang auf die steigende Zahl "atypischer Beschäftigungen" hin - Teilzeitstellen, die bereits jedes fünfte Beschäftigungsverhältnis ausmachen, befristete Anstellungen, Beschäftigungen auf der Basis von Werkvertrag, Geringfügigkeit oder "neuer Selbständigkeit". Der neue Sozialbericht verzeichnet 57.000 Personen als "working poor", also rund 170.000 Betroffene, wenn man die übrigen Mitglieder in Haushalten mitrechnet.
Arbeit als Gesundheitsrisiko
Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen sind nicht nur auf Grund ihrer materiellen Situation erhöhten Gesundheitsrisiken ausgesetzt, sondern auch wegen der Angst vor Arbeitsplatzverlust. In Oberösterreich hat sich gezeigt, dass Personen mit einem Einkommen unter 730 Euro zwar öfter zum Arzt gehen, aber nicht mehr Krankenstandstage aufweisen als Personen mit höherem Einkommen. Habl: "Da übertüncht einfach die Sorge um den Arbeitsplatz die Angst um die Gesundheit."
Noch etwas wird festgestellt: Je niedriger die berufliche Qualifikation, desto höher die gesundheitlichen Belastungen. Je schlechter die Bilanz zwischen Anforderung und Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum eines Arbeitnehmers ist, desto höher ist seine Anfälligkeit dafür, an Herzkreislaufkrankheiten zu erkranken und zu sterben, berichtet Willibald Stronegger. Die berühmte "Managerkrankheit", Infarktrisiko und Bluthochdruck, tritt bei Angehörigen niedriger Bildungs- schichten drei Mal so häufig auf wie bei Managern selbst.
Bildung ist nach Stronegger jene Variable, die auf die vielfältigste Weise mit Gesundheit korreliert. Menschen mit geringer Bildung kümmern sich weniger um ihre Gesundheit, und das selbst dann, wenn ihnen das Gesundheitssystem gleiche Chancen bietet wie anderen - etwa kostenlose Impfungen. Auch Aufklärung in einzelnen Sachbereichen ändert daran kaum etwas. Für Stronegger ein Hinweis darauf, dass es Bildung in einem umfassenderen Sinn braucht, um das bestehende Gesundheitssystem erst wirklich nutzen zu können.
Eine Studie des ÖBIG aus dem Jahr 2000 über "Zugangsbarrieren" zum Gesundheitssystem bestätigt das: Unter anderem spielt die Angst vor dem Gang zum Chefarzt eine Rolle, ebenso das mechanistische Körperbild, das ungebildetere Menschen oft erst dann zum Arzt gehen lässt, wenn der Körper nicht mehr funktioniert.
Abgesehen von diesen indirekten Barrieren zeigt das gut ausgebaute österreichische Gesundheitssystem aber auch Lücken, die direkt Ungleichheiten provozieren: So hat rund ein Prozent der Bevölkerung - etwa Obdachlose ohne Meldezettel und Job - keine Krankenversicherung, da diese an Erwerbsarbeit gekoppelt ist. Auch ein Selbstbehalt könnte Ungleichheiten erzeugen oder verstärken, meint August Österle, Professor für Sozialpolitik an der Wirtschaftsuniversität Wien.
Bildung als Prävention
Was die Schritte zur Beseitigung der Ungleichheiten im Gesundheitszustand der österreichischen Bevölkerung betrifft, sind sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einig: "Infrastrukturgerechtigkeit" fordert Stronegger - die Sicherung von Arbeit, Bildung, Wohnung für alle. Ein höheres Ausbildungsniveau, Senkung der Arbeitslosenquote und Sicherung der Arbeitsplätze verlangt Studienautorin Habl. Und: ausreichend finanzielle Förderung der einschlägigen Forschung.
Die Österreichische Armutskonferenz verschreibt sich inzwischen der Öffentlichkeitsarbeit. "1995, als die Armutskonferenz gegründet wurde, haben alle gesagt: Armut gibt es nicht bei uns. Heute bestreitet das niemand mehr", erklärt Martin Schenk. "Jetzt sagen wir: Arme sterben früher. In fünf Jahren wird auch das niemand mehr bestreiten."
Nähere Informationen zur Österreichischen Armutskonferenz unter www.armutskonferenz.at
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!