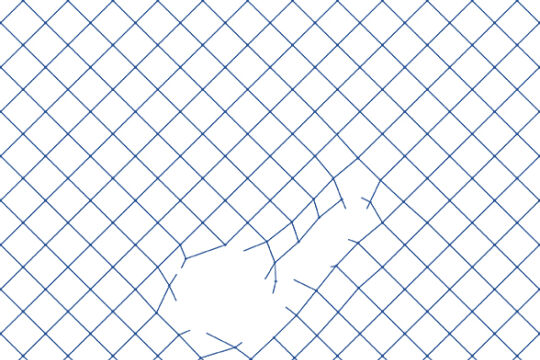Streitfall Mindestsicherung: Der Ausgangspunkt der staatlichen Überlegungen war ein Verbesserungsgebot. Doch was nun von der Regierung diskutiert wird, ist ein Verschlechterungsangebot auf beinahe allen Linien. Zeit für ein geharnischtes Plädoyer für eine dringend nötige Debatte über soziale Gerechtigkeit.
Mit der Mindestsicherung wird jetzt das Sozialsystem armutsfest gemacht, sagen die einen. – Jetzt wird ja keiner mehr arbeiten gehen, sagen die anderen. Nichts von beidem wird eintreten. Man kann rhetorisch und ideologisch wieder abrüsten. Mit der sogenannten Mindestsicherung werden völlig falsche Erwartungen geweckt. Bei den Hilfesuchenden genauso wie bei den prinzipiellen Gegnern von Sozialtransfers für Arme. Es wird über etwas diskutiert, das es so gar nicht gibt.
Die neue Mindestsicherung ist im Wesentlichen die alte Sozialhilfe. Sie ersetzt nicht die Sozialhilfe, sondern baut sich in das bestehende System der neun Bundesländerregelungen ein. Es wird weiter neun verschiedene Standards geben. In den meisten Punkten bleibt die Ausgestaltung zentraler Elemente den Landesgesetzgebern bzw. den Vollzugsrichtlinien der Behörden überlassen. Das führt die strukturellen Fehler des alten Sozialhilfesystems weiter.
Ausgangspunkt der Sozialhilfereform war jedenfalls, den Föderalismus-Dschungel mit neun unterschiedlichsten Regelungen zu überwinden und das untere soziale Netz existenzsichernd, grundrechtsorientiert und bürgerfreundlich zu gestalten. Ausgangspunkt war ein Verbesserungsgebot, kein Verschlechterungsverbot, wie wir es jetzt auf Druck des Finanzministers diskutieren.
Krisenopfer zahlen doppelt
Im Ministerratspapier steht der Satz, dass in einer „Arbeitsgruppe“ die „veränderten konjunkturellen und budgetären Rahmenbedingungen“ zu „bedenken“ seien. Aha. Die Opfer der Krise sollen jetzt also doppelt draufzahlen, während es für den Finanz- und Bankensektor Milliarden Steuergelder ohne international vergleichbar strenge Auflagen gab, vermögensbezogene Steuern tabuisiert und mit Steuergeld höchst unvorsichtige Investments in Steueroasen getätigt wurden. Die Abschaffung der Schenkungs- und Erbschaftssteuer, als Bagatellsteuer bezeichnet, entspricht genau der Summe der Mindestsicherung auf Bundesebene: 150 Millionen Euro. Wenn es um die ärmsten Prozent der Bevölkerung geht, scheint kein Geld da zu sein oder droht der Staatsbankrott. Dieses Muster ist bei der Verschlechterung der Mindestsicherung genauso wie bei den Zuschlägen beim Kindergeld beobachtbar. Gearbeitet wird mit allen Mitteln. Das aus dem Finanzministerium vorgebrachte Beispiel mit einem Familienvater, der seine Arbeitszeit reduziert, um dann Sozialhilfe zu beziehen, ist höchst unseriös und unlauter.
Denn wer zur Zeit ein Sparbuch hat, ein nicht zur Arbeit benötigtes Auto, eine private Pensionsvorsorge oder auch nur eine Sterbegeldversicherung, muss alles verkaufen, das Geld verbrauchen, bevor er sich überhaupt aufs Sozialamt wagen kann. Bei Wohnungseigentum sichert sich der Staat noch im Grundbuch ab.
In der Praxis stellt sich die Sozialhilfe als eine „Abschreckungshilfe“ dar. 60 Prozent der Haushalte, denen Sozialhilfe zustünde, nehmen diese nicht in Anspruch. Doch wer schnell hilft, hilft doppelt. Die Ursachen für die geringe Inanspruchnahme sind vielfältig: Da gibt es subjektive Faktoren wie Scham, besonders im ländlichen Raum, da gibt es institutionelle Barrieren wie weite Wege oder auch negative Erfahrungen mit Ämtern sowie gesetzliche Hürden. Eine groß angelegte Erhebung der Armutskonferenz zeigt, dass es im Sozialhilfevollzug der Länder grobe und rechtswidrige Mängel gibt. Ohne Verbesserung des Vollzug-Wesens bleibt jede Sozialhilfereform ein Papiertiger.
Die Liste der Beispiele ist lang: Ein Drittel der Beratungseinrichtungen berichtet, dass die Hilfesuchenden am Sozialamt Falschauskünfte erhalten. 17 Prozent der Hilfsorganisationen machen die Erfahrung, dass Sozialämter Anträge ablehnen, 47 Prozent, dass Rechte nur nach Intervention zugestanden werden. Allein hätten Betroffene – obwohl anspruchsberechtigt! – keine Chance gehabt. Mehr als ein Drittel weiß von Demütigungen Bedürftiger in den Ämtern. Die Hitliste der Beschämungen wird von herablassendem Verhalten angeführt, aber auch Lächerlichmachen und Unterstellungen kommen häufig vor. Länder zahlen eine niedrigere Sozialhilfe aus, als in ihren eigenen Gesetzen als Existenzminimum definiert ist. Die Hälfte der Befragten berichtet von Soforthilfe, die es nicht gibt, weil Wochen und Monate vergehen, bis Sozialhilfe ausgezahlt wird. 45 Prozent sagen, dass es Vorschüsse auf Sozialleistungen – wie im Gesetz vorgesehen – in der Praxis „grundsätzlich nicht“ gibt. Je nach Bundesland wird Unterstützung beim Wohnen gewährt. Laut Studie sagen 70 Prozent der Beobachter/innen, dass dieser Teilbetrag für Miete, Energie und Betriebskosten nicht ausreiche, weil die Kosten tatsächlich viel höher sind.
Leben am Limit macht Stress. Dutzende Studien weisen den Zusammenhang von Armut und Stress nach. Ökonomische Benachteiligung führt zu erhöhtem emotionalem Stressaufkommen, konnte Kurt Salentin in seiner bekannten Studie „Armut, Scham und Stressbewältigung“ nachweisen. In der Public-Health-Forschung ist seit Jahrzehnten bekannt: Die sogenannte Managerkrankheit mit Bluthochdruck und Infarktrisiko tritt bei Armen dreimal so häufig auf wie bei den Managern selbst. Nicht weil die Manager weniger Stress haben, sondern weil sie die Freiheit haben, den Stress zu unterbrechen: mit einem guten Abendessen oder einem Wochenende in Paris. Den Unterschied macht die Freiheit.
Armut ist das Leben, mit dem die wenigsten tauschen wollen. Armutsbetroffene haben die schlechtesten Jobs, die geringsten Einkommen, die kleinsten und feuchtesten Wohnungen, sie üben die ungesündesten Tätigkeiten aus, wohnen in den billigsten Vierteln, gehen in die dürftigst ausgestatteten Schulen, müssen fast überall länger warten – außer beim Tod, der ereilt sie um durchschnittlich sieben Jahre früher als Angehörige der höchsten Einkommensschicht.
43.600 Kinder und Jugendliche müssen unter Sozialhilfe-Bedingungen leben. Das ist ein Anstieg um 20 Prozent. Die Gründe dafür sind die zunehmende Zahl an „working poor“, nicht-existenzsichernde Notstandshilfeleistungen, Arbeitslosigkeit, der Anstieg an psychischen Erkrankungen und gestiegene Lebenshaltungskosten beim Wohnen. Das sind nicht die „ganz anderen“, sondern viele trifft es, die „es sich nie gedacht hätten“.
Rechnet man nun zu den 152.000 Sozialhilfebeziehern in Privathaushalten jene in Alten- und Pflegeheimen dazu, das sind 61.133, käme man insgesamt auf 214.000 Menschen, die ihren Lebensunterhalt oder ihre Pflege nicht mehr selbst bestreiten können. Die Sozialhilfe wird nicht die Pflegekosten der Zukunft von Menschen mit geringem Einkommen tragen können. Pflege gehört zu den großen „Lebensrisiken“ wie Arbeitslosigkeit oder Krankheit. Die Kosten dafür müssen daher auch solidarisch finanziert werden. Niemand will im Fall der Pflege zum Sozialfall werden.
Geänderte Arbeitswelt
Und zukünftig werden Phasen der Erwerbslosigkeit die Biografien der meisten Arbeitnehmer prägen. Lückenlose Erwerbsbiografien samt lebenslangen 40-Stunden-Anstellungen dürften die Ausnahme, nicht die Regel darstellen. Auf diese Herausforderungen muss sich auch das Sozialsystem einstellen. Ein leistungsfähiges unteres soziales Netz ist eine zukünftige Versicherung gegen Armut in einer sich verändernden Arbeitswelt, die nicht mehr dem Arbeitnehmerbild der 60er und 70er Jahre entspricht.
Klar ist aber auch: Die Sozialhilfe kann nicht der Staubsauger für alle strukturellen Probleme sein, die in der Mitte der Gesellschaft angelegt sind: Arbeitslosigkeit, Pflegenotstand, prekäre Jobs, mangelnde soziale Aufstiegschancen im Bildungssystem. Besser ist es stets, präventiv zu verhindern, dass Leute in die Sozialhilfe fallen.
www.mindestsicherung.at
* Martin Schenk ist Sozialexperte der Diakonie und Mitbegründer der Armutskonferenz.